
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Götter, Könige und Tiere in Ägypten
Date of first publication: 1921
Author: Mechtild Lichnowsky (1879-1958)
Date first posted: Nov. 16, 2021
Date last updated: Nov. 16, 2021
Faded Page eBook #20211130
This eBook was produced by: Delphine Lettau, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net


Ramses II. Kolossalbüste in rotem Granit.
Kairo.
MECHTILD LICHNOWSKY
GÖTTER,
KÖNIGE UND TIERE
IN ÄGYPTEN
MÜNCHEN
KURT WOLFF VERLAG
Die Illustrationen wurden nach Zeichnungen der Verfasserin und
photographischen Aufnahmen der Originale
hergestellt
5. Auflage
Copyright by Kurt Wolff, Verlag, Leipzig (1912)
Gedruckt im Frühjahr 1921 von der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Götter, Könige und Tiere in Ägypten
Wir sind auf unserer Insel zu jener Nachmittagsstunde angekommen und von jener Beleuchtung umfangen worden, die jegliche Müdigkeit vergessen macht. Fünf Uhr nachmittags war es, und dazu denke ich einen blumigen Park und angenehme Hausleute, die uns mit duftendem Tee bewirten. Nicht daß uns das alles in Assuan wirklich passiert wäre; aber beim Anblick des Weges, der zum Hotel hinaufführt, hatte ich liebliche Vorstellungen von Häuslichkeit und verschwiegenen Gärten, ein gutes Zeichen für einen Gasthof. Ich hörte zunächst ein Geräusch, das mich entzückte: eiserne Rechen auf Kies. Gibt es einen sommerlicheren Ton?
Lange stand ich am Holzbalkon meines Zimmers, das gegen Osten schaut und ... es ist fünf Uhr nachmittags. Die schreckliche, runde, unbarmherzige Sonne ist gottlob hinter mir, wo sie hingehört, so daß ich ihr verflossenes Tagewerk genieße. Sie hat alles warm und ernst gemacht—und wirklich, die Beleuchtung der Stadt ist ihr aufs beste gelungen. Das macht sie hier genau so, wie ich es vom heimatlichen Hause aus fünfundzwanzig Jahre meiner Kindheit und Jugend beobachten konnte; in dieser Himmelsrichtung kenne ich mich freilich gut aus. Für die Westseite hatte ich nicht das Interesse, außer, wenn sie Gewitter versprach.
Die Westseite ist in Ägypten die Fremdenseite. Man nimmt sich Extraschiffe für die Sonnenuntergänge, und Aquarellisten feiern Orgien in Gelb und Aprikosentönen, die sie in Nilgrün tauchen. Ich begreife das sehr gut—, es ist ja eine Wonne, mit dem Pinsel tiefe Höhlen in diese Farben zu bohren—und ich finde es trotz allem herrlich, wenn ich, das Kinn oben, die Augen unten, mit Rumpfbeuge die allabendlichen Drapierungen am Himmel betrachten kann. Heute aber tue ich nichts anderes, als liebevoll den erkalteten Osthimmel, den Strom und zwischen beiden die dachlose, niedere Stadt Assuan mit dem einzigen, ziemlich billigen Minarett in mein Herz zu schließen.
Meine Stimmung ist immer noch vom Park-und Jausenbegriff befruchtet. Ich glaube, das ist eine Erinnerung aus der Kindheit; der Inn, der Park von Vau, der bei Überschwemmungen zerrissen und verwüstet wurde—und o—die Johannisbeerkuchen und Erdbeeren ...
Der Nil hat jetzt die Farben des Himmels—ein grünwerdender Türkis—kein Zweifel—die Teestunde ist nicht mehr—die Nacht steigt auf—mit dem Mond wird man noch allerlei erleben—Gott weiß, was der heute abend an Koketterien vorbereitet.
Jetzt leuchtet der glatte, grünende Türkis mit den Lichtern, die ihm das Stadtufer leiht; jedes Haus schenkt ihm welche und schmückt so sein schillerndes Gewand mit blitzenden Knöpfen. Die Hügel sind zur Hälfte noch rosig—der Fuß steht schon in Dunkelheit getaucht —sie gleichen ruhenden Kamelen.
Mir verschwinden die Buchstaben auf dem Papier und alle Spatzen haben es mit einem Male vorgezogen, ihr Nachtquartier aufzusuchen. Jetzt weiß ich, daß ich in Ägypten bin. Solange die Spatzen ihr wenig variiertes Zwi geschrien hatten, war ich weit, weit in meiner Kindheit gewesen,—bei Ludwig dem Bayern, Friedrich dem Schönen, Karl V., bei Miltiades,—Decius Mus—Anna Boleyn, unter dem Birnbaum, wo ich Weltgeschichte lernte; Welters Weltgeschichte und Spatzengeschrei aus schattigen Efeuwänden mit Augustsonne; auch Geographiestunden und französische Verben kann ich aus dem Spatzengezwitscher hervorzaubern ... Handels-und Fabrikstadt—, Sitz eines Erzbischofs —mein Gott, wenn man das Erzbistum mit der Universitätsstadt verwechselte ... zwi—zwi—zwi, Caligula folgte seinem Vater Philipp II. ... klingt das etwa falsch?—— Heute nachmittag suche ich Heidelbeeren beim Fuchsloch ... Breslau: Reis, Mais, Südfrüchte ... Nachher lese ich den „Roten Freibeuter“ zu Ende, und jetzt esse ich mein Zehnuhrbrot, das köstlich frische, und esse jedes einzelne Brösel in Ekstase—, namentlich die angebrannten Stellen. Caligula—— Assuan —— . Wo bin ich denn? Da oben ist jetzt wirklich der Mond. Lautlos, viel zu groß, kommt er angerollt—, mein persönlicher Mond, der sich im Inn gespiegelt hat. Es ist unangenehm, daß er jedem gehört, und ich spüre, daß er mir die Blicke zurücksendet, die andere jetzt auf ihn richten, und unwillkürlich schaue ich weg.
Ich sitze bei den blühenden Orangenbäumen und muß mich überwinden. Denn statt zu schreiben, läge ich gern auf dem Boden, blinzelte in den Himmel hinauf und ließe auf tausenderlei Weisen meine Nase Übungen machen.
Ich habe schlechtes Gewissen, weil ich gleich mit Assuan beginne, trotzdem ich 14 Tage in Kairo war. —Ich habe auch nichts von unserer Überfahrt von Triest nach Alexandrien erzählt—überhaupt, ich bemerke, daß ich nichts von dem weiß, was andre interessieren müßte—und wenn ich dennoch schreibe, so geschieht es aus reinstem Egoismus, und das ist, glaube ich, das Normale.
Wenn ich mir jetzt in Assuan oder genauer gesagt, auf unserer Insel Elephantine Kairo vorstellen will, so erscheint ein Bild, das ich alsbald wieder in die Versenkung schicke. Aber eben kommt mir ein Eindruck, der mich beglückt: Wir waren in dem Straußengestüt, bei Neu-Heliopolis, einer Stadt, die auf Bestellung per Nachnahme entstanden ist (bitte schicken Sie mir 3000 km Marmor, doppelbreit, dekatiert, 1200 Stück Alabasterkuppeln, 8000 qm Stein-und ebensoviel fertiggekeimte Grasplätze mit roten Sandwegen, den Meter zu 5 Mark 70).
Also in der Nähe dieser Stadt, von der ich, wenn die Orangenblüten es mir erlauben, noch vielleicht etwas erzählen werde, ist die Straußenzucht. In der Schule lernt man nur, daß der Hund beißt, das Pferd ausschlägt. Was aber der Strauß aus Rache tut, wenn er nicht davonläuft, das weiß niemand: Er gibt Fußstöße nach vorne wie ein unartiger Fratz. Wenn ich seine Schenkel betrachte, denke ich an eine Schnapsnase; genau wie an dieser sieht man rote Äderchen, bloß daß die Haut runzelig ist. Warum, warum gerade dieser Vogel keinen Flaum darüber tragen darf, wo doch die Taube sowohl, als der Geier ganze Höschen davon besitzen? Aus Sparsamkeit, denn ein Straußenbein ist lang. Es wäre zu viel gewesen für Mutter Naturs Etat. Dann aber warum diese Verschwendung an teuren Pleureusen?
Dem langen Hals geht es ebenso. Ein gerupftes Huhn sieht angezogener aus als der Strauß, dem kein Kamm, keine Krause, nichts beschieden ist, seine Blöße zu bedecken.
Allerdings wirken infolgedessen die Topas-Halbkugeln, —seine Augen,—in all dem Rosa und zwischen den Wimpern, die er wie umgekehrte Seitenkämme an dem Gesimse seiner Augenränder trägt!
Die Winkel seines Schnabels bilden einen so unverkennbaren Zug von Naivität, daß man zu glauben anfängt, das Ganze ist ein Bub, der Indianer spielt und Mamis Hutfedern als Schurzfell benützt.
Ich gab dem größten Strauß, der über mir wie ein Turm hinwegragte, eine Orange zum Ansehen. Erst zeigte er Herablassung, dann aber rollte er in beiden Augen zwei Räder der Begehrlichkeit. Im Nu war meine Hand leer, und sieben Nachbarschnäbel schnappten enttäuscht zusammen, wie wenn Marktfrauen aus Erstaunen in die Hände klatschen. Die Orange ging im Innern des Halses eine steile Treppe hinunter.——
Noch eine?
Gewiß; noch viele!
Aber du kannst sie doch nicht schmecken, der Saft ist ja in der Rinde eingesperrt. Die Rinde ist bitter ... Ich staune und denke ...
Ah, da fällt mir das deutsche Wort „Straußenmagen“ ein. Also das wissen die Menschen schon? Alles wissen sie,—ich kann ihnen nichts erzählen.—
Ich will ja von Kairo sprechen, aber wie gesagt, wenn ich an Kairo denke, so kommen schlechte Bilder, die ich fortschicken muß; und von dem Paradies in Kairo, dem Museum, sage ich einstweilen nichts; ich komme ja auf der Heimreise wieder hin ...
Vielleicht kann ich davon sprechen, wenn es mich etwas weniger erfüllt.
Jetzt gehe ich fort von hier, die Orangenblüten lassen mich nicht in Ruh. Ich gehe zum Nil. Ich setze mich ans Ufer mit einer dunkelgrünen Brille, damit mir sein Glitzern nicht weh tut.
Das also ist der Nil! Er und der Guadalquivir waren die Flüsse meiner Kinderphantasie gewesen. Für die Liebe der Guadalquivir, für phantastische Erzählungen aus fernen Landen und Zeiten—er—der Nil. Da geht er, streift mich fast, lautlos, und eiliger als man glaubt. Löwen haben von ihm getrunken, vorsichtig, niedergedrückt sich ihm nähernd. Gazellenmünder, kaum eingetaucht, haben von ihm geschlürft. Leise gurgelnd ist er über Krokodile hinübergeglitten, vom Nilpferd weiß er alles.
Er hat sich ohne Widerrede zivilisieren lassen und spielt heute mehr denn je die Vaterrolle.
Er hat sich sein langes Leben sehr verschiedentlich eingeteilt. Aber niemals gibt er die heimatliche grüne Farbe seiner Seen auf. Ob er der Sonne seine Fläche träg entgegendreht—oder sich durch enge Schluchten, fast mit Meerestiefe, hindurchzwängt—sein Grün ist immer trüb verschleiert, fast lehmig gefärbt. Er läßt sich nicht gern interviewen. Er trägt Geheimnisse, die noch niemand ihm entrissen hat—aber wieviel Wundergaben hat er schon seinen Kindern mitgebracht: Land schenkt er ihnen und Baumaterial, und er begießt auch noch das Erdreich, das er brachte.
Er sieht immer tief aus, auch wenn er seicht ist—, eine nützliche Eigenschaft für Menschen. Auch der Fluß wird dadurch gefährlich; seine geheimnisvollen Sandbänke sind Fallen, in welchen er die Schiffe festhält. Er wechselt den Ort seiner Fallen, er stellt sie unversehens da auf, wo vor kurzem noch eine schiffbare Tiefe war. Er fließt in einem milden Sandbett. Aber bei Assuan umspült er Riesen aus schwarzem, bronzeglänzendem Granit neben rosa Granitblöcken und ausgehöhlten Sandsteinfelsen, die unwahrscheinliche Gestalten angenommen haben: büffelförmige, kauernde Klumpen sieht man, und große Kegel, denen der Strom Taillen eingekerbt hat, und übereinandergetürmte Quader mit abgerundeten Schlußsteinen sitzen so, als trüge sie ein waghalsiger Jongleur. Die hat das Wasser vor Urzeiten einmal so zusammengerollt—dann ist es zurückgetreten und hat, boshaft, keinen Schritt mehr unternommen, die Steine aus ihrer Schwebestellung zu befreien. Sie halten gut—der größte Sturm könnte sie nicht verrücken.
Seit wann mag er schiffbar geworden sein?—und welcher war wohl der erste Steinkönig, den er auf seinem Rücken tragen durfte?——
Vielleicht die grüne Chefrenstatue mit dem weltironisierenden Lächeln——
Nun hat mich der Nil selber nach dem Paradiese von Kairo gebracht, das ich vorläufig meiden wollte.
Dieser König Chefren ...
Wenn ich bedenke, mit welchem Gesicht Menschen sagen: „Mein Urgroßvater“, und dann sehe ich fast 3000 v. Chr. diesen Urkönig eine Gesellschaft dominieren; ich sehe, wie er erst eine Weile schweigt, ehe er antwortet—er kennt alle Geheimnisse der Autoritätsbewahrung —, und hat wohl nie Mitleid gespürt, am wenigsten für sich selbst. Er lächelt; nicht wie Ramses II. lächeln wird; sein Lächeln ist nicht gottmenschlich, wie das des großen Ramses; in der IV. Dynastie hat das Lächeln noch etwas Satanisches. Der Spitzbart und die beiden Ecken seines Kopfschmuckes geben ihm die Teufelsmaske. Mephisto beim Bau der Pyramide ... Und wenn die letzte polierte Granitplatte daran festsitzt, müßte das Lächeln in ein Heulen ausbrechen ... Schöpfer und Satan in einer Person.
„Der Zeiger fällt—er fällt, es ist vollbracht“ ...
Der König Chefren sitzt barfüßig auf seinem Thron. Beide Arme liegen auf den Knien. Seine Rechte ballt die Faust, die Linke liegt flach.
Der grünliche Diorit zeigt gerade auf den Wangen zwei dunkle Flecken, die etwas Spielerisch-Grübchenhaftes haben. Aber der Unterkiefer läßt nicht mit sich spaßen. Ohne dem Lächeln etwas zu nehmen, wiederholt es den Ausdruck der Fausthand ... Blut und Schweiß konnten rinnen—Stricke und Ketten und Hebel mochten brechen unter der Last der Blöcke— der König hört nicht auf zu lächeln—und die Pyramide wächst unter dem Wehklagen der Menschentiere und den Hieben der Aufseher.——
Die Augen unter den etwas heraufgezogenen Brauen folgen mir, wie ich durch den Saal gehe—und noch an der Türe sehe ich mich um nach ihm. Er hat es bemerkt.
„Regläk“ sagen die Leute ihren Reittieren, um ihnen zu empfehlen, auf die Füße acht zu geben. „Regläk“! und die Eselchen spitzen die Ohren, heben ihre viel zu kleinen Hufglocken, mit denen sie auf dem Boden klimpern, auf, und senken ihre grauseidenen Münder sehr interessiert auf den Weg; Kamele reagieren anders auf diesen Zuruf: Sie drehen ihre runden Bärenohren und ändern sonst gar nichts. Sie wissen genau, daß die Lederkissen unter ihren zwei Zehen in jedem Fall Sicherheit gewähren. Die Pferde aber, ernst, arbeitstreu und selbstlos, heben ihre Beine, verlängern den Schritt und weichen allem Gefährlichen aus; man könnte glauben, jede ihrer Fesseln hat ein Auge, so vorsichtig werden sie gekrümmt und wird der Huf gestellt.
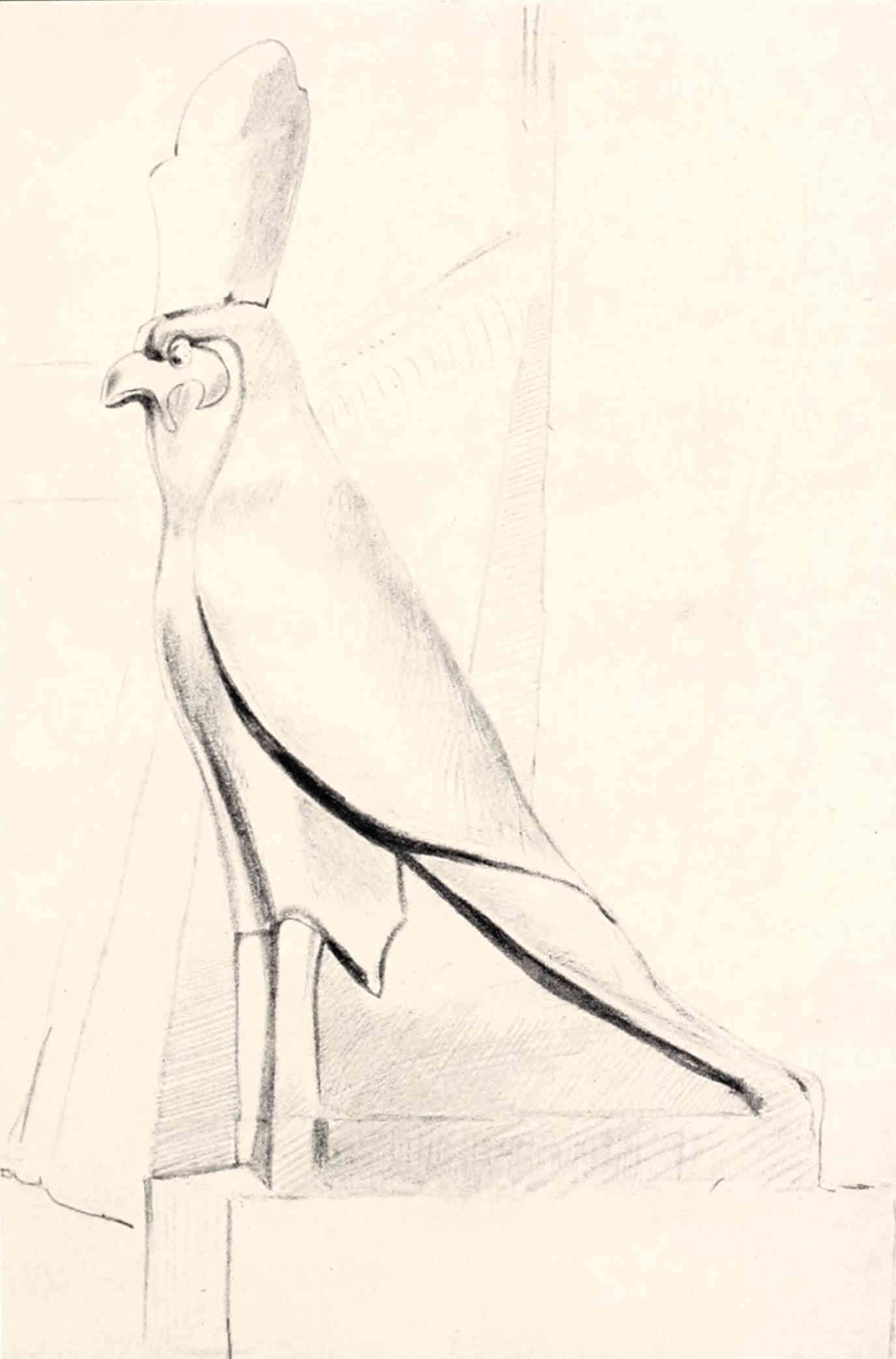
Gott Horus im Tempel zu Edfu.
„Regläk“, sage ich meinem Schwarzbraunen, und er überschreitet einen niederen Telegraphendraht an der Bahn, als hätte er ihn gesehen. Der kleine Hengst ist ein Engel. Ich brauche bloß Galopp zu denken— schon stellt er drei steinharte Muskeln in seinem Halse auf, macht zwei spitzige Ohren nach hinten, grunzt wie ein Ferkel, und los geht er mit einem wehenden Pelzbukett auf der Stirne.
„Regläk“ sage ich ihm, denn ich sehe eine längliche Sanderhöhung, in welcher ein Wasserrohr irgendeiner Kolonie Wasser zuführt. Er entspannt seine Halsmuskeln, spitzt die Ohren nach vorne, geht im Schritt über das Rohr und dann gleiten wir wieder über der Wüstenfläche im schärfsten Galopp. Ein Kind könnte ihn führen. Die Zügel spüre ich nicht, und er spürt sie wohl auch nicht. Jetzt nickt er bei jedem Sprung wie eine Taube und hat auch seine Öhrchen gelockert. Ich sage ihm: „Du mit deinem Veilchenbukett auf der Stirne, ich habe dich lieber als ...“ und ich nenne viele Namen, wie sie mir kommen. Das Pferdchen weiß nichts von der Welt und kann nicht demoralisiert werden. Neben mir galoppiert ein größerer Fuchs-Scheck mit weißen Beinen und Bauch. Nüstern und Mund sind rosa emailliert, das Auge ist schwarz und zeigt viel Weißes, als hätte er es auf Bildern gesehen, daß das Pferdeauge dadurch „feurig“ würde. Er macht immer sein „feuriges“ Auge, auch wenn er bloß in aller Harmlosigkeit seine nelkenfarbige Zunge lüftet.
Mein Schwarzbrauner gehört einem Scheich, der ihn an bessere Fremde vermietet.
Die Wüste um Assuan ist zauberhaft schön. Rechts vom Strom ist ihr Sand grau, links orangegelb. Steinbrüche aller Art finden sich in langen Hügelketten: Alabaster, roter und schwarzer Granit; dort liegen auch halbbehauene Riesen-Monumente, die niemals den Weg ins Freie antreten durften, und ein Sarkophag mit Ringen, der den Mutterblock nie verlassen hat; halb poliert ist er, ausgehöhlt, aber festgewurzelt; und inmitten einer Felsenkette von rosa Granit schläft ein großer Ramses, eingebettet, das Gesicht der Sonne zugekehrt, schon lächelnd, zum Himmel lächelnd, aber noch ganz der Erde angehörend. Seine leichtverschleierten Körperumrisse—die Hände—werden nie mehr Leben erhalten—, ewig wird der Koloß sehnsuchtsvoll in seiner Wiege bleiben, die ihm ein Sonnengrab geworden.
Leute, von denen man es nicht erwartet hätte, jammern um Philae. Natürlich wird falsch gejammert.
Es ist wohl traurig um Philae bestellt. Eine kleinwinzige Insel stand im Nil; ihre Palmen waren zu zählen, zwischen den Felsen wucherte ein feines, gesundes, wohlgedüngtes Gras, und nur die Gottheit bewohnte diesen Ort—angeräuchert—angebetet in ihrem Tempel. Dieser Tempel ist zart, elegant gebaut und trotz seiner Quader nicht erschütternd wuchtig. Seine Säulen sind verzauberte Lotos-und Palmenblätter. Sie sind wie gebundene Sträuße, sie duften fast, so leicht ragen sie zum Dach empor.
Heute spielt ein eigenartiger Spuk von Venedig in den Tempelmauern. Auf kleinen Booten dringt man in das Heiligtum. Der Widerschein der Nilwogen schimmert an den Mauersteinen entlang bis hinauf zu der Decke, die in herrlichen Farben ein Flügelpaar zeigt, das Sinnbild der Sonne.
Ich muß sagen, ich verlange mir nichts Schöneres wie diese Überschwemmung in diesem Tempel—, bloß darf sie nicht höher kommen.—Es gibt in Ägypten keinen Tempel, dessen Säulen farblich denen von Philae gleich kämen; die Farben der Blatt-Kapitäle sind fast unversehrt und von zartester Türkis-, Saphir- und licht Smaragdtönung, von einem neutralen Rostbraun unterbrochen.
Soviel ich weiß, sind vor der Eröffnung des großen Stauwerkes zum Schutz des Isistempels die schadhaften Stellen auf das sorgfältigste ausgebessert worden. Dann ließ man die große Flut kommen. Aber nun droht das letzte Verderben: der große Staudamm soll um 7 m erhöht werden; und mit dem Wasser gehen die letzten Farben dahin ... Es wird sich niemand rühren, der dem Verurteilten Begnadigung brächte. Die Baumwollkönige nehmen weitere Millionen Pfund ein, und in den Reisebüchern wird man lesen: „Die Schiffahrt auf dem Staubecken ist nicht zu empfehlen, da die Ruinen des Tempels von Philae die Schiffe gefährden könnten. Bei niederem Wasserstande tauchen die obersten Tempelsteine aus dem Wasser hervor.“
Weshalb wurde nicht von vornherein ein Damm um die Insel gezogen? Sie ist ja nicht größer als etwa 250 qm.
Was wird Cook dazu sagen, wenn die Mondscheinexpeditionen nach dem Tempel fortfallen werden und in Assuan nur mehr Lungen-und Nierenkranke Aufenthalt nehmen wollen? Noch ist Philae zu retten, und ich glaube nicht, daß die Kosten hierzu unerschwinglich wären. Könnte der Tempel nicht abgetragen und auf der kleinen Kitchener-Insel aufgestellt werden?
Nur Banausen in Künstlermasken, Wölfe in Schafskleidern, fänden hierin eine Profanierung.
Ist etwa die Kuh Hathor im Museum nicht besser aufgehoben, als wenn sie in ihrem Heim bei Luksor Arabern und Touristen preisgegeben wäre?
Der Tempel ist ganz aus Quadern, ohne Bindestoff aufgebaut; die Kosten der Übertragung sind sicherlich geringer als z. B. die der Herstellung des Friedenstempels im Haag und wären nützlicher angewandt.
Acht Kamele knien auf der abschüssigen Sandböschung des Nils—die Stadt Assuan ist still—, der Himmel dunkelgrün, der Mond hinter runden Wolken.
Ich warte bescheiden, daß mir jemand mein Kamel anweist, aber ich sehe, daß ich gezwungen bin, das Tier zu besteigen, das mir die anderen übriggelassen haben.
Es sendet mir einen wütenden Blick zu, bewegt den Kopf und möchte mich am Aufsitzen hindern—es brüllt wie ein Tiger, aber was hilft es—, es muß heut seine Nachtruhe opfern und muß zum hundertsten Male nach Philae traben. Der Zufall hat eine bunte Gesellschaft zusammengewürfelt aus Amerika, Frankreich und Deutschland. Es ist 10 Uhr abends. Mein Kamel, das verschmähte Aschenbrödel, erweist sich als ein Rasse-, Renn-und Reittier bester Klasse.
Es trägt ein lieblich bimmelndes Glöckchen an himmelblauer Kette um den Hals—und ist immer voran. Ich brauche bloß ein wenig anzutreiben, und schon rudert es weich und elastisch über den Sand. Ich sitze turmhoch und gebe mich seiner Bewegung hin, ohne im Sitz gehoben zu werden.—
Arme und Beine und das Kreuz muß man locker lassen, dann wird man stark, aber nicht unsanft vorwärts gebracht und hat ganz das Gefühl von eigener Bewegungskraft bei köstlicher Ausruhmöglichkeit. Wie ein leichter hypnotischer Schlaf überkommt es einen, ich treibe mein Tier zuweilen an, bloß um von den anderen fortzukommen, die sich mit allerlei tollem Zeug beschäftigen und mir mein Verhältnis zu Ramses, meinem Glöckchenkamel, stören.
Ramses ist der einzige, der läuten kann. So fein und kläglich klingt es bei jedem Schritt, der unhörbar die Wüste streift. Der Mond kommt aus den Wolken hervor, mein Ramses schaut nach rechts und nach links und läßt sich willig an seinem Halsstrick leiten; er ist frisch und rennbereit, und aufmerksam wie ein Dachshund beschnuppert er die Gegend. Wenn die Luft etwas frischer weht oder der Mond neu hervortritt, hebt er den Kopf—und beobachtet. Wir kommen an einem mohammedanischen Friedhof vorbei. Da sind viele Gräber, die wie Puppenbetten aussehen, runde Kuppeln, einsame Steine—alles vom Monde erhellt, so daß man die Farben erkennen kann. Ich läute daran vorüber und ahne nicht mehr, wo ich mich befinde. Ich fühle mich als ein willenloses Geschöpf, das in unbekannte Lande verschleppt wird und sich auf außergewöhnliche Erlebnisse vorzubereiten hat.
Es scheint mir ganz natürlich, das es 11 Uhr nachts ist, daß ich in Afrika auf einem Fabeltier allein mit Unbekannten sitze. Die Luft ist kühl und die Gegend von aufregender Stille. Mein Ramses schnuppert, und ich sehe sein nasses Auge im Mondlicht glänzen. Du weißt ja nicht, wen du trägst; vielleicht zum ersten Male einen Freund. Denke dir, wie ich klein war, habe ich Hummelnester gesucht, und wenn ich eines gefunden hatte, baute ich um das kleine Erdloch einen Hof aus Cement, mit Dach und einer Fensteröffnung. Alle Hummeln mußten durch die Luke ein und aus —sie taten es und gewöhnten sich rasch, und ich saß daneben und kannte alle Bewohner: Die Hummel Anna und die Hummel Sophie und den Hummelbären ...
Ich könnte dir solches und manches andere erzählen, weil ich fühle, daß du das in mir verstündest. Schau, ich finde diese Nacht so voll Geheimnisse, ich fühle mich so frei in der Gesellschaft.
Sage, hast du solche Reiter und Reiterinnen gern? Merkst du den Unterschied?
Dort wird gesprochen, geschrien, gelacht, wo die Wüste so still und der Himmel so feierlich ist——
Sie reden über Schmuck, Schneider, über Läden und Gesellschaften,—sie sollten doch lieber sich schlafen legen oder zu Hause sitzen—was wollen die hier draußen in der großen Freiheit, die nur uns gehört, dir und mir?
Auf einmal stehen wir am großen Spiegel. Das Staubecken liegt vor uns; ich lasse mein Tier knien, nachdem ich den Treiber wegschickte, der das für mich besorgen wollte. Zuerst vorne herunter auf guttural ch ch ch und einen kleinen Schlag auf das Schulterblatt. Man denkt in einen Abgrund zu sinken und legt sich in den Sattel zurück. Schon folgt das andere Extrem—das Kanapee kippt nach hinten, weil die Hinterhand auch knien soll—, dann folgt eine dritte ausgleichende Bewegung, ein Seufzer des Kamels, und man kann bequem absteigen.
Wir fuhren in einem Boot zum Tempel.
Wir hätten gerade so gut untergehen können; ich glaube, daß die verschlafenen Ruderer Neulinge im Schifferhandwerk waren. Der Führer, fett und unverschämt bis zu diesem Punkte in der Geschichte, begann kleinlaut zu werden. Er wehrte sich aber umsonst gegen die Tatkraft Amerikas. Die Dame bestand darauf, daß dieses Boot und diese Leute heute nacht den Tempel besuchen sollten. Es ging ein ziemlich scharfer Wind, und der Nil war geschwollen.

Aus dem Grab des Menne.
Wir schaukelten auf dem schwarzen Wasser, der Mond kam und ging, und man bemühte sich umsonst um Stimmung.
Der fette Führer sagte kein Wort, er mochte überlegen, ob er nicht diesmal zu viel um den Mammon gewagt hatte.
„Lasse die Ruderer singen“, befahl die Dame aus Amerika.—„Wir hätten niemals dieses Boot besteigen sollen“, war die ungereimte Antwort.
„Wir wollen, daß die Ruderer singen.“
„Also singt“, sagte der fette Führer schaudernd.
Die Leute waren aus dem Schlummer gerissen worden (der Führer hätte wahrlich die Expedition besser vorbereiten können) und zeigten keine große Lust zum Singen. Einer schlug einen Vers vor, der keinen Anklang bei seinen Kameraden fand und fallen gelassen wurde.
„O, wie reizend“, sagte die Amerikanerin, als niemand gesungen hatte.
Der jüngste Ruderer schlug einen Vers mit einem ziemlich eintönigen Kehrreim vor. Die anderen wiederholten ihn öfter als nötig.
„Was heißt das, was sie singen?“ fragte die Dame interessiert. Doch der Führer sah in die schwarzen Wellen. Ihm bangte um sein Leben.
„Frage sie, was sie singen.“
„Sie singen Unsinn, niemand kann sie verstehen“, wehrte er sich.
„Frage sie dennoch!“
Gott, diese Nubier haben doch niemals über den Sinn ihrer Viertaktlieder nachgedacht.—Wenn man sie fragt: „Was ist es, das ihr singt?“, so glauben sie, man fragt, „was ist es, das ihr rudert?“
Sie lachen alle wie die Schulbuben, schauen sich an, und mit hochgezogenen Schultern kichern sie. Es gibt nichts Unangenehmeres diesen Leuten gegenüber, als die Rolle des dummen Fremden zu spielen. Ich muß dabei ganz still sitzen, weil ich nun einmal dazu gehöre.
„Also was singt ihr?“
Ich hoffe, er ist gezwungen, in seiner Antwort eine drastische Übersetzung zu geben, die den Damen Ungelegenheiten bereiten würde. Aber leider passiert gar nichts.
„Wir singen: Unter deinen Strahlen
Mond, Mond, Mond —
Ist es glänzend!
Mond, Mond, Mond.“
Es konnte nicht harmloser sein.
Atmosphäre—mehr nicht; allerdings genug, um mich fortzureißen zu ferneren, höheren Lagen.
Diese Gesänge, sollten sie graphisch ausgedrückt werden, dürfte man nicht in Windungen sondern in horizontal untereinander geordneten Strichen zeichnen. Sie sind wie fernes Echo aus der Musik des Weltalls, die selbst noch in ihren letzten Silben eindringlich beredt bleibt.
Das hochgeschwollene Wasser hebt unser Boot mit feindlicher Gebärde, aber die langgezogenen Töne, die unversehens mit einem bellenden Laut abbrechen, legen sich wie ein schützendes Netz darüber.
Das Schiff erweist sich als viel zu breit für den Eingang zum Tempel.
Von der schönen Front mit der Kampffigur wird keine Notiz genommen; die steifen Göttinnen, deren mädchenhaft schlanker Körper vom Mond liebevoll beschienen wird,—niemand beachtet sie, und sie nehmen sich, weiß Gott, lieblich genug aus über den Quaderfugen hinüber geformt, ihre Körperlichkeit scharf gezeichnet und trotzdem voll von plastisch hingehauchten Unterschieden. Die schlanke Hathor lächelt verzeihend. Sie hat auch solche Damen gekannt und solche Sklaven, wie der Führer einer ist. Sonst gebietet und verbietet er; heute führen die Damen das Szepter.
Ich protestiere dagegen, daß wir einfahren, aber ich werde keiner Antwort gewürdigt. Wir sägen uns mit dem Boot durch den Eingang hindurch und dringen in den Säulenhof, wo es grünschwarz plätschert.—
O Isis und Osiris!—Mozarts Gebet zittert mir in der Kehle.—Mozart—o wer mir jetzt von ihm ein Ständchen brächte oder ein Requiem.—Ein Requiem für mich, dem ich selber lauschen könnte. Ich bin hier begraben. Mich dünkt, es trauert wer um mich. Himmlisch ist dieser Mozart, der mich beweint und mich schwebend erhält. Isis, der süßen trauernden, die unermüdlich ihren meuchlings ermordeten Osiris sucht, sind diese Säulen hier geweiht. Fürwahr, ein harmvolles Frauenschicksal, das Isis beschieden ward. Osiris ist zur Tafel geladen, die ihm zu Ehren sein Bruder Seth veranstaltet. Da zechen zweiundsiebenzig Freunde, und Osiris, der Sonnige, geht lachend auf die Scherze seiner Gastgeber ein. Ja, als sie von ihm fordern, er solle sich in eine Truhe legen, da scheut er sich nicht, anderen gegenüber sich derartig zu verkleinern.— Kaum aber füllen seine Glieder den engen Schrein aus Zedernholz, schon schließt sich die Truhe über ihm zu engstem Grabe, und zweiundsiebzig Freunde eines steinherzigen Bruders tragen den auf ewig versiegelten Sarg bis zu den Ufern des Nils, wo sie die nunmehrige Totenbarke versenken ...
Isis wartete diesen Abend vergebens auf den geliebten Mann ...
Sie muß den grausigen Hergang seiner letzten Stunden vernommen haben, denn von dem Tage an irrt sie den Nil entlang und späht nach dem kostbar eingelegten Sarge. Der aber war längst vom Strom dem Meere zugespült worden. Zuletzt findet sie ihn am Meeresstrand, fern von Ägyptens Küste, nimmt ihn an sich und lebt ein seelenloses Leben an der Seite ihres Toten. Aber ihr Sohn Horus, der zurückgeblieben war, bedurfte ihrer, und so sah sie sich als Mutter gezwungen, dem Lebenden, wenigstens für kurze Zeit, den Toten zu opfern. Sie verbarg ihr Liebstes so gut sie es vermochte und eilte zum jungen Horus.
In dieser Zeit veranstaltete der Schwager eine Wildschweinjagd, wobei das Versteck aufgestöbert wurde, und Seth die eingelegte Truhe, die den Bruder barg, erkannte. Diesmal ließ er den in vierzehn Teilen zerhackten Leichnam in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Aber die unermüdliche, zarte Isis suchte die Teile ihres einstigen Glücks und wo sie welche fand, erbaute sie darüber einen Totentempel. Ihrem Sohne schenkte sie eine kostbare Kraft, den Haß.—Horus zog gegen den ruchlosen Oheim zu Felde und kehrte als Sieger und als König heim. Die Sage erzählt, er habe durch Zauberei den toten Vater zu neuem Leben, als König des Totenreichs erweckt. Im Museum zu Kairo ist eine wunderbar schöne Wiedergabe dieses zum Leben erwachenden Osiris, der flach auf Bauch und Brust liegt und nur das Haupt mit einem verzückten, gottschauenden Lächeln hochhebt. Die Gurgel ist weit gespannt, das Haar staut sich im zurückgebogenen Nacken, der geflochtene Bart allein unterstützt, steif aufgestellt, dieses verklärte Haupt, während sich der armlose Körper an der Erde festgesogen hält.——
Isis als Göttin und Osiris zum Gott erhoben, werden fortan die geliebtesten Beherrscher der ägyptischen Geisterwelt sein—und Osiris wird die spezielle Verpflegung und das Beglücken aller Toten im zweiten Leben anvertraut.
Mir fehlt ein guter Händedruck, und ich sehne mich nach meinem Requiem. Geisterhaft steigen und scheinen die Göttlichen auf der Tempelwand. Wer nur immer so lächeln könnte. Auf den Knien durch die ganze Welt würde ich solchem Lächeln nachziehen, denn es umfaßt das Heiligste, Wahrste, Vollendetste. Es ist nicht etwa eine Rasseneigentümlichkeit, sondern nur ein gewollter Schönheitsausdruck, Schönheit des Beinahelebens, des Halbverklärten, des Wunsches, des fernen Zieles, nicht des Errungenen ... Durch das Vorbauen des Mundes müssen sich stärkere Schatten zeichnen: durch das Verflachen und Verkürzen der Nase muß diese in Licht und Nichts zerfließen: so liegt alle Idee im Munde allein, in ihm, der alle Wahrheit trägt.——
Wir aber scherzen auf unserem Boot.
Ich begreife nicht, weshalb die anderen sich das alles antun.
Nun wird man eine Weile in Betrachtung der Säulen warten;—keineswegs, die Leute am Ruder hatten kaum das Schiff in den Hof gezwängt, als ihnen schon wieder bedeutet ward, denselben durch einen zweiten Ausgang zu verlassen. Ich dachte: „Wann bin ich wieder auf meinem Kamel?“
Die andere Amerikanerin, die bis dahin nur wenig geredet hatte, sagte nun, sie sei von Ägypten sehr enttäuscht: sie hätte gehofft, mehr von den goldenen Gärten Allahs zu sehen!—Das muß ein merkwürdiges Gefühl sein. Ich kenne es nicht, und lasse mich nicht enttäuschen. Zwar, ich finde die Herrlichkeiten dieser Welt oft einem mißratenen Buntdruck gleich: man sieht die schöne Zeichnung,—die Farben aber sind beim Druck einen halben Millimeter über die Konturen gewandert (mehr fehlt in den seltensten Fällen).
Enttäuscht könnte ich allenfalls auf dem Totenbette sein ... Vorher aber nicht.
Um 1½ Uhr war ich wieder im Hotelgarten. Der Mond stand in einem sauber geputzten Himmel. Unsere Kamele haben hoffentlich den wohlverdienten Schlaf gefunden.
Am Nachmittag soll ein Rennen sein von Kamelen, Menschen, Eseln, Pferden. Der Rennplatz ist in der Wüste, die Sonne am Himmel. Was für einen Schatz von Esel habe ich heut unter mir. Er läuft so wie Kubelik Paganini spielt ohne einen Fehltritt—er hält das Tempo ein, das er begonnen hat, ob er bergan oder bergab geht—, ob er scharf wenden oder ausweichen muß.
Er ist eine aufgezogene, mechanische Riesenmaus, und ich könnte auf seinem Rücken Mokka trinken. Ich habe natürlich nie einen Damensattel. Wofür diesen Turm? Es geht das normale Reitgefühl verloren, und es entsteht eine unnatürliche Sicherheit, die verhängnisvoller werden kann, als die Unsicherheit im Herrensattel, die durch gutes Reiten verschwindet. Eine Dame im Damensattel, die nicht wirklich reiten kann, sieht niemals schön aus. Allein wenn die Hände unsachgemäße Bewegungen machen, in engen Handschuhen, Hände, die nicht imstande sind, einen Nagel richtig einzuschlagen oder eine Schale zu halten, Hände, die einen Reitstock wie einen Bleistift tragen und womöglich vor dem Aufsitzen à la Königin Elisabeth in Maria Stuart—Hoftheater,—gebieterisch wippen ... Wer reiten will, bediene sich eines gewöhnlichen Sattels, ohne Hörner und Gabeln; und gar auf einem Esel.
Ich freue mich auf das Rennen. Ramses mit dem Glöckchen soll dabei sein.
Am Rennplatz findet sich eine bunte „Möchtegern- und Kannichtgesellschaft“. Ein paar englische Offiziere repräsentieren den Mut, einige Damen echte Sportsliebe, einige ältere Elemente die Kenner, und dann gibt es ernste, genaue Sachverständige als Richter.

Mumie des großen Ramses.
Kairo, Museum.
Das Pferderennen bestand aus einem Araberschimmel und einem Araberbraunen, die beide vollkommen schön waren und gleich schnell galoppierten. Die Distanz betrug 7,50 m. Spaß beiseite, sehr viel länger war sie nicht! Es wurde dreimal ein totes Rennen gelaufen— bis die Schiedsrichter ein Gymkhana vorschlugen— bei welchem sich sofort herausstellte, daß der eine Reiter das Spiel geübt, der andere es kaum gekannt hatte. Der Schimmel gewann.
Dann liefen sieben Kamele. Alle starteten im Galopp —außer einem einzigen—und man hatte das merkwürdige Gefühl, daß diese Tiere nichts wiegen. Sie haben gar so lange fleischlose Beine.—Ramses wurde zweiter im Trab. Trotz aller Versuche seines Reiters, der durch Kontorsionen und Armeschwenken Galoppsprünge einleiten wollte, mein Ramses tat es nicht.
Bisher war das Publikum freundlich gesinnt, aber nicht hoch gespannt. Da zeigte sich, daß die Veranstalter des Rennens Menschenkenner waren. Eine Truppe schwarzer pudelköpfiger Bischarin-Beduinen gruppierte sich zu Spielen, Tänzen, Hochspringen. Wie Tauben flatterten alle Damen von den Tribünen herab, die Kodaks krachten, die Kautschukbälle zum Belichten sprangen aus den Etuis, und alles stellte die Sucher und Mattscheiben ein.—Die Damen taten ein Bein vor, um mehr Halt zu gewinnen. Der Wind blies ihnen die meterlangen Schleier um die Ohren und schwellte die Sommermäntel von unten herauf. Derweil begannen die Schwarzen einen recht wenig echten Schild-und Speertanz.
Hübsch war ein Spiel, das in folgendem bestand: Ein Mann hebt einen Schild im Augenblick, wo ein anderer ihm gegenüber einen Knüppel so wirft, daß dieser in der Luft durch den Drehschwung Räder schlägt und dröhnend den vorgehaltenen Schild trifft. Kaum sitzt der Knüppel des ersten, schon dreht sich der zweite des Gegners, und die Schläge folgen so rasch, daß man fast gleichzeitig einen Knüppel schwingen sieht beim Anprall des nächsten. Dabei ducken sich die Spieler und schießen in die Höhe, und die Armbewegung, die von oben herab geführt wird, ist vollkommen schön.
Dann kam das Springen zweier ziemlich gleichgewachsener Jünglinge auf einen bestimmten Rhythmus, den die übrigen durch Singen hervorbringen.
Sie sagen in einem gedrückten, fast maschinellen Ton unisono mit tiefen Männerstimmen: Heijayä! Heijayä! Heijayä! Heijayä! Auf das a wird der Akzent gelegt, die anderen beiden Silben sind kaum hörbar. Auf das ja haben die Springer den Höchstpunkt im Springen erreicht; an he stoßen sie sich vom Boden ab. Dabei biegen sie die Knie kaum—bloß anfangs, um sich Schwung zu geben. Nachher glaubt man, sie haben Hartgummisohlen, die sie immer höher springen machen. Der Chor spornt sie durch Beschleunigen und stärkere Betonung an, und—unglaublich—die zwei Springer, die zusammengewachsen scheinen, kommen immer höher hinauf. Unter ihren Sohlen, wenn sie in der Luft sind, erblickt man die Köpfe der rückwärts stehenden Heijayä-Männer. Ich weiß nicht, wie sie so in Schwung kommen können. Sie bewegen nicht einmal die Arme dabei. Und sie wissen wohl selbst, wie unwahrscheinlich sie aussehen, denn sie lachen verschmitzt jedes Mal, das sie höher kommen.
Die Fünfuhr-Nachmittagsonne beleuchtete den Heimritt auf meinem Paganini-Kubelik. Wir ritten durch den Lebensmittelmarkt, wo die schönsten Kornpyramiden sich auf sauber gekehrtem Steinboden auftürmen; schwarzumwickelte Weiber hocken daneben und blicken uns an mit heißgekochten Augen. Wie sinnlos wird das Auge ohne den Mund, den sie mit nervöser Handbewegung vor dem Fremden zu verbergen suchten.
Heute abend wird nichts mehr unternommen. Ich will im Zaubergarten des Hotels spielen wie früher ... ich will Käfer suchen, Erde anrühren und an liebe Dinge denken.
Akazien und Sykomoren, Orangen-und Zitronenbäume, Rosen und Pelargonien, das ist zu viel! Die Akazien haben etwas Fetzenhaftes in der Aufmachung, die Sykomore ist dicht wie Filz und verästet wie unsere Apfelbäume, mondbereit, voller Rauschen ... schon der Name Sykomore ist so schön!—
Die Rosen duften intensiver zu mir herauf,—ich sitze auf meinem Balkon, und im Garten spielt eine Streichkapelle ihre Stücklein; es ist zwar immer nur Stiergefechtsmusik mit Mantillaromantik, aber wenn sie auch noch so schlecht ist, so kann sie doch gut ausgeführt werden: Fremde Rhythmen und gutes Saitenspiel stören mich beim Denken nicht, und ich muß sagen, der Kapellmeister hat Geschmack und Gefühl für Tempi, auch läßt er die Schmarren mit einer Bescheidenheit spielen, die sie liebenswürdiger erscheinen läßt.—
Nein, ich bin ganz glücklich, wenn ein Stück wieder anfängt. Dazu habe ich schwarzen Tee mit einer Zitronenscheibe darin und schwarzes Brot, wie ich es nur in Oberbayern beim Wirt bekomme. Ich bin heute in einer Stimmung, wie der kleine Spitz, der ein Ohr oben und eins schlapp trug; das bedeutete immer bei ihm Seelenfrieden mit Abenteuerlust; eine gefährliche Verbindung.
Ist es erlaubt, nachts Klaviere in den Garten zu stellen? Ich habe das noch nie gesehen. Niemand steht in der Nähe. Alle Gäste baden, putzen sich und sind vor einer guten halben Stunde nicht zu sehen.
Die Sykomore hat endlich ihren Mond, die Bougainvillias, vor lauter Blühen, haben ihre vollen Arme über die Brüstung geworfen, und tagesmüde hängen ihre Purpurdolden an der weißen Mauer.
Jetzt oder nie. Ich gehe zum Klavier—ich weiß,— es hätte die Mondscheinsonate werden müssen, weil die Dekoration dazu schon eingerichtet war—aber es kam die Appassionata—zunächst der dritte Satz, um das Gedächtnis zu prüfen—dann aber, als dieses sich als treu erwies, der herrliche erste Satz und der zweite mit den Variationen und nochmals der sehnsüchtig glänzende dritte.
So etwas glückt einem einmal im Leben—ein Garten—in Mondlicht getaucht, ein einsames Klavier darin und niemand in weitem Umkreis sichtbar. Ich spielte wie im Traum—das Gedächtnis war brav bis zum Schlusse.
Ich erinnere mich, einmal einen merkwürdigen Traum gehabt zu haben: Ich bin auf einem Berg— unten rauscht ein Strom—und der Boden, auf dem ich stehe, ist bedeckt mit feinstem, salzhaltigem Sand. Eine prachtvoll polierte Mahagoniwanne steht da, mit natürlichem, warmem Wasser gefüllt. Ich stoße an die Wanne, und es tönt schön heraus,—da setze ich mich daran—spiele auf dem Wasser die herrlichsten Melodien und wenn ich mit dem Fuß drücke—Pedal— rauscht unten der Strom. Ich denke dabei: „Salz, Wasser, Mahagoni und Radium ist Musik, niemand sagen!“—
Der letzte Akkord vom letzten Presto saß—das Klavier blieb allein im Garten zurück, und ich werde im Speisesaal von überkultivierten Kellnern bedient. Der unsere kennt das Wort Obst nicht mehr: das Leben im Orient hat ihn paradiesische Bezeichnungen gelehrt. Er weiß, daß ich Obst lieber zwischen den Mahlzeiten esse—und sagt jedesmal: „Und die Frucht aufs Zimmer, nicht wahr?“ Er ist Meister im bekannten Kellnergriff—Gabel und Löffel in einer Hand —System Schere—und legt mit großer Sicherheit auf diese Weise die einzelnen Menustationen in meinen Teller; meine Gutmütigkeit, denn ich hasse dieses Vorlegen—ich wähle lieber selbst—und kann unbemerkt nach meinem Geschmack alles mögliche erwischen; ich kann aber nicht einem anderen detailliert sagen—„so“—hier noch diesen gelben Fetzen, noch etwas von dem Grünen, noch ein wenig von da, wo’s so braun ist, überhaupt noch ein Stück ...“ Das sieht noch gefräßiger aus, als es ist. Kurz, meine Gutmütigkeit, dieses dem Kellner zu gestatten, wurde dadurch bestraft, daß er mir ein Paprika-Rahm-Hendel aus beträchtlicher Höhe so in den Teller warf, daß mein Kleid von oben bis unten davon gesprenkelt wurde.—Daß ich das Kleid zum ersten Male anhatte und daß es nicht waschbar und die Farbe und das Material heikel waren, versteht sich von selbst. Abends spielte die Kapelle zu Ehren des Mondes und mit Hilfe des Klaviers Variationen über das Thema: „Au clair de la lune, mon ami Pierrot.“
Also deshalb das Gartenklavier.
Heute früh bekomme ich einen Brief mit der Aufschrift: „An die Dame, die gestern im Garten Klavier gespielt hat.“ „Erlauben Sie mir Ihnen zu danken für die Freude, die Sie mir gestern gemacht. Seit acht Jahren bin ich krank, seit acht Jahren habe ich keine Musik gehört. Die ganze Nacht hatte ich sie im Herzen und in den Ohren. Ich habe sie früher selbst gespielt, aber heute bin ich zu krank, um zu wissen, was es war. Ich wäre Ihnen dankbar, wollten Sie mir den Namen sagen. Dank im voraus. E. St.“
Irgendeine schwachsinnige, extravagante Schwärmerin, hätte ich gedacht, wäre nicht ihre Schrift. Ich finde in diesen gesunden, kräftigen Zügen eine seltene Willensstärke und verfeinerten Geschmack. Die Buchstaben sind wohlgenährt, ohne verwöhnt zu sein. Jeder ist frei, aber voll von innerem Halt, voll Selbstdisziplin. Angenehme Ränder geben dem Brief Übersicht und Ruhe dem Leser. Ich muß wissen, wer mir schreibt, wissen, wen Beethoven glücklich gemacht hat.
Ich lasse mich anmelden.
Ich finde eine Frau von 50 Jahren in einem Bett aus indischer Waschseide und weicher, leichter Wolldecke, eingewickelt in weißen Shetland-Shawl. Auf der Decke ruhen zwei Marmorhände, abgemagerte, sehr schöne Hände und im Kissen ein kluges, krankes Gesicht mit einem der lustigsten Lächeln, das ich je gesehen habe. Ich setze mich an das Bett—und ich weiß, daß einer mit uns da saß—einer, den sie gar nicht fürchtete, sie sprach von ihm, sie sagte: „Sehen Sie, ich bin jetzt 50 Jahre alt, er will mich immer holen, aber trotzdem ich fast keine Lungen habe, lebe ich noch“, und sie freute sich darüber, wie über einen guten Witz. Dann sprachen wir von Beethoven.
Sie hat große Augendeckel und darunter braune Augen, ist lebhaft wie ein Kind, und Humor hat sie wie selten jemand. Sie muß lachen, weil ihr Herz so schlecht ist, und weil ihr Doktor, der sie mühsam hierhergebracht hat, nicht weiß, wie er sie zurückbringen soll, und weil sie, die Lebendige, nichts tun kann—kaum lesen, kaum schreiben—weil ihre großen, braunen Augen nicht mehr scharf sind. Sie lacht so mild und verzeihend für die Beherrscher ihres Schicksals.——
Sie fragt mich: „Wollen Sie die letzte Zeichnung meines Lebens sehen?“

Wandgemälde aus dem Grab des Menne.
„Ja, bitte“—und sie entwickelt einen Bogen Papier, auf den sie einen Jünglingskopf gezeichnet hat, der schmerzlich lächelnd, den Kopf und die Augen gesenkt hält.—Ich war sprachlos über die Feinheit dieser Zeichnung, technisch war sie vollendet, mühelos auf das Zarteste in hundert Tönen modelliert. Es war keine dilettantenhafte Feinheit, kein schwacher Strich, sondern ein gesundes Gewebe von Schatten, ohne den kleinsten Zeichenfehler, und wirklich, der Ausdruck war fesselnd und eigenartig.
„Das ist keine Kopie?“
„Nein! Nein! Das ist eine Bettphantasie, und finden Sie, daß er lächelt? Das wollte ich nämlich machen; ich will nicht, daß er kummervoll aussieht.“
Ich erzähle ihr von meinen Erfahrungen mit Wespen, Käfern, Heuschrecken, Skorpionen, und sie greift wortlos zu einem Buch, worin solche Erlebnisse von einem Franzosen, den niemand kennt, beschrieben werden und das sie, so gut sie kann, mit Interesse liest.
Und noch etwas Merkwürdiges entdecke ich, sie spricht und liest Altgriechisch mit Genuß; erzählt und übersetzt mir ein Wort des Sokrates über den Tod, das so lustig ist, daß ich es hier wiedergeben muß: „Die Schwäne, wenn sie spüren, daß sie sterben müssen, singen am meisten und lautesten vor Freude, daß sie sich bald zu dem Gott begeben werden, dessen Diener sie sind. Die Menschen aber, weil sie sich so sehr vor dem Tode fürchten, verleumden die Schwäne und sagen, daß sie vor Schmerz singen und sich ihres Todes wegen beklagen, und bedenken nicht, daß ein Vogel niemals singt, wenn ihn hungert, friert, oder wenn er in Angst ist ... Auch ich will von diesem Leben in keiner geringeren Geistesverfassung scheiden wie sie.“
Deutsch und Französisch liest sie wie ihre Muttersprache, das Englische—und ist in beiden Literaturen gut bewandert. Sie hat etwas übermenschlich Starkes in ihrem Wesen und ist so ehrlich, einfach, ohne Prüderie, wie kleine Kinder sind. Ich will, solange wir in Assuan sind, täglich sie besuchen. Diese Sterbende ist für mich eine Quelle des Frohsinns—ich fühle ihre Stärke und die meine, und das macht mich elastisch und gesprächig.
Der Zauber dieser älteren Frau hat mich ganz gefangen genommen. Sie hat zu ihrer Pflege und Bedienung eine Kammerjungfer aus der Bretagne, das Bild der Gesundheit, mit Wangen voll Blut und Kraft, und— dem traurigsten Ausdruck vollkommener Hoffnungslosigkeit in allen Zügen, denn sie liebt ihre Herrin ...
Diesen Kontrast der beiden—die Sterbende mit dem heiteren Wesen—die andere gesund und voll tiefer Trauer, hätte nur ein Daumier malerisch festhalten können.
Einmal sagte sie mir, Suffragetten könnte es nur in England geben, wo Tausende von jungen Männern das ganze Jahr durch Sport, Reisen und hauptsächlich durch Kolonien abwesend seien.
Am 6. März nehme ich von ihr Abschied. In Luksor werde ich sie wiedersehen.——
Morgen fahren wir an Bord der „Indiana“ den Nil hinauf.
Es gibt nichts Heißeres als warten. Unser Dampfer ist noch verankert; es wird noch viel geschrien und manches gehißt. Auf Deck wird unbarmherzig geschnattert. Mein Gott, was sind das für Leute: schon eingerichtet in Korbsesseln, und immerfort scheinen sie zu fünft irgend etwas aufzusagen. Auf was wir warten, weiß ich nicht. Nicht daß ich etwa ungeduldig wäre, ich kann Ewigkeiten warten.
Auf einmal taucht ein milchweißes Eselein auf, das auf dem Sand galoppiert, beladen mit vielen Säcken und einem in Seide gehüllten Mann—unserem Führer von Assuan, der es durchgesetzt hat, mit uns zu reisen und der in aller Eile seine sieben Sachen gepackt hat. Ich habe nichts dagegen, denn Murad ist im Gegensatz zu seinen Kollegen bescheiden, schweigsam, natur- und menschenkundig, und gottlob hat er Kunstgeschichte nicht studiert. Er ist eben bloß Führer, ausgezeichneter Reiter wie alle Araber und ein geschickter Reisemanager.
Nun konnten wir die Anker lichten. Das Rad rückwärts fängt an brummend mit dem Nil sich zu balgen —— es entsteht eine 4 m hohe Schaum-Spritz-Gischtmasse, und naturgemäß fallen mir die Verse ein, die jeder deutsche Schüler sich einprägen muß: „Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt.“
Ich weiß nur, daß ich damals „Gischt“ für ein als Reim speziell erfundenes Wort gehalten habe.
„Fräulein, was ist Gischt?“
„Das wissen Sie ganz gut selber.“
Ich habe es nie erfahren.
Die Schaumsäule hinter uns ist nicht übel. Man denkt auch an den Geysir.—Von diesem Wasserfall onduliert der Nil in regelmäßigen, zuerst hohen, harten, dann weichen Wellen, und wir gleiten weiter. Ich kann mir gut denken, daß es den Krokodilen zuletzt ungemütlich geworden ist; früher waren hier welche zu sehen;—zuerst konnten sie von der Dampfschifffahrt denken, hier handle es sich um ein Elementarereignis, wie sie von ihren Urahnen sicher erlebt worden sind. Dann, als sie regelmäßige Fahrpläne dabei beobachten konnten, beschlossen sie, die Wohnung am unteren Nil aufzugeben.
Wie hübsch müßte es sein, in einem kleinen Boot, am großen angekettet, auf den Schaumwellen zu tanzen.
Wie grün und immer undurchsichtig das Wasser bleibt.
Wir passieren unter endlosem Schreien die vielen Schleusen, sind endlich auf dem großen Staubecken und lassen einen Riesenschleusendamm, der eine Brücke von Ufer zu Ufer bildet, hinter uns. Wir sind auf einem See, umschiffen einige Inseln—auch Philae grüße ich noch einmal—und nun ändert die „Indiana“ ihr lärmendes Anfangsstadium—die Reise beginnt allen Ernstes, und ich nehme die bequeme Pose des Orientforschers an, wie sie mir aus Bilderbüchern bekannt ist. Ausgestreckt, ausgebreitet—im Schatten, Buch, Papier und Bleistift bequem erreichbar; Augen halb zu. Aber die fünf neben mir sind mit Aufsagen noch nicht fertig. Das geht genau so hurtig und fröhlich wie vorher! Vier Herren, eine Dame. Ich lege mich ganz zurück und erforsche das Firmament.
140 Störche sehen auf uns herab. Sie kreisen trichterförmig wie in einer Ballettfigur. Die Nahen sehen schwarz, die Fernen grau aus, dann drehen sie sich und die Schwarzen werden heller. Nun aber blendet es mich so sehr, daß ich die Augen schließen muß.
Ha, wie man hungrig wird auf solch einem Dampfer —namentlich wenn meine Nase mit Recht behauptet, daß der italienische Koch risotto al sugo di carne con formaggio vorbereitet.—Dieses himmlische Gericht bekamen wir nachher unter dem Namen Riz à la financière, gefolgt von anderen Speisen mit französischen Courtisanen-und Ministernamen; bei Ritz will ich es mir gefallen lassen. Da ist noch Sinn dabei. Aber hier, wieviel appetitlicher würde es sich ausnehmen, wollte man die Speisen brav beim Namen nennen und auf Garnierungen verzichten.
Unser Speisesaal ist klein und hat Platz für etwa 24 Menschen. Wir sind zum Glück nur die Hälfte. Wir, die vier Redseligen—bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß die Frau 90% des Geredeten selbst übernimmt und daß die Sprache die czechische ist,— eine englische Familie und ein Menschenpaar in den besten Jahren aus Berlin.
Die alte weißhaarige Engländerin sagt eben von sich —sie würde überall für die Königin von Rumänien gehalten. Sie trägt einen schwarzen und darüber einen gewöhnlichen Zwicker, und außerdem hält sie in einer Hand ein Lorgnon mit doppelten Gläsern, die wie zwei offene Flügel rechts und links vom Schildpattgriff stehen. Dieses legt sie mit kindlich unbewußter Geste so auf den Mund, daß rechts und links die zwei Augengläser starren. Lange, lange bleibt sie in dieser sinnigen Pose unter den 8 Gläsern, der Mund öffnet sich unter dem Druck des Schildpattgriffes, und immer noch ruht ihr Blick durch den doppelten Zwicker auf etwas rein Geistigem natürlich, denn sie sieht nichts als Gedanken.—Ihr Mund gleicht jetzt dem Schlitz einer Sparbüchse. Nun schließt sie ihn, und fängt dabei mit den Ecken an.
O diese Mundwinkel,—die man auswindet wie ein Wäschestück, halb Lächeln, halb Sicherheitsschloß, —das einen wertvollen Schrein verschließt. Der Königin dünkt ihr Schrein sicher als der Wertvollste des ganzen Schiffes. Die Mundwinkel sind so rechte Schlupfwinkel für allerlei Bosheit, kleinste Selbstsucht und dümmsten Eigensinn.
Ihren Augen erlaubt die Königin eine jugendfrische Serenität, als hätte ihre Besitzerin das alleinige Monopol für Reinheit, Lebensfreude und Weisheit. Sie hat allerdings Zeit gehabt, für die geringsten Betätigungen ein System anzunehmen. Ich sehe das an der Art, wie sie sich der Sonne und dem Wind, den Kellnern und der Natur gegenüber benimmt. Die fünf Dinge, die sie benötigt, vergißt sie niemals, und sie hat auch entdeckt, wie praktisch es ist, die Hände frei zu haben; dafür nimmt sie, wenn sie damit nicht schreibt, ihren Füllfederhalter (natürlich keinen Bleistift) quer in den Sparbüchsenmund und ordnet herzig-unbewußt ihre Papiere am Tisch.—Sie weiß ganz genau, daß sie wie ein 13 jähriges Schulmädchen aussieht; „das mache ich eben so.“
Sie hat maschinengeschriebene Korrekturbogen vor sich.
Die Wonne!
Wenn ich nur einen einzigen Satz daraus lesen könnte.
Ich bin sicher, sie weiß vom Schiff genau Lee, Backbord, Takelage, Achterdeck, Heck—und schriebe von einer Bö, wenn sie es sich auf dem Nil gestatten dürfte.
Ich kann sehen, wie sie Augenblicke trockenster Unfruchtbarkeit zu erdulden hat. Ihre „mit einem einfachen Achatring geschmückte Rechte“ drückt sie verzweifelt an die Schläfe und späht auf das Ufer.— Ha—da wären sie ja, die malerischen Wassermühlen, Schadufs genannt; da ließe sich so schön sagen, daß schon zu Pharaos Zeit (natürlich im Singular) diese Bewässerung ... Nein, heute wird es nichts. Sie steht auf und begibt sich zu den übrigen Mitgliedern ihrer Truppe. Die Königin, die alle Systeme beherrscht, hat sich für ihren Gang, für ihre Aussprache und für die allgemeine Haltung ein Mittelding zwischen Mutter, Gattin, Junggesellin, Geliebten und unschuldigem Säugling angeeignet. Man sieht, wie stark die übrigen Familienmitglieder von der reichen Größe, der tiefen Lebensweisheit und von der Tatsache der echten Druckbogen beeinflußt sind.
Eine magere, fliegenabwedelnde Nichte schreibt ganz prosaische Ansichtskarten.
„Let me see who it is“, sagt die Tante, denn sie wird ihren Namen—das Autograph—nicht überall hinsetzen.
„Oh yes! of course, I will write too.“
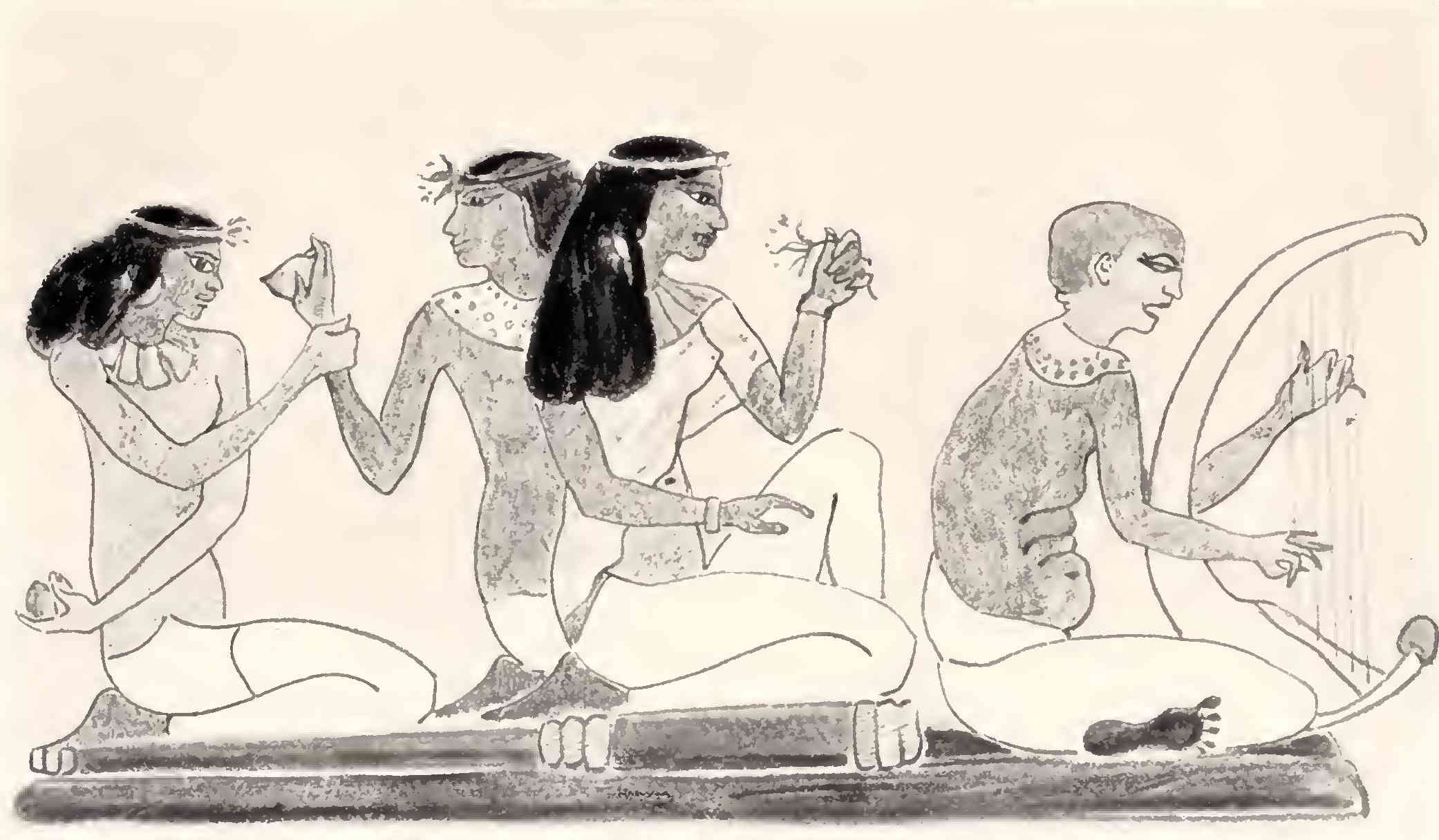
Der blinde Harfenspieler aus dem Grab des Nacht, Theben-Westufer.
Sie schreibt sicher doch von den Wassermühlen oder „auf dem Vater Nil“—oder „unter dem südlichen Kreuz“.
Ich sehe gern unserer nubischen Mannschaft zu, schmalhüftig und flachleibig, dabei breitschultrig sind die Jungen—ihre blutroten Sweater hängen in losen Falten fast bis zum Knie herunter. Die Maschen sind nie gedehnt worden durch das Einzwängen von strammen Brustkörben. Man sieht bei der geringsten Bewegung das Mitarbeiten der Rückenmuskeln, die hervorspringen, das Rückgrat flach dazwischen lassend. Wenn sie sitzen, so wölben sich die Rücken sanft unter dem Maschengewebe. —Leib, Magen und Brust biegen sich genau mit dem Rücken parallel.—Der Pilot bleibt stundenlang am Steuer, auf einem türkisblauen Holzschemel sitzend, ein Bein hoch, den Fuß auf dem Sitz, das andere Bein am Boden. Sein turbanumwickelter Kopf mit den unrasierten weißen Stoppeln ragt in den Himmel, während der Nil in weißgrünen Dreiecken zwischen den Armen und dem Steuerrad schimmert. Die Uferberge, rohseiden und aprikosenfarben, treffen an den Hals und die Schultern, und das Steuerrad legt auf all diese Töne eine scharf abgegrenzte schwarze Form.
Der Rais (Steuermann) trägt ein sehr dunkelblaues Oberkleid auf schwarzweißgestreiftem Untergewand. Er bewegt den Körper nicht—nur seine Hände ergreifen die Messingdornen des Steuerrades. Es ist so etwas schönes, wenn die Hand den Griff fest umschlingt, ihn drehend an sich reißt und träge darauf ruht, bis eine neue Drehung nötig wird. Die Hand vergreift sich nie.
Der Mann entfernt sich nur ungern; wenn er wiederkommt, überläßt ihm sein Ersatzmann hastig den Türkisschemel. Er dominiert die anderen durch sein Schweigen und sein Alter. Er soll der beste Lotse der Gesellschaft sein und den tückischen Nil kennen wie keiner.
Wie ein Film rollt sich langsam unter dem Rhythmus des Schaufelrades die Uferlandschaft ab. Es ist kaum eine Landschaft; nur weißer Sand mit grüner Garnierung, aber nicht immer. Es gibt endlose Strecken, auf denen es dem Nil nicht gelungen ist, seinen kostbaren Lehm abzusetzen, da ist bloß Sand und Stein. Wären nicht die schweren weißen Adler, die sich um irgendwelchen an-und aufgeschwemmten „Leichenschmaus“ malerisch gruppierten oder ab und zu ein langbeiniger, kurzschössiger Wasservogel mit und ohne Kopfschmuck, so hätte man ein Gefühl von ewigem toten Einerlei. In Wirklichkeit aber beherrscht mich ein geheimnisvolles Wissen von „hier wird gelebt; hier wird gewartet“.
Mit der größten Spannung durchforsche ich die Ufer, suche Überraschungen unter den Felsblöcken und kann kaum die Umschiffung eines Nilkaps erwarten. Irgendeine Überraschung gibt es immer, und wenn es bloß die ist, daß wir unerwartet an saftigem Weizen oder fast meterhoher Luzerne vorbeifahren. Man hat nur immer Angst, daß diese köstlichen, mit Dattelbäumen bewachsenen Oasen vom steigenden Wasser verschlungen werden. Ich möchte den Saaten zurufen: „Eilt euch zur Reife, ich kann es euch noch nicht sagen, aber ich weiß etwas Böses vom Nil.“
„For jede durch die Stauwerke valone Palme zahlt der Staat’n Fund,“ höre ich den Berliner seiner Frau erklären, „und ist der Nillauf überall fertig geregelt, so werden wir erst sehen, um wieviel breiter der Streifen fruchtbaren Landes seine Ufer schmücken wird. In absehbarer Zeit müßte er—zu Gold verwandelt—sozusagen dem Staat direkt in die Taschen münden.“
Ein schönes Bild, zumal wenn sich der Goldstrom wiederum über das Land zurückergießen wollte!——
Der kleine Dampfer hat seinen Zauber. Auf der Rückreise von Assuan nach Kairo werden wir seine letzte Heimfahrt für dieses Jahr benützen und—seine einzigen Passagiere sein ... Aber auch heute ist das Leben voller Heimlichkeiten. Ich sitze in meiner engen Kabine. Ich habe ein winziges Fenster mit winzigem Laden, und mein Bett ist wie ein Sarg, bloß sehr weich und sehr lang. Ich habe kein Bett über mir, weiße Wände, weiße Decke und einen Waschtisch, der sich auf allen Seiten öffnet. In dieser Kabine kann ich spielen: „Junges Mädchen im Kämmerlein bei Sonnenaufgang“ oder „Der einsame Dichter im Gasthof zum grünen Walfisch“ (mit einem Felleisen) oder „Schwester Gertraud in der Zelle“.
Merkwürdig, ich spiele nie „Altes Mütterlein am Spinnrad“.
Das Fenster ist zu meiner Linken so angebracht, daß ich, bequem ruhend, die Nilwogen daran vorbeirollen sehe. Mein Zimmer ist ein köstlicher Rahmen, der mich allein in dieses Zauberland trägt und mich von anderen Menschen und Dingen abschließt. Am Kopfende habe ich eine elektrische Milchbirne, die mir meine allabendlichen Lesestunden erhellen wird.
Ein abgehackter Rhythmus schlägt an mein Ohr, immer derselbe bestimmt abgesetzte—zuerst zwei gleiche, dann vier doppelt so schnelle, dann zwei gleiche, dann wieder die vier schnelleren Schläge. Es klingt dumpf und warm—nicht schmetternd. Unten am Kiel sitzt ein 14jähriger nubischer Bursch auf seinen verschränkten Beinen und hält unter dem Arm eine bauchige Tonvase, deren Halsöffnung verstopft,—deren unterster Teil aber durch eine straff gespannte Schafsblase trommelartig ersetzt ist. Auf diese seltsam klingende Trommel schlägt er abwechselnd mit den Händen, deren eisenharte Fingerspitzen, zu einem Büschel vereint, die subtilsten Tonstärken erzielen. Um ihn herum sitzen die Matrosen in ihren losen roten Sweatern und kurzen leinenen blauen Rockhosen, die langen Hälse tragen den lavendelblau umwickelten Kopf, der sich leicht neigt, ohne die feine Linie zum Kinn zu zerstören. —Der Bub schlägt unentwegt seine Trommel weiter und singt dazu in unendlicher Melodie etwas, das sich meiner Vorstellung vom Schrei nach dem Kinde nähert. Auf einmal stehen zwei schlanke Burschen auf—stellen sich in dem kaum 1 m großen Kreis einander gegenüber auf und beginnen, sich nach vorn und rückwärts schwingend, auf den nahe zusammengestellten Sohlen auf und ab zu rutschen. Jede Bewegung kommt haarscharf auf je ¼ Takt.—Wie neugeölte Maschinenteile gehen sie auf dem kleinen Feld hin und her. Von oben sieht es aus, als tanzten sie am Rande eines überschäumenden Champagnerglases,—so schmal sieht der Kiel auf dem Wasser aus. Er schiebt sich leise weiter, und zwei Schaumkämme entspringen seiner Spitze.
Der kleine Musikant, mit zusammengezogenen Brauen, wenn er hoch singen muß, läßt nicht eine Sekunde im Tempo nach—tum, tum, tumtumtumtum, tumtum.
Es wird dunkler, der Nil wird glatter, der Rhythmus weicht keinen Schritt. Wir werfen den Leuten Silberstücke herunter.—Als Dank braust der kleine Trommler in ein Forte, ohne sein Tempo zu verändern. Auf die Endnote der Sechzehntel macht er gern ein marcato und einen staccato-Luftsprung mit der Hand, ehe er liebevoll fast, wieder die zwei achtel Noten anstimmt.
Nun müssen Musikanten und Tänzer zwei Lotsen Platz machen, die mit langen Stangen den Nil sondieren —denn das Wasser ist seichter. Sie biegen ihre Schlangenrücken soweit sie können und pflanzen die Stange ein und beginnen von neuem, wenn sie sich aufgerichtet haben, erst der eine, dann der andere.—Der Kiel rutscht dazwischen.
Der erste Abend auf dem Nil.—Das erste Anlegen. —Wie war dieser Tag kurz.
Die Tempel, die wir besucht haben, sind weit hinter uns und werden sich nach uns für die Cookboote auftun. —Die Eingeborenen werden dieselben Götterlein und Skarabäen, die vielleicht in Cadinen gemacht werden, zum Kaufe anbieten,—die kleinen Nubier werden ihr gespanntes, schwarzes Bäuchlein genau so herausstrecken, wie sie es uns zu Ehren taten, und die Frauen, die sich die Lippen mit Heidelbeeren oder Tinte subkutan färben, werden genau dieselben Lachkrämpfe bekommen, wenn sie die Touristen beim Stolpern über die Steinbrüche beobachten werden, die am Dorf vorbei zum Tempel von Bet el Wali und Kalâbsche führen.
Wir landen vor Dakke—es ist schon tiefdunkel,— in 1½ Stunden soll der Mond aufgehen. Im Nu waren die Pflöcke in den Sand gesteckt und daran die Seile befestigt, die unsere „Indiana“ heute nacht halten müssen.—Die Luft ist lau, der Tempel steht ganz nah in gleicher Richtung wie der Fluß. Wir waten durch den tiefen Sand mit Windlichtern bewaffnet.— Der Tempel ist nicht bedacht, der Sternenhimmel sieht hinein, und die Steine sind noch voll von der Wärme des Tages. Wir besteigen die innere Treppe des Pylons, die uns auf eine schmale, kaum berampte Plattform führt. Ich lege mich gerade unter die Milchstraße und horche.—Der Nil macht keinen Lärm,—hier gibt es auch keine Abendglocken,—ich höre die Sterne knistern und sehe, wie einige von ihnen am Himmel wackeln. Mein Platz ist schmal—die Rampe nicht hoch aber breit—ich blicke in die kohlschwarzen Tempelhallen hinunter ...
Kein Laut,—der tanzende und harfenspielende Gott Bes, offenbar ein Vorläufer König Davids, schweigt ebenso wie alle übrigen Götter, denen Könige opfern. Sie sind die Störung in der Winterzeit gewöhnt—geopfert wird nicht mehr—allenfalls herablassend anerkannt.
Murad erzählt Diebesgeschichten—wie Spitzbuben in eine Moschee gedrungen sind und einen Teppich forttragen wollten, einen ganz kleinen Teppich. Sie waren von einer Engländerin bezahlt gewesen, aber sie seien erwischt worden und die Engländerin aus Ägypten entflohen—und eine andere Geschichte—wie in einer Stadt fast täglich die kostbarsten Sachen aus Moscheen und Privathäusern verschwunden seien, und niemand eine Ahnung gehabt hätte, wer die Diebe sein konnten. Endlich hätte man einen erwischt. Es war ein Gefängnisaufseher, der seine Kameraden nannte, nämlich den Direktor und die übrigen Angestellten.
Im Osten kommen helle Wolken.—Der Nil taucht weißlich aus dem Dunkel hervor. Da fängt es im Turm, gegenüber dem unseren, an zu lachen, zu schmettern —und die czechische Familie mit der Königin von Rumänien taucht oben auf.
„Also bitte, wo ist südliches Kreuz?“
„Aber das sieht man erst um 3 Uhr früh.“
„O jemine, da schlaf ich ja den Schlaf des Gerechten.“ —
„Hier meine Herrschaften, haben sie die Milchstraße. 3000000 Billionen Hektoliter Milch, wenn ich denk, daß die Kühe bloß 8 Liter geben, wenn’s gut geht!!“
„A—geh—die ganze Poesie nimmt er uns!“— und dann kommt es wieder—nejerszimajetotaitamtamhodlotoyetnoekscschnyetnopojwejdlezimnejeczowikladopantojtaktai —— .“
Der Mond soll erst in ¾ Stunden aufgehen—ich erwarte ihn lieber in meiner Kabine. Ich habe das Idiom nun volle 16 Stunden hintereinander hören müssen. Ich weiß nicht, welcher der drei Männer ihr Mann ist. Zuerst glaubte ich, es wäre der, der im Korbstuhl schlief mit unschuldsvollem Kinderausdruck. —Sie schliefen aber der Reihe nach.—Es war schwer festzustellen. Keiner widersprach ihr je, sie hielt ihre Monologe und wurde, ebenfalls der Reihe nach, durch jeden ihrer drei Begleiter mit Beifallsnicken unterstützt.
Solange der Mond nicht scheint, ist das Wasser um die „Indiana“ schwarz wie Tinte, und es schwimmen allerlei kleine Ungeheuer, wie Eierschalen und Bilinerflaschen darauf umher, von der Strömung trotz Widerstrebens sanft hinweg gezogen.
Den Koch höre ich aufatmen—was mit einem O Dio, Dio, Dio, Dio, Dio beginnt. Seine Küche ist eng und heiß. Er erkocht sich stromauf und stromabwärts während der ägyptischen Saison sein Familienleben, das er in Kairo führt. Mit unverkennbarer Genialität versteht er es, den Zauber einer guten Hausmanns-Nudelsuppe mit dem raffinierten einer Mailänder Casserolefleischspeise zu vereinen—und süße Speisen macht er ohne Backpulver, ohne Sirup, ohne Zuckerersatz, ohne Fruchtkonserven, kurz, ohne diese lieblichen Schweinereien, die so unverlockend auf Servietten zittern im Kreise von zweifelhaftem Back-und Klebwerk.
Unangenehm der Hitze und einiger Fliegen wegen waren nur die Stunden von 12 bis 4 Uhr. Ich sage einiger Fliegen; es waren wirklich nicht viele; aber sie waren stark, überlegen in jeder Weise. Es waren dünne Fliegen—sehr wachsame, die nicht in Fallen gehen und sich sehr schwer fangen, geschweige denn erschlagen lassen.
Die Schiffsgesellschaft saß schweifwedelnd da; namentlich zwei Fliegen haben es auf mich abgesehen; sie sind beide nervös—die eine konnte ich zwischen zwei Blättern von „Anna Karenina“ mit einem kräftigen, plötzlichen Ruck zermalmen; die andere fing ich mit der Hand und sperrte sie in eine leere Zündholzschachtel, die ich in Dakke an Land warf, wo Schachtel und Inhalt Liebhaber finden werden.
Aber jetzt gibt es keine Fliegen, jetzt ist alles still und frisch, bloß die Maschine muß noch Licht erzeugen, aber um 11 Uhr ist Polizeistunde, da wird meine Milchbirne sanft entschlummern.—Dann wird der Mond seine Milchscheibe leuchten lassen und durch das Fenster Schwester Gertrauds Stübchen erhellen. Auf dem Nil schläft sich’s wunderbar, und ehe es noch im Osten graut, sitze ich schon an meinem Fenster und schau heraus wie ein Hund aus der Hütte, das Kinn an den Holzrahmen gestützt.—Nur die Augen dürfen sich bewegen. Aber noch ehe die Sonne selbst erscheint, liege ich wieder und träume meinen zweiten Traum; der erste kommt wie er will, den zweiten habe ich in der Hand.
Die „Königin von Rumänien“ sitzt auf Deck und sucht sich aus einer Sammlung des Schiffsdragomans die schönsten Skarabäen aus. Frau Schneebaum stützt sich mit dem kurzen Arm auf die Tischplatte und sammelt auch. Herr Schneebaum gibt ehrlich zu, daß er es nicht versteht.
Antiquitäten, Raritäten, Kunstgegenstände.—
Ich sammle Stiche (etwas altmodisch schon), und ich „Chinesisches“ (reizende Spezifizierung), ich habe die Teppichkrankheit (leider nicht tödlich), ich sammle Poterien (wohin führt das ...), ich sammle Miniaturen (es hat sich noch niemand gefunden, der nur Kolosse sammelt).
Ich möchte die mondänen Sammler und Sammlerinnen der Reihe nach fragen: Wie ist eine Katze? Wie läuft die Linie ihres Rückens? Wie sind ihre Wangen? Wie geht sie? Wo ist sie hoch? Wo ist sie schmal?
Niemand wüßte es! Natürlich!—Pardon, Ihr könnt ja nicht wissen, wie Katzen sind.—Also etwas anderes:
„Beschreibt mir die Blumen, die ich nennen werde —Jeder Salon hat doch Blumen—man hat eben Blumen in der Wohnung—zwar sieht man sie nie an—man hält aber trotzdem darauf—es muß stets die Blume sein, die jetzt als Neuheit gezogen wird. Alte Blumen werden von Damen neu erfunden. Man kann sicher sein, mit der Blume sieht ein Salon etwas gleich. Also, beschreibt mir ein Ding, das sich stündlich in Euren Linsen spiegelt. Das wenigstens müßt Ihr charakterisieren können: Die Rose?“
—Der Duft der Rose ... ihre Farbe ... die Dornen ...—
—Und die Nelke?—
—Der Duft der Nelke und ... ja auch ihre Farbe.—
—Das Maiglöckchen?—
—O, der Duft!—
—Aber müßte man da nicht alle drei miteinander verwechseln? Ihr seht keine speziellen Merkmale! Etwas anderes! Was wißt ihr vom Mistkäfer?—
Alle unisono:—O Pfui!—
—Sonst nichts? wie ist er gebaut? beschreibt mir das! ... wie wachsen seine Schenkel an? Wie ist die Rundung der harten Flügel?
—Das können wir doch nicht wissen. Haben wir etwa Zeit dazu?—
—Nein, heute nicht, aber als ihr Kinder waret— da hättet ihr Zeit gefunden, wenn ihr Interesse gehabt hättet. Die Natur zu bewundern als Kind wäre frühreif, aber sie aufnehmen auf die Platten eures schönen Gehirnapparates—das hättet Ihr gekonnt—, jedes Detail aufnehmen, jede Rundung, das Angewachsene, die Art, wie Teile am Ganzen hängen, das Gefühl für Gewicht—das Gestreifte, Gerillte, Schräge—das Willkürliche, das Systematische, das Harte und vor allem die Reminiszenzen: Natur,—dort: auf der Libelle hast du dem Perlmutter etwas gestohlen—Maikäfer, dein Körperende gleicht meiner Schreibfeder. Maiglöckchen verzeih,—aber du trägst Höschenspitzen,—graublauer Kieselstein—du bist ein Stück Wolkenhimmel,— Fabrikrauch auf dem Abendhimmel, wie ein schwarzes Samtband auf lichter Seide bist du—all das hättet Ihr aufnehmen können.—Aufnehmen,—beherbergen —vermehren—und daran Euch emporkultivieren können.—Statt dessen höre ich Euch sagen: Rauch? Schön?—Pfui!—etwas Häßliches kann nicht schön sein! Ich sage ja nicht: „Riechen Sie den Rauch“ oder „Stellen Sie sich in weißer Toilette darunter“—, sondern—„Sehen Sie sich ihn doch an! Pfui!—was Pfui? Der Mistkäfer ist auch Pfui.—Was müssen denn gerade Sie eine Skarabäensammlung haben?
„Weil die Skarabäen sehr interessant sind.“
„Warum? Sie kennen ja weder die Schriftzeichen noch die Käfer.“
„Aber wenn sie echt sind, sind sie sehr wertvoll.“
„Sie—aber, wenn Sie allein sind, kaufen nur imitierte.“
„Weil ich persönlich sie nicht unterscheiden kann.“
„Weshalb denn kaufen Sie sich nicht einen richtiggehenden Mistkäfer, wo die Imitation ausgeschlossen ist?—“
„Pfui!“
„Pfui über Ihre Skarabäen, ich weiß immer noch nicht, warum Sie welche kaufen.“
„Weil sie sehr hübsch sind.“
„Was ist hübsch daran?“
„Die Farbe“ (der Duft fehlt).
„Aber wegen der Farbe allein könnten Sie sich eine Bohnensammlung anlegen. Es gibt nichts Entzückenderes als Bohnen,—grüne gibt es, gelbe, graue, marmorierte, glasierte, schattierte; sie haben Punkte, sind hübsch geformt, sauber, echt—Sie können sie selbst mit Sicherheit erkennen ... Die imitierten Skarabäen haben auch schöne Farben—weshalb ärgern Sie sich, daß sie falsch sind? Weshalb haben Sie jetzt keine Freude daran? Sie hatten sie doch beim Kaufen. Die Steine sind die gleichen.—Wo ist die Änderung? In Ihrem Bewußtsein und in Ihrem Portemonnaie! Sie haben also nicht mit Liebe und mit der absoluten Sicherheit der Liebe, sondern mit Gedanken und Geld gekauft ... Es ist also ganz in der Ordnung, daß Sie darin, worin Sie gesündigt haben, bestraft wurden. —Sie dürfen gar keine echten Skarabäen haben, da sie weder die echten lebenden, noch die durch die Kunst verklärten, noch die falschen voneinander unterscheiden. Können Sie sich einen Blinden vorstellen, der Stiche sammelt?“
Als wir zum Besuch des Tempels Es-Sebûa anlegten, kamen uns von weitem drei gelbe Hunde zugelaufen, die wie Schakale aussahen. Sie kennen genau die Tage, an denen Schiffe zu erwarten sind, und leben von den milden Gaben, die die Passagiere ihnen spenden. Die Hunde tauchen sogar, wenn es nötig ist.
Es wäre ungerecht für die Tempel von Kalâbsche und Dakke, wollte ich von dem hiesigen mehr berichten, als von jenen, und doppelt ungerecht für den Felsentempel von Kalâbsche, wo ich eine so genußreiche Stunde in Versunkenheit vor den realistischen Tierreliefs verbracht hatte.
Zwei Motive kehren in all den Tempeln wieder: Opfer und Kriege,—also Angst und Mut. Links werden immer die Kämpfe gegen den stumpfnasigen und dicklippigen Feind—rechts gegen Libyer und Syrer mit semitischen Profilen dargestellt. Die opfernden Könige bringen Früchte, Wein, Tiere dar: die Gottheiten sind kalt, doch huldvoll. Die Könige verrichten das Köpfen ihrer Feinde eigenhändig in zwei Griffen: Die Linke packt den Feind beim Schopf—die Rechte schwingt die Keule. Der Rebell hat die Arme gefesselt.
Die Hallen sind bis oben von diesen Reliefs bedeckt. In Es-Sebûa führt eine Sphinxenallee zum Tempel. Sandsteinblöcke von feinen Reliefs geschmückt, die meist gefangene Krieger darstellen, bilden einen Sockel für die Sphinxe. Diese Nichtneger haben einen eigenartig sympathischen, fast europäischen Typus—Knebelbart —feine, langgezogene Adlernasen;—sie knien einer hinter dem anderen und sind fein in Creuxrelief gearbeitet und sehen herrlich aus in der Mittagssonne, die fast farbige Schatten und Lichter schafft.
Nach der heißen Expedition zum Tempel und einer erfolgreichen Jagd am Ufer nach Chamäleonen, die ich aber wieder frei ließ, war mir ein kühles Nilbad höchstes Glück. Rein ist das Wasser nicht, das in die Wanne fließt, aber mild wie Öl.
Abends ½5 Uhr fahren wir an Korosko vorbei. Die Gegend wird farbig, und die Konturen der Berge sind außergewöhnlich schön. Sie sind unbewachsen, aber so bunt im Stein, daß man kein Grün daneben dulden könnte.
Warm und friedlich heiter ist der Frühling hier— der Nil stellenweise schmalgedrückt von hohen, fruchtbaren Böschungen, aus deren Strauchwerk ein letztes Zwitschern und Singen ertönt. Die Vögel sitzen schon vor der Haustüre—gleich ist das Abendlied zu Ende. Die Berge, die wir hinter uns lassen, verschieben sich zu zackigen Gruppen, auf die ein letzter Sonnenstrahl einen fleischfarbigen Schleier legt. Das Wasser hat schon kein Licht mehr, außer dem kalten Widerschein des Osthimmels. Wir fahren durch geschliffene, glatte Flut; unsere Richtung ist so westlich geworden, daß wir genau dem Sonnenuntergang entgegensteuern. Jetzt wird der Nil breit wie ein See. Links erheben sich zwei grünschwarze, merkwürdig symmetrische Hügel mit einem zackigen Felsen in der Mitte. Durch die Spiegelung im Wasser stellen sie ein liegendes Riesencello dar. Ich sehe sogar die Saiten darauf gespannt, da wo das Ufer beginnt, und der Flußrand einen schwarzen Strich bekommt. Das Wasser vor uns ist wie ein Seidenstoff, ein genaues Widerbild des Himmels. Ich sehe schon darin ein paar weiße Sterne. Im Westen stehen noch die Konditorfarben vom gemischten Eis—freilich hatte der Zuckerbäcker wirklich feine Farben gewählt.

Figur auf der Totenbarke.
Kairo, Museum. Rosa Granitsarkophag.
Wie mit einem gespitzten Bleistift zeichnet der Kiel seinen Weg durch den Wasserhimmel, der sich in zwei Schaumlocken scheitelt.
Niemand sagt ein Wort.—Der Rais hat sich immer nicht gerührt. Er macht noch ein Gesicht, als blendete die Sonne. Auf einmal, ganz schnell, wie auf der Bühne, wird es dunkel—wir fahren nicht mehr, wir rüsten zur Nacht. Morgen mittag sind wir in Abu-Simbel.
Der große Ramses sah in den Bergen seines Landes einen Vorwand zu neuen Tempelbauten. Er dachte, die Hälfte des Tempels—die Grund-und Seitenmauern, die Gewölbe, die Pfeiler—steht schon, es muß nur ein wenig ziseliert werden, und wir haben, was wir brauchen. Wir bauen dem Gott Amon von Theben und dem Re Harachte von Heliopolis ein Heiligtum und auch dem großen Ptah von Memphis. —Der Hauptgott dieses Tempels aber ist der Gott-König Ramses.—
Ich glaube, daß der König trotz seiner 63 Regierungsjahre das Ende seines Werkes nicht geschaut hat—, daran muß mehr als ein Menschenleben lang gearbeitet worden sein. Maulwurfartig mußte gewühlt werden, erst ein schmaler Gang, dann eine viereckige Kammer, aber das im unerbittlichen Stein, der sich nur ergibt, wenn er gebrochen wird. Wer hatte den Grundriß im Kopf?—wer überwachte die Arbeit?—wer wußte: „hier dürfen wir nicht weiter brechen, hieraus machen wir einen Pfeiler, der unangetastet den Berg wie bisher zu tragen hat“?—Wer hat bestimmt: „hier außen auf die schräge Bergwand machen wir ein hockendes, sonneanbetendes Regiment von Pavianen“?—Wer hat den schönen Gedanken gehabt, den Tempel gerade der Sonne gegenüber zu öffnen, so daß früh morgens, wenn Nubien noch schläft, die Sonne sich einen Ramses nach dem andern herausholt aus der Bergesfinsternis und ihm liebkosend erst die weichen Wangen, dann die lächelnden Mundwinkel und die Innenwand der Oberlippe erwärmt?
Vier Koloßstatuen des großen Königs mit Geißel und Stab in der Faust stehen gegenüber von abermals vier gleichen Ramses. In dem Gang, den die acht Riesen bilden, denkt niemand mehr an Amon Rē. Das bißchen Opfern, was Ramses in den oberen Reliefen der Rückwände verewigt wissen wollte, hilft dem Gott nicht mehr. Hier ist „Ramses the Great“ selbst Gott.
Der Tempel war zugeweht—ausgewischt, bis in die Tiefe ausgefüllt—dem Berge gleichgemacht. Die lächelnden Könige schliefen unter der Wucht ihrer Kronen im Sand.—Besser konnte es ihnen nicht ergehen. Der reine, bewegliche Sand, der niemals drückte oder verletzte, hat dieses Wunderwerk bis heute geschont.—
Die Nord-und die Südwand, die hinter den großen Pfeilern mit den acht Königsbildern den Tempel innen abschließen, sind wie große Stein-Tapisserien voll rankender Episoden. Der siegreiche langwierige Krieg gegen die Hethiter wird immer wieder selbstbewundernd aufgewärmt; eine große Fläche ist dem Kriegslager gewidmet: Schweifwedelnde Maultiere ruhen zwischen Soldaten und Kriegsvorräten. Gelegentlich prügeln Krieger einen Gefangenen,—Pferde werden gefüttert,—Heerführer kreuzen die Beine, vom Gemetzel ermüdet—ein friedliches Lagerbild. Ein Art Paradeabnahme, bei welcher den Großen die Haufen abgeschnittener Feindesglieder gezeigt werden, findet statt.
Herrlich sind namentlich zwei Gruppen der Südwand: Ramses stemmt sich über gefallene Krieger mit dem Arm gegen einen, weich in die Knie brechenden Libyer und schwingt mit der Rechten den todbringenden Speer. Der Übermannte läßt das Haupt nach rückwärts zwischen die hochgezogenen Schultern sinken— die Linke hängt schlaff herab. Sein rechter Oberarm ist machtlos der ehernen Faust des Siegers preisgegeben. Des Königs Haupt ist jung, knabenhaft: der tiefblauschwarze Rand des Schädels, die lichtgraue, buschig kurzgehaltene Haarmähne, das rötlichbraune Gesicht mit dem fast kindlich geschwungenen fleischfarbigen Kinn—— ich fühle, wie ich die Augen aufreiße und mir einbilde, ich sei ein Kodak ...
Das nächste Relief ist wunderbar. Der junge König, im Kriegswagen stehend, spannt mit Eisenmuskeln einen mächtig gewölbten Bogen. Der Pfeil sieht auf die feindlichen Zinnen einer syrischen Festung. Die Weite des Bogens scheint die ganze Tempelmauer einzunehmen. Unter dem Pfeil duckt sich die Menge atemlos. Die Darmseiten dieses königlichen Bogens verbinden Himmel und Erde; der Körper des Schützen, der den ganzen Druck der Spannung empfangen sollte, steht leicht an den Wagen gelehnt; die gewaltige Hebelkraft geht vom Arm allein aus.
Der Atem steht mir still ob dieser herrlichen Figur des jungen Königsgottes,—strahlend wie ein Erzengel ist er und lieblich wie ein Paris.
Vor dem Tempel sitzen nicht etwa Götter und Göttinnen. —Hier erst recht,—so daß sie bis zur nächsten Nilbiegung leuchten,—sitzen vier Ramseskolosse von 20 m Höhe, und zwischen ihnen und ihren Beinen hocken Prinzen und Prinzessinnen, Gattin und Schwiegermutter der Königin hervor. Sie lehnen sich an den Berg und sitzen auf glatten Thronen, ohne andere Beschäftigung als die des Dominierens durch steinerne Milde. Der Berg verschwindet—der Himmel wird zur Saaldecke, so genau im Maß zum Weltrahmen sind diese Figuren aufgebaut.
Der König, in überschwenglicher Liebe zu seiner Gemahlin, der Königin Nefretere, erbaute in der Nähe seines Amon-Tempels ein Heiligtum zu Ehren der Hathor und Mut. Dieser Felsentempel ist kleiner. Er enthält aber in Bergestiefe ein Paar Reliefs von unbeschreiblicher Anmut: Die Königin mit den zwei Göttinen; die drei Frauen mit runden Köpfen und glatten Frisuren, mit überschlanken, in einem einzigen, dünnsten Kleidungsstück gehüllten Körpern, bewegen sich zueinander. Eine hält die Lotusblume, die andere räuchert matt, ohne bei der Sache zu sein, die dritte wiegt sich zur lieblichsten Gebärde höflicher Hausfrauen, die sich über den Besuch freuen. Diese Reliefs liegen in finsterer Nacht. Ohne Fackel sind sie unsichtbar, wie alle übrigen im großen Tempel.
Es war spät am Nachmittag, als ich zum Schiff zurück mich wandte.—Der Wind blies durchs reife Getreide zwischen Tempel und Fluß: trocken wie Sand, mit einem harten, riesig langen Bart, wie die Fühlhörner eines Hummers, stoßen die Halme aneinander. Die trockenen Bohnenhülsen des nächsten Feldes klappern. Von der Erde steigt ein heißer Atem.—
Es lockt mich gerade da hinein; aus Erdrissen strotzen die Büschel dieses herrlichen Weizens hervor, dessen Blätter merkwürdigerweise noch grün wie glänzende, breite Bänder die gelben Ährenstiele umgeben. Harte, schwarze Käfer treten an die Risse und schreiten darüber, —Eidechsen verschwinden in dem Dschungel; ich sitze im Schatten und möchte ewig dableiben, aber die Wirklichkeit ruft:
Ich höre ein eigenartiges Schnaufen nicht weit von mir—ein Tier. Aber welches? Ein böses oder ein braves? Ein armes, das Angst hat, oder ein glückliches, das bloß schläft?—Klarheit muß sein. Ich folge zwischen den Ähren einem kleinen Weg,—und— finde einen liegenden, weinenden Esel. Die Tränen liefen ihm bis zum Mundwinkel, seine Nüstern waren heiß und blähten sich unter schnellem Herzklopfen.
„Eselchen, du bist mein,—o du armes! Hast du Fieber? Wie liegst du denn?“
Ich sehe, daß er den linken Hinterfuß bis zum Oberschenkel in einem Riß stecken hat, aber so mit dem ganzen Körper darauf liegt, daß er nie allein heraus kann;—zum Stemmen mit dem gefangenen Fuß war dieser zu verdreht. Er hätte es ohne Schmerz nicht tun können; der arme Kerl hatte einen hoffnungslosen Ausdruck über dem ganzen Gesicht. Er glotzte mit hellbraunen Augen vor sich hin, machte Querfalten über der Stirn und zog die Brauen hoch.—Die Erde ringsum war wie hart gefroren und gab mir die schwere Arbeit auf, den Riß so zu erweitern, daß ich mit der Hand den Huf erreichen konnte. Als es soweit war, versuchte ich die Hinterhand zu heben. Aber Esel sind schwer. Ich richtete die Vorderfüße, und da das Eselchen guten Willen hatte, stand es bald, um sich sofort nach dem bösen Riß schnüffelnd umzusehen. Dann nahm ich Abschied vom Grauen, nachdem ich ihn aus dem Weizen geführt hatte.
Um zwölf Uhr des folgenden Tages waren wir in Wadi-Halfa und bestiegen den Nachmittagszug nach Khartum.
Mechtild, du bist in den Tropen.
Aber so schwül wie bei uns vor einem Gewitter ist es hier nicht.
Nein! Aber wir sind im März. Denke dir das einmal im August. Da gibt es Regenzeit.
Ach, laß doch deine blöden Geographiekenntnisse, die stimmen ja nicht. Das Klima ist einfach köstlich. Man hat uns gesagt, die Bahnfahrt sei recht staubig, —ich kann das bestätigen, möchte es aber anders ausdrücken. Ich persönlich fühle mich wie ein heißer Auflauf, auf welchen beständig gelber, körniger Zucker gestäubt wird. Aber die Sitze sind sehr bequem —und schließlich badet man sich beim Ankommen. Ich lasse des Nachts das Fenster offen,—der Wüstensand sickert nämlich fast ebenso stark durch die geschlossenen Scheiben—und drehe den elektrischen Ventilator auf.
Wüste rechts und links,—Wüstenpflanzen in der Nähe der Bahn.—Fata Morgana.—Bleichende Tiergerippe. Der Abend feierlich; und herrlich das plötzliche Hereinbrechen der Nacht.—Die Sterne groß und nah—und unter diesen Eindrücken, als ein Teil derselben, das rhythmische Poltern des Zuges.

Prinz Ra-hotep und seine Frau Nofret.
Kairo, Museum.
Tausend Erinnerungen tauchen ungerufen auf,— während das Auge emsig die Wirklichkeit betrachtet. Ich sehe einen jungen Neger arbeiten, über und über mit Kalkstein bedeckt, als wäre er eine Sandsteinskulptur. Derweil denke ich ohne jeden Zusammenhang, daß in Assuan ein alter Nilmesser etwa 16 m über dem jetzigen Wasserstand sich befindet, und daß an gleicher Stelle Strudellöcher verraten, wie tief der heutige Strom sich eingebettet hat. Welche katastrophalen Umwälzungen mögen seither stattgefunden haben, oder ist die heutige Spiegelhöhe nur der zähen Stetigkeit der Wogen zuzuschreiben? Der Sandsteinneger, mit dem sich meine Phantasie wieder direkt beschäftigt, nachdem sie beim Nilmesser auf den toten Punkt gelangt war, erinnert mich in der Hautfarbe an den Negersklaven Nijinsky, Nijinsky, den Vielumstrittenen. Es ist interessant an den Gesprächen über dieses Phänomen des Linien-Rhythmus die Menschen zu klassifizieren. Schließlich ist ein Kunstwerk doch nur für Künstler bestimmt. Sobald die anderen sich dazu äußern, ist es mir, als ob man vor mir mit einem Stahlmesser auf Porzellan wetzt; es ist zum Zahnwehkriegen. Mir sagte ein Herr unaufgefordert: „Ein Mann dekolletiert sich nicht.“ Das Urteil ist gefällt: Männer dürfen sich nicht „dekolletieren“, das wäre weiblich, und Mädchen dürfen nicht mit gekreuzten Beinen sitzen, das wäre zu frei; was über diese Grenzen hinausgeht, kann nicht mehr schön sein. Ein anderer sagte mir: „Den ‚Geist der Rose‘ hätte nicht Nijinsky, sondern die Karsawina tanzen sollen, denn die Rose ist mehr das Sinnbild für die Frau.“—
Wann werden die Menschen lernen, daß Körperschau und wohltuende Nachäffung eines Rhythmus noch kein Tanz ist; daß aber jede gewollte, vollendete, verlängerte Körperbewegung eine dichterische Sprache für sich redet, die zu einem Hymnus der Schönheit werden kann. Ist es nicht gleichgültig, wer darstellt?
Eine tiefe Begeisterung für die Kunst der Karsawina und Nijinskys können nur Künstlerherzen begreifen und teilen. Gott sei Dank bin ich weit von den kalten, neugierigen, armen, armen Weltmenschen.—
Wir haben soeben ein Kamel überfahren.——
Während ich an die Karsawina dachte, wie herrlich schön sie den Chopin-Walzer tanzte, daß mir die Tränen kamen,—fahren wir an gebleichten Kamelrückgraten und sonstigen Gerippen vorbei—und ich überlege, ob nicht einmal ein soeben zusammengebrochenes Tier daliegen könnte. Da ist es.—Der Zug hält auf freier Bahn,—die Passagiere steigen aus, —unter unserem Wagen zieht man die zermalmten Überreste hervor,—Fellstücke,—schon vom Sande getrocknete Muskelfetzen,—ein langes Bein.—Der Kopf ist vorne an der Lokomotive. Ein Zug von acht ungesattelten Kamelen war auf den Schienen gestanden als der Zug kam.—Armes Kamel: Das ist der Lauf der Welt. Unschuldige werden überfahren, Einsame werden in den Welttrubel gestellt, Stummen und Geizhälsen werden einflußreiche Ämter verliehen, und die Übervollen, Reichen stehen in der Wüste, wo sie ihre Gaben niemals verschenken können.
Von Khartum, wo wir vier Tage blieben, will ich nicht viel erzählen. Esel-und Kamelritte, eine Fahrt auf dem Weißen Nil, die reizende Gastfreundschaft von Slatin Pascha,—die Wunderapotheke des Syriers, der Arzneien, Hühnerpasteten, Brillen, Kodaks, Photographien verkauft und Films entwickelt, Besuche in Omdurmân, eines Negerdorfes und des Gordonkollegs, wo Eingeborene unterrichtet werden, und worin auf einer Weltkarte Ägypten als englische Provinz rosa gemalt war,—das sind meine augenblicklichen Erinnerungen von dem dortigen Aufenthalt.—Wir fuhren wieder mit der staubigen Bahn eines Abends nach Wadi-Halfa und von dort mit einem Regierungsdampfer nach Schelal-Assuan zurück, wo uns die „Indiana“ leer und sauber gewaschen, erwartete. Das ganze Schiff war unser. Man hatte uns schwarzrote, überaus rosenölig süß duftende Rosen hingestellt—und ich hatte wieder das gute Gefühl vom Spitz mit einem aufgestellten und einem schlappen Ohr, vergnügt und abenteuerlustig.— Es war wie ein Märchen. In einer Kabine hingen wir Mäntel und Decken auf. In der nächsten waren etwas Handgepäck und Hüte, in der dritten Sättel und Reitsachen, in der vierten machte ich mich breit—und so ging es weiter. Wie hatten wir es nur mit den fremden Familien ausgehalten, mit Frau Schneebaum, die sich in taubengrauen Glacélederschnürstiefeln den Knöchel verrenkt hatte, mit der „Königin von Rumänien“ und ihren vier Augengläsern,—mit der Czechin, die 72 Stunden lang ohne Heiserkeit böhmisch gesprochen hatte und mit dem armen Schiffsdragoman, der uns abends aus den Koran blödsinnig entstellte Anekdoten vordeklamierte und es uns nie verzeihen konnte, daß wir unseren Murad mitgebracht hatten! Diese süßlichen, schlauen, überlegenen Dragomans, die immer wieder „Ramses the Great offering to Amon-Ra“, und „the Cow Hathor“ zum besten geben, und die „Now come this way“ sagen, wenn man sich die Reliefs besehen will,—sollte man abschaffen können. Mich stört die Gegenwart anderer Elemente in einem gewissen Umkreis, und ich kann diese Gegenwart nie vergessen. Wie soll man aber sagen: „Geh fort, Tropf, ich sehe nichts und kann nichts denken, wenn du da bist.“
Wir fließen mit dem Strom, aber noch schneller als er.
In Komombo ist der Nil zu seicht zum Anlegen. In nächster Nähe freilich war eine Art Fähre; doch verkündete eine weithin lesbare Tafel „Only for Cook & Son“. Unser Kapitän hätte es nie gewagt, sein Schiff an Cooks Spezialfähre zu befestigen.—Die Nubier sprangen wie Hunde ins Wasser, der eine vom Deck, der andere von der Küche herunter,—jeder von wo er gerade stand. Mit nassen Füßen liefen sie die Sandböschung hinauf, ohne in dem Rollsand einzusinken, der ihnen sandalenartig an den Sohlen klebte, und legten das Schiff mit Stricken fest. Aus Brettern wurde ein kleiner Steg hergestellt. Uns arme hinfällige, spleenige Europäer packten die Nubier hilfbereit unter die Schulter am Oberarm, und viel schneller als ich es wünschte, wurde ich die Böschung hinauf befördert. Man hat keine Zeit zur Selbstständigkeit. Ich werde schließlich so abhängig von der Bemutterung, daß ich in ein Loch taumle, was ich sonst nie getan hätte, bloß weil mich Murad nicht davor gewarnt hatte. Auch bedaure ich lebhaft vorn auf den Mantel getreten zu sein, aber ich konnte mit meinem emporgestützten Arme nichts tun—und wenn ich was sagte, verstanden die Nubier immer nur „die Dame will noch schneller hinauf“.
Oben empfängt mich ein starker Duft von Schlüsselblumen. Das fehlt gerade noch, daß mich meine Kindheit bis nach Komombo verfolgt ...
Die Nase in einen frischen Primelstrauß hineinstecken und spielen, daß es Aprikosen sind—und umgekehrt, eine handvoll sonnenwarmer Aprikosen als Primeln beriechen ...
Ich mache die Augen zu, atme ein—, aber natürlich kommt der Führer und fragt, ob ich nicht müde sei. Kann ich mich entschuldigend zu ihm wenden und sagen: „Nein, Kamel, bloß riecht es so gut!“ Das ging nicht, meine Kindheit gehört mir—, schon sehe ich die Nubier und Araber, wie sie sich erzählen: „Sie riecht was.“ So sagte ich auf Deutsch, aber sehr höflich und sorglos im Ton: „Geh weg und frag nicht so dumm.“ Der Duft kam von einem blühenden Feld mit Bohnen oder windenartigen Pflanzen. Eine alte Sykomore gab Schatten und darunter lagen, standen, schliefen Esel und braune Buben. Ich sah auch ein feines lichtgraues mikroskopisches Eselchen, dem ein sonnenbeschienener, weißer Flaum am Bauch und aus den Ohren stand, das mich mit strahlenden, von ganz neuen langen Wimpern umsteckten Augen ansah. Die Hufe waren aus poliertem Horn, im übrigen sah das Tier wie ein Osterhase aus.—Ich hatte eine Versuchung, der ich immer unter dem Drucke der Araber und Nubierphantasie „Verrückte Europäer“ heldenhaft widerstand. Aber dann—und das will ich gleich erzählen.—
Als ich vom Tempel zurückkam, wurde ich schwach. Also ich tat einen Arm um des Eseleins Brust, den anderen unter seinen Baby-Schweif, hob es auf—und trug es, daß ihm alle viere wie ein Bündel in meinem Schoß hingen, und wollte mich mit ihm irgendwo hinsetzen. Aber, da kam seine große, glänzende braune Mutter, sanft, ganz sanft angaloppiert.—Schnell konnte sie nicht, weil ihr beide Vorderfüße eng zusammengebunden waren und gleich bekam sie für ihr Herkommen vom Buben Stockschläge, schräg über die Rippen, weil ich, wie er glaubte, die ich sicher für mein Vergnügen Backschisch geschenkt hätte, nun wegen der bösen Eselin keines geben würde. Ich stellte sofort meine süße Last vorsichtig auf den Boden zur Mutter, die es beroch, um zu wissen, mit welchen Giften ich es angefaßt hatte.—Armes, seidenes, flaumiges Eselchen.—Ich konnte sein kleines Herz unter den schlanken Rippen spüren, die recht bald sich unter täglichen Lasten krümmen würden.—Sein neugeborenes Hasenfell noch einmal liebkosend, ging ich zum Schiff zurück.
Der Tempel wirkt durch das Riesenhafte seiner Säulen, die wie Märtyrer der grausamen Welt preisgegeben sind. Zwischen den Teilen dieses zerfetzten Baues ist alles so trocken und tot wie in einem vergessenen Schrein.—Der blaue Himmel reißt unwahrscheinlich geformte Zwischenräume hinein und stellt sich darin als Hintergrund auf. Die Säulen erbreitern sich oben zu riesenhaften Tellern, auf welchen steinerne Träger zwecklos, da sie nichts mehr verbinden, ruhen. Die Träger zeigen eine polychrome Unterseite, deren harmonische Tönung den Himmel noch kälter und endloser erscheinen läßt. An einigen wenigen Figuren erfreuen mich Farbenkombinationen, wie von alten Japanholzdrucken: orangenfarbige Haare, grünlichbläuliche Gesichter, pfirsichrosa Gewänder, schwarze Randornamente. In einem Seitengelasse liegen nicht allzugut duftende Krokodilmumien übereinander, den Rachen wohlverschlossen, mit spitzen Zähnen besteckt, einen oben, einen unten, die Schnauzen kurz vor Schluß zu einem Höcker erhoben,—die vier Pfoten als untätige Flossen an den Leib gedrückt.
Kaum sind wir auf dem Wasser, schon ist die glühende Hitze, die da oben zittert, gemildert. Der große Ptolemäertempel aber brennt und schweigt auf seinem Hügel weiter.—Wir verlassen Komombo; ich finde im Bade im braunen Nilwasser köstlichste Erfrischung, und dann sitze ich auf Deck im Korbstuhl.

Deckel zu König Ech-en-Atons Canope (Eingeweidebehälter).
Alabaster. Kairo, Museum.
Wir fahren an Felsenufern und Bergen vorbei, wollen noch heute abend Edfu erreichen, müssen aber seichte, gefährliche Stellen passieren, für die man gutes Licht braucht, um nicht stecken zu bleiben.
Wir haben Edfu heute nicht mehr erreicht. Acht Kilometer davon entfernt müssen wir anlegen.
Ich stehe auf dem Gebiete des Sonnengottes Horus mit dem Falkengesicht. Wir irren längere Zeit zwischen Säulen, Trümmern und Steinplatten, ich weiß nicht, was uns heute an Eindrücken bevorsteht, aber ich ahne, daß meine Frische und mein Bedürfnis nach Schönheit belohnt werden. Ich fühle mich so stark, daß ich Unmögliches leisten könnte; z. B. stundenlang bewegungslos an gleichem Fleck in der Sonne stehen,—wie ein Pferd einen Wagen ziehen, ich würde auf jeden Wink des Kutschers achten,—ich spüre in mir eine außergewöhnliche Fähigkeit, schwierige Probleme zu lösen.
Ich gehe in Gedanken,—die Augen auf den rauhen Kies gesenkt, aus welchem persisch-blaue Emailbrösel mir entgegenleuchten, die ich natürlich aufhebe; bemerke, daß ich durch einen kalten, schattigen Ort dringe, und übersehe mit einemmal einen weiten Hof, der mit Steinfliesen gepflastert, von Säulen und dahinter von massiven Mauern auf vier Seiten abgeschlossen ist.
Vor mir steht der große Vogel von Edfu, Gott Horus, als riesiger Falke. Er steht am Eingang zum eigentlichen Tempel auf einem für ihn genau gebauten Untersims.
Der Hof liegt noch im Schatten,—der Falke reicht schon in die Region der Sonnenbestrahlung. Seine weiche Vogelbrust scheint zu schwellen, so dicht und aufgeblasen stehen die Daunenfedern, aber in Wirklichkeit ist da nur Stein, glatter schwarzer Granit, ohne die leiseste Andeutung einer Feder; darüber liegen die harten Flügel mit einem tiefen Schatten längs der zarten Brust.—Aus dem flachen Falkenkopf blicken starr und ewig wachsam zwei Augen, deren Deckel demnächst klappen werden, so stark sind sie jetzt aufgerissen. Der Schnabel, hart, scharf, leicht gebogen, mit einem wangenartigen Schatten an den Mundwinkeln, steht fast horizontal, so stolz hält der Falkengott sein Haupt.
Er ist nicht in Ruhe mit niedergetanem Körper und hängenden Flügeln dargestellt, sondern so wie Raubvögel, wenn sie auf Wache stehen und bald aufsteigen werden,—der Körper ist schlanker geworden, der Leib ist über den Ständern eingezogen, man sieht viel von den kurzen Flaumhosen, die Flügel sind über dem Schweif wie zwei Nadeln gefaltet, die Schultern hängen, damit der Hals sich besser recken kann, aber gerade da stellt er einen lockeren Kragen auf, so daß die Schädellinie kaum merklich in die herrlich geschwungene Rückenlinie einfließt. Und dann ist es mir, als hebe er die Schultern und schlösse die Augen in unsagbarer Verachtung.
Ich gehe nun von ihm in seinen Tempel—und meine, in einem lianenlosen Urwald zu stehen. Die Stämme alter Riesen, die ins Dunkle hinaufstarren, sind Säule an Säule, rechts, links und vor mir in perspektivischer Verjüngung. Rundungen stoßen auf Flächen, Ecken fließen in Bögen, und je weiter ich vordringe, desto dunkler wird es und desto kühler. Aller Raum ist ausgefüllt, nirgends eine brachliegende Fläche; diesen Luxus hatte man sich draußen im Hof geleistet,—hier aber, wo die Hallen zum Allerheiligsten führen, dürfen sie nur dienen und dürfen weder Raum noch Zeit verlieren. —Die dicken Säulen sitzen wie Pilze auf den runden Sockeln. In ihrem Wuchs zeigen sie nirgends einen Augenblick Beständigkeit der Linie; gleich unten fangen sie zu schwellen an, so daß man glauben könnte, die Sockel berühren eine Kugel.—Dann runden sie sich bis zur Mitte, wo die Verjüngung beginnt, und ohne zu knausern gebären sie ihr herrliches, weithin ausstrahlendes Blattkapitäl, das wie eine Feuerwerksfigur aus dem Zentrum leicht herabhängt, aber in dieser beginnenden Bewegung steif gefrieren mußte; kaum haben sie den Rand in zartester Dünne gebildet, schon sterben sie und tausend Hände legen ihnen den letzten Tragequader auf, und die glatte Wucht der Decke ruht auf ihrem Leib. Die Säulen bilden keine Alleen, sie stehen nach jeder Richtung in regelmäßigen Abständen, da wo ihre Stützkraft nötig erscheint, ein Urwald, dessen Grundriß wie ein großes Sieb aussehen müßte.
Der letzte Raum ist eingerahmt in dem Abschlußtor des vorletzten, und dieser im nächsten und so erweitern sich perspektivisch die Tempelkammern bis zu mir. Vor der letzten sieht man den Altar, der an Größe sich schön an die Linien der ihn umgebenden Räume anpaßt. Ich dringe langsam bis ins Allerheiligste vor, wo mir ein Altar aus rosapoliertem Granit entgegenleuchtet. Dieser ist von eingemeißelten Hieroglyphen bedeckt, die, wenn man nicht nahe daran steht, kaum von der glatten Fläche zu unterscheiden wären.
Welch bewunderswerter Arbeiter hat hier in schöner Handwerkersausdauer sich selbst verleugnet: das erste Zeichen, das ihm gut genug dünkt, damit er sich mit dem nächsten beschäftigte, konnte noch unmöglich auf diesem gefleckten, schwarzrosa Stein sichtbar sein. Wie war ihm zumute, als die Rauhigkeit der unbearbeiteten Flächen sich kaum von derjenigen der eingravierten Figuren unterschied?
Den Steinarbeiter wird es kaum entmutigt haben, —aber da die große, wannenartig ausgehöhlte Platte ganz mit den Geheimzeichen beschrieben war, und diese nun in matt und schwarz, wie eine kräftige Zeichnung auf der polierten, lichtfangenden Fläche wirkten, welches waren dann seine Gefühle? Dachte er, was für ein unfehlbarer Handwerker er sei,—oder fühlte er sich als Künstler?
Nun gehe ich wieder zur Mitte des urgewaltigen Baues. Mir ist, als kämen die Säulen ganz dicht zu mir heran, während im Hintergrund noch immer der Stein des Allerheiligsten in der zweifelhaften Beleuchtung herüberblinkt. Ich verliere mich in den vielen Kapellen, die den Mittelbau umgeben. An den Mauern sind Tausende von jugendlichen Körpern flach gemeißelt, die nur zwei Bewegungen zu kennen scheinen, eine bejahende und eine verneinende.—Sie wehren ab,— sie empfangen,—sie schreiten erwartungsvoll vor,— sie ziehen sich dienend zurück,—sie scheinen alle zu opfern, zu lieben, zu huldigen, sich zu freuen.
Mein Schatten, den das Licht auf die Fläche wirft, hebt und senkt sich darauf wie ein schwarzes Tuch, und meine Schritte—ich suche sie zu dämpfen—sind das einzig Lebendige in diesem Schattenreich. Hier verspüre ich eine gesunde Wut gegen die ersten Christen, die in diesen Kinderkörpern eine Beleidigung ihrer vermeintlichen Reinheit sahen und nun ziellos auf das Roheste die Figuren übermeißelten, zerstörten.—Es riecht hier wieder nach Fledermäusen, die zu Tausenden nisten, wie im Krokodilgrab von Komombo, wo ich mir absichtlich einbildete, weil es mir so besser gefiel, der Geruch käme von den Krokodilmumien.
Treppenverließe, Kammern, Plattformen fügen sich an einander. Ich muß da überall herumkriechen und fühle mich wohl im Reich des Gottes Horus. Ich muß mich wieder zu seinen Falkenfüßen setzen. Mein Gott, wie er das Auge rollt. Gleich knackt er mit dem Schnabel. Wie schön er die schwere Krone trägt. Ich sitze so nah bei ihm, daß die Tempelmauern und die Säulen klein aussehen. Wenn ich nur wüßte, was mich daran so fesselt. Es ist wohl der Fluß der Linien, die in diesen Dimensionen entweder blödsinnig leer oder geheimnisvoll schönheitsbedeutend sein können. Wie die Kurven von großen lateinischen Buchstaben schmiegen sich die wenigen Formen aneinander. Das Stilisierte ist doch so charakteristisch falkenhaft, daß man es nicht einmal zuerst bemerkt. Dann sind Vereinfachungen angebracht, die mich besonders freuen, weil sie meiner Sehweise in der Natur entsprechen, z. B. führt die Wangenlinie zu den Schopffedern und zum Flügel, ohne abzusetzen. Wie die Stirne sich über dem Schnabelansatz runzelt und zugleich den Augenbogen bildet, ist gut gesehen. Ich möchte, unsere Bildhauer versuchten sich an einer solchen kolossalen Tierfigur. Die meisten würden versagen und kaum dieses lebendige Mittelding zwischen Realistischem und Monumentalem treffen.
Ich mache einen Rundgang durch den äußeren Bau, der wie ein Riesenährenfeld, das ein Seil zusammenhielte, gewachsen ist; das Seil wäre so straff gespannt, daß die Halme schräg stehen,—nur ihre Ähren dürften sie nach außen hängen lassen. Wie fest sieht das Breite, Wuchtige der ersten, unteren Steinreihe aus; an den Ecken laufen die halbrunden Randleisten, die oben vor der Hohlkehle die Rolle eines bindenden Seiles spielen. So sieht die mächtige Wand wie eine sauber ausgeführte Frauenhandarbeit aus, deren Saum alle Fäden gefangen hält. Schön kommen viermal aus der Wand nach außen die großen Wasserspeier heraus, deren Profile sich in Löwen verwandeln. Die runden Ohren sind zart auf den kühn geschwungenen Schädel aufgesetzt. Die Vordertatzen bilden den Schluß des Quaders, der selber auf einem geringeren sich stützt. Ringsherum ist die glatte Fläche der liebevoll bearbeiteten Mauerfelsen, die alle ein Maß und eine Farbe haben.
Lauter aufsteigende Linien; ich werde wider Willen nach oben gerissen; irgendwie muß ich die Horizontale schaffen, und—— gedenke derjenigen Menschentypen, die meiner Seele am zuwidersten: das ergibt eine breit auslaufende Fläche in dem hohen Tempel. Wem füge ich ein Leid zu? Ich lächle sogar, denn auch der Haß wurzelt im Zartgefühl.
Statt in diesen Mauern zu opfern, zu verherrlichen, wie ich es nur zu gerne wollte, lasse ich einmal dem gegenteiligen Bedürfnis die Oberhand, was fast immer außerordentlich erfrischt.
Der Tempel ist zwar kaum viel älter als 2000 Jahre, also strenggenommen schon eine lebenslose, hundertmalige Wiederholung übernommener Formen, allein, er überzeugt; und wenn man von ihm Abschied nimmt, empfindet man, daß der Stärkere zurückbleibt, und schleicht beinahe beschämt von dannen.
Wir schwimmen wieder. Ich versuche alle unsere Räume als Aufenthaltsort. Im Speisezimmer ist es gar nicht übel; so muß es bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen ausgesehen haben.—Überall lassen sich Miniaturläden schieben. Die Sonne und ich, wir wetteifern miteinander, wer den anderen überlisten kann. Ich kenne sie aber so genau, daß ich ihr immer den Laden vor der Nase zumache, so daß sie nie hereinbrennen kann. Ich habe ein Tintenfaß und die Schiffsbibliothek, bestehend aus gerade zwölf Büchern, worunter die „Hosen des Herrn von Bredow“, die ich nie lesen werde und auch diesmal nicht, wo es mir so leicht wäre.—Das Buch mag seine guten Seiten haben, aber über die Geschmacklosigkeit des Titels komme ich nicht hinweg.
Wir rutschen schief über eine Biegung des Nils, und hinter uns rollt er in Strudeln und versucht wieder ins Gleichgewicht zu kommen.—Für die Matrosen gibt es gar nichts zu tun. Sie lehnen am Gitter und stehen auf einem Bein, auf nackter Sohle, die man kalt und trocken wähnt, wie die Füße von Schwimmvögeln.
Untertags bin ich nie in meiner Kabine. Hinter dem Speisezimmer ist eine Art Veranda, wo ich gerne sitze, weil man sehr nah am Wasser ist, namentlich wenn man sich, wie ich es tue, auf Kissen auf den Boden legt, mit einem großen Kissen als Schreibpult auf dem Magen. Man denkt das unzusammenhängendste Zeug in die Wolken und in die Fluten hinein, aber ganz echtes, bestes, wahrstes;—bloß nicht niederschreiben müssen; das sollen die Wolken und die Wogen mitnehmen—und mir wiederbringen, wenn ich 2000 km nördlicher aus deutscher Heimat sie darnach fragen werde.
Braune Buben und schwarzes Vieh liegen im Wasser. Von den Kühen sieht man nur den zurückgelegten Kopf. Sie seufzen vor Wonne über die Kühle und wiederkauen in dumpfer Seligkeit.
Heute ist es so windstill, daß sich beide Ufer spiegeln zum Entzücken der Maler, die dadurch zu einem doppelten Vergnügen kommen. Wir begegnen großen, gefüllten Cookdampfern, worin immer ein Künstler mit Staffelei und Zuschauern einen kleinen Kreis bildet. Diese Dampfer sehen gut aus. Es ist durchaus übertrieben, wenn phantasielose Menschen die Augen verdrehen und die Zeiten der Segeldahabijen zurückwünschen, die ihrem poesiearmen Gemüt eine gewisse Garantie für ein poesievolles Erlebnis bieten.—Freilich, das Leben auf solchem Dampfboot mag manchen verdrießen. Man bekommt allmählich Kellner, Manager, Hotelküche, Fremdengejauchze, Engländerdiktatur, Deutschengebrülle satt, aber andrerseits kann man sich gerade sehr schön auf diesen Dampfern isolieren, ohne den Druck der Umgebung und der Tageseinteilung unangenehm zu empfinden. Sie sehen schön aus, lang, breit und flach,—zwei-bis dreistöckig mit ihren kurzen Schloten, ihrer Weiße; und dann haben sie eine Tendenz in der Form, sich wie ein alter Gummischuh rückwärts und vorn in ihrer Rundung zu heben, was ihnen etwas Lustiges, Zufriedenes verleiht.
Der Nil wird seicht. Wir kommen an gefährliche Stellen. Wir fahren ziemlich langsam. Zwei Nubier stehen nun links und rechts am Kiele und legen sich auf die Stangen. Noch ist das Wasser so tief, daß ich nicht darin stehen könnte, aber das beweist nichts. Plötzlich könnten wir auf eine Sandbank stoßen, und wer weiß, wie viele Stunden der Dampfer seine kleinen Schaufeln nutzlos Schaum schlagen lassen müßte.
Nachmittags hielten wir in Esne, um dort den Tempel des widderköpfigen Gottes Chnum zu besuchen.
Für drei Menschen standen acht Esel gesattelt, jeder Eseltreiber wollte den seinen erwählt sehen. Die Esel wurden gezerrt, gestoßen, jeder suchte die Menge der Zuschauer zu vertreiben, um dann seinen Esel besser zeigen zu können, aber noch ehe es zum Zeigen kam, hatte schon ein anderer den freien Raum benutzt, um seinen Esel hinzustellen. Die Wut und die Ohnmacht zu einem Resultat zu kommen steigerten sich sichtbar. Schließlich hatten wir uns selbst drei Esel gewählt, während sich drei Buben wie Schlangen ineinander verknäuelten, sich schlugen und weinten. Wir waren längst aufgesessen, noch balgten sie sich, bis der Kadi dazukam, der wahllos mit pfeifenden Hieben abwechselnd drei Rücken versah. Einer lief mit seinem hinterher zottelnden Esel davon, der andere weinte laut, obwohl seine Stimme schon mutiert hatte. Es waren echte, heiße Spritztränen des Zornes über erlittenes Unrecht; der dritte machte ein verbissenes Gesicht und drückte sich racheschnaubend: Der Feigling, der Held, der Feind. Es müssen immer solche Kräfte aneinanderkommen, damit es ein Stück gibt. Das Schönste aber war, daß der Weinende jäh bemerkte, daß ich auf seinem Esel saß;—wie sich nun die Zornes-und Kummertränen in Freude—- ja Schadenfreudetränen verwandelten, das war eine kostbare Szene. Wie wird sich nun der Feigling ärgern und was wird der Feind sich ausdenken, um den Helden zu Fall zu bringen oder mich, um ihn zu blamieren.
Wir haben nur einige Minuten zum Tempel hin.
Wir sind ganz nah davor, die Menge hatte sich verlaufen. Am Eingang angelehnt steht der Feigling, lächelnd seinen frischen Esel zur Rückreise anbietend. Also ein Komiker, denn Hin-und Rückweg zusammen konnten in einer Viertelstunde zurückgelegt werden. Der Tempel steckt unter der Stadt Esne. Nur die Vorhalle ist freigelegt. Was muß da noch an Schönheiten unter den Häusern der heutigen Bewohner liegen. Man müßte die ganze Stadt abbrechen für die Freilegung des Tempels, dessen vielversprechende Vorhalle Erinnerungen an die römischen Kaiser enthält.—Er stammt aus der Ptolemäerzeit.
Wir sind per Esel am Ufer entlang geritten, während unser Schiff die Schleusen passierte.—Wir wollen mit unserer „Indiana“ Luksor heute noch erreichen, was kaum gelingen wird.
Das linke Ufer ist mit nicht geölten Pumpen zur Bewässerung des sehr fruchtbaren, palmenreichen Landes übersät. Wie große Insekten ihre Fühlhörner, so richten sie die Stangen, die den Eimer emporheben, in die Höhe, und rotbraune Männer, denen die englische Kultur Ärmel und Röcke verlieh, die aber für gewöhnlich einen Turban und allenfalls ein Schurzfell tragen, bedienen die schreienden Insekten. Der Gewichtsstein, der durch Herabdrücken den gefüllten Ledereimer emporheben soll, muß wieder heraufgezogen werden, während der Mann sich mit dem leeren Eimer bückt. Da sieht man jeden Rückenmuskel einzeln vorspringen, bis der Eimer den Wasserspiegel ganz durchfurcht, und das kostbare Lebenswasser dem nächsten, auf halber Höhe angebrachten kleinen Trog zugeführt hat, worin es ein zweiter Bronzemensch einem dritten, letzten verschafft. So steigt der Nil mit Menschenhand seine Böschung hinauf, um oben lustig in Kanälen weiten Feldern zuzufließen. Die mühevolle Arbeit wird kilometerlang an der Böschung so weiter geleistet. Hier ist die Herzarbeit des Landes, jeder Pulsschlag der Insekten sendet dem Boden dieses Ufers seine Lebensflut. Alle Männer scheinen dabei mitverwendet zu werden; die Stangen, die auf-und absteigen, schreien, lachen, ächzen, singen wie freigelassene Schulkinder, deren Gekreisch aus der Ferne herüberklingt—die Musik des Nils. Ernster klingen die Mühlen, an welchen Ochsen oder Kamele eine Ellipse von aneinandergeketteten Tonvasen kreisen lassen, wie alte Weiber ihre Rosenkränze. Dieser Vasenkranz nimmt oft unwahrscheinliche Dimensionen an, wenn die Böschung besonders hoch ist. Der unterste Teil der von Schlamm, Wasser und Moos triefenden Töpfe taucht ganz unter und bringt bis zur Höhe des Trogs in einigen Sekunden wohl fünfzig bis achtzig Liter herauf,—eine schwere Arbeit für die braven Tiere, die stundenlang das gezackte Holzrad drehen.
Diese Musik ist auch entsprechend traurig,—ein langer nicht endender Ton, tiefer Schmerz, ewiges Verkanntsein; ich höre oft einen Dreiklang von seltener Farbe a, c, d, es,—ad infinitum.
Da wo wir jetzt sind, kann man die Schöpfmühlen kaum mehr zählen. Die Musik ist wild, lustig geworden. Alle schreien durcheinander, jetzt singen sie Koloraturläufe, gehetzte, schattenhafte, auf noch nie gehörten Untergrundtönen, eine Traummusik. Manchmal lacht die Koloraturstimme, und ich bin beruhigt. Dann merke ich, daß sie über großen Schmerz gelacht hat, denn der Schluß ist bitter traurig, gequält—und ehe ich mich auskenne, ist sie wieder bereit zu lachen, —und unter dieser Koloratur, die lachende Felder und Menschenleben bedeutet, beugen sich ernst, in steinerner Gleichgültigkeit, Männer um Männer, die Kindeskinder der alten Ägypter, die unter der gleichen Musik sich gekrümmt haben. Aus den Jauchz-und Jammertönen möchte ich die menschlichste aller Symphonien schreiben können.
Wir essen auf Deck zu Nacht; ich weiß nicht wo wir angelegt haben; Luksor ist es sicher nicht. Jetzt schweigen alle Ufermelodien; dafür singen die Schnaken und stellen sich zur Lampe mit einem Hinterbein in der Luft.
Das Wasser leuchtet trüb wie Milchkaffee. Die Nacht ist schwarz, und hörte ich nicht die Wellen an die Schiffsplanken leise klopfen, ich würde glauben, in einem Landhaus zu sein, inmitten von Wiesen und Sandwegen und würde in den Garten hinunterspringen. —Am fernen Ostufer singt ein Araber auf drei Tönen, von denen er einen mit Atemslänge ausklingen läßt.
Um 2 Uhr nachts sang er noch, wie ich höre, um sich vor bösen Mächten, deren Sitz er auf unserem Schiff vermutet, zu schützen.

Königsporträt.
Kalkstein, etwas überlebensgroß (späte Periode).

Kleiner Porträtkopf.
Basalt (2400 v. Chr.). Beide im Besitz der Verfasserin.
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber wir bewegen uns leise. Die Maschine trampelt, wir drehen. Ich weiß, daß wir nach Luksor reisen und schlafe wieder ein. Der Sänger ruht auch.
Wir frühstücken in Luksor.
In Karnak, der Amonstätte—spricht man nicht vom Pylon, sondern, da es so voll von Pylonen ist, numeriert man sie, und redet vom Pylon VII und tut, als hätte man eine Ahnung von seinem Standort. Um den gewaltigen Grundriß übersichtlich in der Phantasie zu beherbergen, müßte man wochenlang hier zubringen und Geschichte studieren. Schließlich kommt es für den „Feinträumer“ nicht so sehr darauf an, ob dieser Pylon von Thutmosis oder vom viel späteren Ramses III. gebaut worden ist. Aber wenn ich erfahre, daß Amenhotep III. auch einen Pylon gebaut hat, so spitze ich die Ohren, denn Amenhotep war der Vater meines Königs Ech-en-Aton, und ich sehe den kleinen Ech-en-Aton, der damals noch Amenhotep hieß oder wie es die Griechen wollen, Amenophis, zwischen den Arbeitern und den Steinblöcken springen, sofern es seine zarte Gesundheit gestattete, um mit dem Vater den Fortschritt des Baues zu betrachten. Möglich, daß der kleine Kronprinz noch nicht zur Zeit des Tempelbaues lebte, denn Amenophis und Tyi haben auf den männlichen Erben lange warten müssen. Ich freue mich aber an meinem Bild der heimkehrenden Familie. Voran der kleine müde Bub mit dem schmalen, vorgeneigten Kinn, auf nach Maß gearbeiteten Sandalen seine leichten Spuren dem Sande einprägend. Vor dem Bauplatz standen Reittiere, Sänften, Wagen, was weiß ich, der Palast liegt nicht weit. Die Königin wartet unten mit ihren Frauen auf dem herrlichsten aller Fußböden, dessen letzte Reste heute in Museen aufbewahrt werden. Sie leidet nicht an der Bauwut und verbringt ihre Zeit mit der Erforschung von religiösen und wirtschaftlichen Fragen, denn sie war mehr als nur Mitregentin und scheint von einem lebendigen Interesse für Land und Menschheit beseelt gewesen zu sein. Wie stark ihr Anteil an dem durch den Sohn herbeigeführten ketzerischen Umsturz—denn ich glaube an das Einverständnis dieser Mutter mit diesem Sohn—gewesen sein mochte, läßt sich leider nicht feststellen; ich kann mir aber denken, wie sie im stillen die religiöse Übersättigung in ihm vorbereitet und ihre heißeste Freude an den zeitweiligen Erfolgen des jungen Amenhotep erlebt hat.
Von ihm habe ich noch nichts erzählt, von dem jüngsten aller Umstürzler—meinem geheimen Freund; nicht so sehr mein Freund, weil ich ihn Umstürzler nennen muß, als, weil ich, seit ich zum erstenmal sein Bild im Louvre sah, die Schönheit seines ephemeren Halses und Kinnes, das wie ein rundes lateinisches S zur Unterlippe steigt, nicht vergessen konnte. Da erwärmte ich mich für seine Geschichte und erfuhr, wie der Jüngling, fast ein Knabe noch, allen bisherigen Göttern den Krieg erklärte, und sich keine symbolisch wirksamere Kundgebung erdenken konnte als die seiner Namensveränderung: Amenhotep hatte der Vater ihn genannt—in Verherrlichung des Gottes Amon; aber, wie ein jugendlicher Aufgeklärter, der im Namen Gottlieb einen erniedrigenden Gottesdienst erblickte, so schämte sich Amenophis des seinigen, und nannte sich fortab Ech-en-Aton, d. i. „Die Sonnenscheibe freut sich“. Denn der Aton, die Sonne, erschien ihm als die einzige übermenschliche Kraft, die der Vergötterung und seiner Liebe würdig wäre.
Mit Ech-en-Atons Regierung schien ein Frühlingswind der Freiheit die Künstler leise aufzuwecken: Man sieht mit einem Male in der Darstellung des menschlichen Körpers Ausdrucksmöglichkeiten, von welchen bisher niemand geträumt hatte. Und auf allen künstlerischen Schöpfungen dieser Zeit ist eine Sonne abgebildet, deren Strahlen in Leben spendende, freigebige Hände auslaufen. Welch wundervoller Gedanke eines Idealisten, daß die Sonne ihre warmen Hände zur Erde herniederstreckt, und daß diese vielen Strahlenhände für jeden von Ech-en-Atons Untertanen—so wollte er es—eine kleine Gabe in fürsorglich gerundeten Fingern tragen!
Aber meine Phantasie darf nicht wandern.—Ich sitze schon lange unter den Säulen Sethos’ I. und Ramses’ II. Es war ja klar, daß diese Könige sich am großartigsten hier betätigt haben; ich kann mich immer noch nicht fassen über solch prächtige Kühnheit, daher laufe ich in Gedanken zu meinem König Ech-en-Aton, der sie nie gesehen hat und schmerzlich berührt gewesen wäre über die wieder auf das üppigste erblühte Göttlichkeit Amons.
Diese Säulen wachsen in den Himmel hinein, der wie ein Stückchen Fahne oben zittert. So schwindelhoch, massiv gerundet sind sie, daß ich den Fuß nicht mit dem Gipfel gleichzeitig übersehen kann, und ich mir selbst wie ein junger Maulwurf vorkomme. Die Wucht dieser Säulen nimmt ihnen aber nicht das zarte, wie Mädchenwangen Weiche ihrer Gipfel; vorsichtig rundet sich der lichte Stein aus dem Schatten heraus. Bei einem Durchmesser von beinahe 4 m bemerkt man die Rundung kaum. Es ist wie eine große, breite Musik, die im Vorwärtsfließen immer kaum merklich an ein Anfangsthema anklopft, selbst aber nicht hinsieht und sich ahnungslos stellt und glaubt, wir merken’s nicht, weil sie es so schlau in allen denkbaren Verkrümmungen, Zerstückelungen und Schleiern verbirgt.
Schattig und heimlich ist diese heute kaum bedachte Halle; ein Viereck von vier Säulen ist schon ein abgeschlossener großer Raum.—Wenn ich acht Jahre alt wäre würde ich hier beten: „Lieber Gott ich verspreche dir, ich werde nie mehr zornig sein, nie mehr meine Aufgaben schlecht machen und nie mehr frech antworten.“—So aber, wo ich viermal so alt bin, verspreche ich natürlich gar nichts, weil ich genau weiß, daß ich nichts halten würde.
Etwas Gutes sollte schon getan werden—das spüre ich,—aber, mir fällt nichts ein. Wer hört mich, wenn ich sage: „Liebe, liebe Menschen!“ Ich stehe auf und biege nach links in die tiefen Steintrümmer ab, lehne mich an einen Stein, halb liegend, halb sitzend und mache ein Gesicht wie die Katze in der Sonne.
Aus dem Schutt erhebt sich der rötliche Granitobelisk der Hatschepsowet, Königin von Ober-und Unterägypten. Sie und ihre Brüder waren die ersten Königskinder in Theben. Es war alles noch recht neu, —das Regieren des Vaters,—die Residenz.—Man hört die Kinder und ihre Gespielen altklug miteinander beraten: „Wir sind nicht mehr in Memphis, das wäre nicht mehr gut gegangen, hier ist natürlich alles viel besser.“ Und die kleinen Thutmosis und Hatschepsowet und ihre kleinen, schwarzhaarigen Freunde mögen selige Stunden mit Obelisken-und Tempelbauten aus Ton und Steinchen verbracht haben. Ich muß mir die Alten immer als kleine Kinder vorstellen, wo sie noch nichts von dem Begriffe Weltstaat wußten, sondern waren wie unsere Kinder,—also wie wir.— Das Neue, das die Kinder Thutmosis I. noch witterten, mag auch eine Ursache zu den abnormen Zuständen nach dessen Tode gewesen sein. Als Nachfolger des ersten thebanischen Königs meldeten sich hartnäckig drei Prätendenten, die auch abwechselnd regiert haben, —Hatschepsowet und ihre Brüder.
Der Amontempel lockte die Könige zum Bau der Obelisken. Heute liegt der eine zerschmettert tief im Schutt begraben.—Der andere steht unberührt an der Urstelle, leider seiner glänzenden Oberfläche beraubt. Was für Schmuckstücke müssen sie beide gewesen sein, als sie, von edler Metallisierung blendend, keinem Wesen der Natur gleichend, bloß ihrem Zwecke dienten, als Zeugen der Königin Hatschepsowet. Sie aber muß einen ungewöhnlichen Zauber auf ihre Zeitgenossen ausgeübt haben, so stark, daß ihr keineswegs unfähiger Gatte erst dann zu Erfolg und Geltung gelangen konnte, als sie selbst gestorben war. Ein eigentümliches Schicksal hat diese begabte, energische Königin nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie stand als Zielscheibe des Hasses zwischen den zwei gleichnamigen Stiefbrüdern, die abwechselnd ihre Gatten waren. Hatte sie unter ihr Werk ihren mit originellen Konsonanten zusammengestellten, lustig rhythmierten und keck endenden Namen gesetzt, so dauerte es nicht lange, und der eine der beiden Thutmosis hatte durch den Steinmetzen das Autograph der Schwester ausmeißeln und das seinige eingravieren lassen.
Ich begreife, wie ängstlich es ihr um die Fertigstellung ihrer Obelisken zu tun war, und wie glücklich sie sich schätzen mußte, ihn fix und fertig von ihren Arbeitern in sieben Monaten bekommen zu haben. Die Kürze der Lieferzeit wird auch eigens in der Denkschrift auf dem Granit erwähnt.
Wenn ich erwäge, daß ich mir vor Jahren mühsam einprägen mußte, daß der Martinsturm in Landshut als Bayerns höchster Turm zirka 133 m mißt! Und dabei hatten es die Herren Maurer bequem; Stein um Stein wurde hinaufgeschleppt und nach und nach aufgesetzt. Der Obelisk der Königin ist über 30 m hoch, ist von den fernen Steinbrüchen bei Assuan, wo ihn Sklaven aus dem Berge gesägt und Künstler bearbeitet hatten, durch den Wüstensand geschleppt, dem Nilstrom anvertraut worden und dann——
Ihr Herren Maurer aus Niederbayern, stellt einmal den fertigen, liegenden Martinsturm, zirka 133 m hoch, auf, so daß man ihn von allen Seiten betrachten kann! Ich will euch hierfür Dampfmaschinen und Benzinmotoren erlauben; oder, versucht einmal einen rosa Granitblock, 30 m lang, aus dem Berg zu brechen und zu sägen! Hatschepsowet konnte wohl stolz auf ihre sieben Monate sein.—
Dem Gatten waren die Obelisken ein Dorn im Auge; er konnte nicht an ihnen vorübergehen, ohne an die Schwestergattin erinnert zu werden; so kam er auf den Gedanken, einen Bau in Karnak so aufführen zu lassen, daß dieser die Wahrzeichen Hatschepsowets verdecken mußte, was ihm tatsächlich gelang.
Heute bringe ich dem Granitriesen Grüße aus Assuan mit. Er wird den Heimatboden nie mehr wiedersehen, aber wenigstens hat er nicht, wie viele seiner Brüder, über die Meere wandern müssen.
In diesem Gelände, wo jeder König seine Bauhand versuchen, seinen Kriegsruhm verewigen, seinen Gott bekennen, sich, seine Freunde und sein Familienleben verherrlichen und seine Vorgänger in allem übertrumpfen konnte, mußte im Lauf der Regierungen ein Kettenbau erstehen und sich zur wahrsten Geschichte versteinern, der deutlicher spricht als die von vielen Märchen umwobenen, spärlichen Aufzeichnungen, die wir heute über Ägypten lesen. Und ich sehe noch fernere Entdeckungen in der Zukunft durch Ausgrabungen hervorgezaubert, denn ich weiß, daß in diesem Fabellande alles was ich mir träume, Tatsache gewesen sein kann, und nur des Beweises harrt. In den Jahren, die ich noch zu leben habe, könnte noch viel Schönes erwachen und auferstehen. Ich hoffe.—
Ich weiß und genieße es, daß die Menschen des dynastischen Ägyptens längst waren, wie ich bin; ich weiß, daß sie über alle Primitivität des Denkens hinaus und Nuancen zu empfinden befähigt waren, die unseren Sitten und ästhetischen Grundsätzen entnommen zu sein scheinen.
Wenn sie sagten: „Natürlich ist dieses gut und dieses schlecht gemacht“, so verbanden sie mit diesem „natürlich“ ein ebenso festgewurzeltes Selbstverständlichkeitsgefühl, wie wir es mit diesem Wort bezeichnen; auch sie hatten allmählich erworbene Instinkte von schön, gut, böse, die beinahe so tief moralisch waren wie die zehn Gebote eines Moses.
Ich verstehe nichts von Geschichte und noch weniger von der daraus geborenen Kunst, der Politik; dennoch ertappe ich mich an diesem Königstummelplatz für Meisterbauten auf allerlei Erwägungen, Beherzigungen, Vergleichen in diesem mir gänzlich fremdem Gebiet.
Ich stelle mir vor, ich sei der Weise, der am Hofe Amenophis’ III. lebte, und dessen Porträt, ein kluger, leidenschafts-, fast geschlechtsloser Kopf, im Museum von Kairo zu sehen ist, der auf Befragen seiner Zeitgenossen eine Regierungsform vorschlüge: Man nehme eine Dynastie, erlaube ihr drei Generationen auf dem Thron und in außergewöhnlichen Fällen eine vierte— und dann adieu!
Ich bin eben kein politischer Kopf: man nehme— wer ist „man?“ Das sitzt es! Nein, ich werde es niemals begreifen.
Der ägyptische König war Gott, Staatsanwalt und Vater seines Landes. Nach Examina und Verfassung brauchte er sich nicht umzusehen, die trug er in seiner riesigen, hutförmigen Krone. Haperte es mit dem Erfolg, so wurde er leicht von dem nächstbesten Minister oder Feldherren beseitigt, und eine neue Dynastie erblühte auf dem Thron. Mir gefällt dieses wankende, durch sich selbst gefestigte System.
Obwohl es auf der Welt nichts Außergewöhnliches ist, wenn ein fester, schier endloser Faden reißt, so tut es mir doch heute für diese Könige bitter leid, daß ihr schönes Welt-und Sonnenreich, allmählich zum Priesterreich sinkend, schließlich die Beute des Stärkeren werden mußte, und daß die Kultur dieser Menschen, die alles einbegreift, was Luxus, Kunst, Wissen berührt, gestorben ist, mit einem Riß, an den keine andere Kultur mehr angeknüpft hat. Auf diesen Ruinen einstiger Gewalt und Freiheit strömt mir ein Menschentum entgegen, für welches ich ein stärkeres Verständnis zu haben scheine, als zum Beispiel für die germanischen Wilden.
Das Gras wächst hoch in Karnak; unzählige Kammern, Kapellen, Hallen gähnen mir entgegen. Erschreckend schöne Steinmenschen erscheinen unverhofft in den Ecken, hinter Blöcken, auf Trümmern schreitend, wehrlos den Sonnenstrahlen ausgesetzt.
Hört auf zu lächeln! Ihr könnt die Mauern nicht mehr aufbauen, seht ihr nicht, daß ihr nicht mehr die einzigen seid, die lächeln?
Sie sehen es nicht. Ihre Augen stehen im Bann der Sonne wie ehedem.—Was kümmert es sie, wenn im Staub zu ihren Füßen außer den Schakalen noch einige Legionen Europäer und Amerikaner herumschleichen? Immerhin hält sie ein stärkerer Staub lebendig, als der, aus dem Schakale und Menschen geformt sind. Ihr Lächeln ist nur das Lächeln des Scheintodes.—
Dort liegt der Kopf eines gestürzten, zerschmetterten Amon-re. Er spricht. Er sagt mir: „Ich glaube an dich; ich habe immer an die Menschen geglaubt.“
„Ich dachte, sie glauben an dich?“
„Weil ihr so denkt, darum lächeln wir immer.“
„Amon-re, ich glaube an deine Schönheit durch Menschenhand; auch ich glaube an den Menschen— der aber verbirgt sich, wie Götter es tun.“
Amon-re antwortet mir nicht mehr. Jetzt lächelt er wie ein Toter.—Ist wirklich dieses das allerschönste Lächeln?
Die Spatzen leben zu Tausenden in den Creuxreliefs, und wenn auch noch so viel Götter, Könige, Feldherren, Prinzessinnen sich gegenseitig das Zeichen „Leben“ vor das Gesicht halten, auf daß es mit der Luft ins Herz eingeatmet werde, es ist doch alles gestorben, vergangen, gelogen.
Königslächeln ist Kinderlächeln, Götterhuld ist Mummenschanz.
Die Spatzen, die mich in ihrer gemütlichen Frechheit auf der Insel Elephantine angeheimelt hatten— hier verwünsche ich sie,—ich möchte wirklich nicht an Ludwig den Bayern, Friedrich den Schönen, Karl V. und Anna Boleyn erinnert werden.
Staubwolken sind vor uns auf dem Weg. Darin sind Fremde. Teils rollen sie im viersitzigen Wagen für Handlungsreisende oder halbdutzendweise im Einspänner, teils springen sie auf haushohen Sätteln, die ein schmales Eselchen umspannen. Schwarze Brillen, zu kleine Tropenhelme mit rückwärts wehenden Läppchen sieht man aus der weißen Kalksteinwolke vorüberblitzen. Damen in Schleiern kommen uns entgegen mit bedrückter Miene. Freilich, dunkle Seidenblusen, schwarze Jettketten, Wollröcke, Schaftstiefel, unzählige Kämme unter Hüten, denen man die Unfähigkeit der Hutnadeln ansieht, Gürtel, Korsetten, Handschuhe, Baedeker, Mundvorrats-und andere Taschen, Sonnenschirme, dazu die Zügel, bilden einen erdrückenden Verantwortungskomplex, aber sie scheinen sich alle in guter Stimmung zu befinden und denken, man merkt nicht wie erhitzt und müde sie sind.
Wir gehen nach Bibân-el-Mulûk und Dêr-el-bachri; etliche Touristen überholen wir, andere kommen uns von dort entgegen. Der Wind hebt den Damen Hut und Rock, und die Hand, die sich so gerne am Zügel festgehalten hätte, muß die Rockwellen bekämpfen, während der Wind, glücklich der Aufsicht entronnen zu sein, mit den gefälligen Hutkrämpen und Haareinlagen spielt.
„De Kingses tombs“, wie die englisch geschulten Führer die Königsgräber nennen, kommen nicht zur Ruhe. Mir bangt es um ihre schöne Intaktheit. Täglich in der Saison wird den strengen Bergen dieses Lärmen, dieses Geschrei, um die braven Tiere zum Laufen aufzumuntern, vorgemacht. Die Eselbuben drängen sich durch das Gewirre, jeder bei seinem Esel, den er nicht einen Augenblick aus dem Auge läßt und in einem fort nötigt. „Hier nimm!“ sagen die Peitschen, „hierher doch, rechts, langsam,—lauf jetzt,—hol ein,—links, —laß den nicht vor,—drück doch,—nicht vorlassen, —ha noch schneller. Oâ regläk oâ! oâ hhhâ!“ Die Eselbuben leisten noch mehr wie die Esel, die bloß tragen und sich dabei in Gedanken zerstreuen dürfen; die Treiber laufen,—auf ihren eigenen Sohlen natürlich, —mit wild aufgerissenen Augen, ihren blauen Gewandzipfel, der sie am Laufen hindern würde, mit den festen Zähnen haltend, und beständig, ohne den Zipfel loszulassen, brüllen sie kurz, wie drohend ihre Eselssprache und lassen ihre bösen Stöcke diese Sprache unterstreichen.
Ich selbst reite den Esel von Luksor. Er heißt Arîs, ist fünfjährig und weiß, aber so kurz geschoren, daß seine schwarz durchschimmernde Haut ihn eisengrau färbt. Seine kleinen, kurzen Borsten würden eine großartige Nagelbürste abgeben. Ich spiele damit auf seinem Kreuz, wenn ich die Hand hinter den Sattel hängen lasse. Er ist schneller als alle Wagen und anderen Reittiere, und es ist ein Vergnügen, sich mit ihm durchzuschlängeln, zur Wut der Überholten, die das gleiche Spiel spielen, aber nicht den Esel haben. Arîs, d. i. Bräutigam, ist schön und wird gut behandelt. Sein Besitzer würde ihn nicht verkaufen, weil er sich ausrechnet, daß er viel mehr Piaster dafür bekommt, wenn er ihn vermietet. Er behauptet, ihn nie für große Gesellschaften zu geben, weil er dann nicht wüßte, wer ihn zu reiten bekäme und dem Tiere leicht etwas geschehen könnte. Ein schöner, ernster Esel, der wie ein Täuberich den Hals aufschwellt und die vier Beine im Stehen so ordentlich aufräumt, daß man immer nur zwei sieht, ist, wenn er groß ist, das idealste Reittier für dieses Land. Er geht immer legato, auch im schärfsten Tempo, während das Pferd, wenn es nicht auch wie der Esel Paß geht, gelegentlich mit dem ganzen Körper sich von der Erde abstoßen muß; der Esel läßt den Weg nie ganz los und schont dadurch seine Beine vielmehr als das Pferd, das mit dem ganzen Gewicht auf den Fuß fällt;—der Esel wirft dieses Gewicht im Laufen nicht weg, daher auch dieses fabelhaft rucklose, maschinenhafte Vorwärtskommen.
Wir galoppierten den staubigen Damm entlang. Ich lasse alles, was Leben ist, hinter mir. Unser Schiff schaukelt allein am jenseitigen Ufer, wo Luksor sich zwischen Bäumen sonnt.—Der Weg wird steinig, hart, er dreht sich steigend in ein abgestorbenes Tal ein, leere Felswände hängen rechts und links, wir drehen uns immer tiefer wie in ein Schneckengehäuse ein,—der Weg steigt etwas mehr.—Bei jeder Bergwand, die sich vorschiebt, glaube ich hinter ihr am Ziele zu sein.— Der letzte Kessel, den eine heiße Sonne seit Jahrtausenden bestrahlt, haucht uns glühend an,—weiße Schutthaufen, weiße Berge, der weiße Weg, alles blendet; wir steigen ab und schicken uns an, in die vielfach entweihten Stätten, wo Könige ihre ewige Seligkeit vor Neidern zu verbergen gesucht haben, einzudringen. Die Sicherheitstore öffnen sich vor uns,—ich gehe ein paar Schritte,—schon weiß ich nichts mehr von der Sonne. Eisig ist es hier und lichtlos, wie man nach rückwärts in seine eigene Kindheit stiege; auch hier geht es weit und wird es immer dunkler. Die Wände beleben sich aber mit Träumen. Man versteht nicht mehr, was diese Zeichen oder jene bedeuten, aber man erkennt sie wieder an ihren Umrissen, die man bestimmt aus früherer Zeit festhält.
Die Gänge krümmen sich, und die Stufen versenken mich immer tiefer in die Geheimnisse dieses Berges.
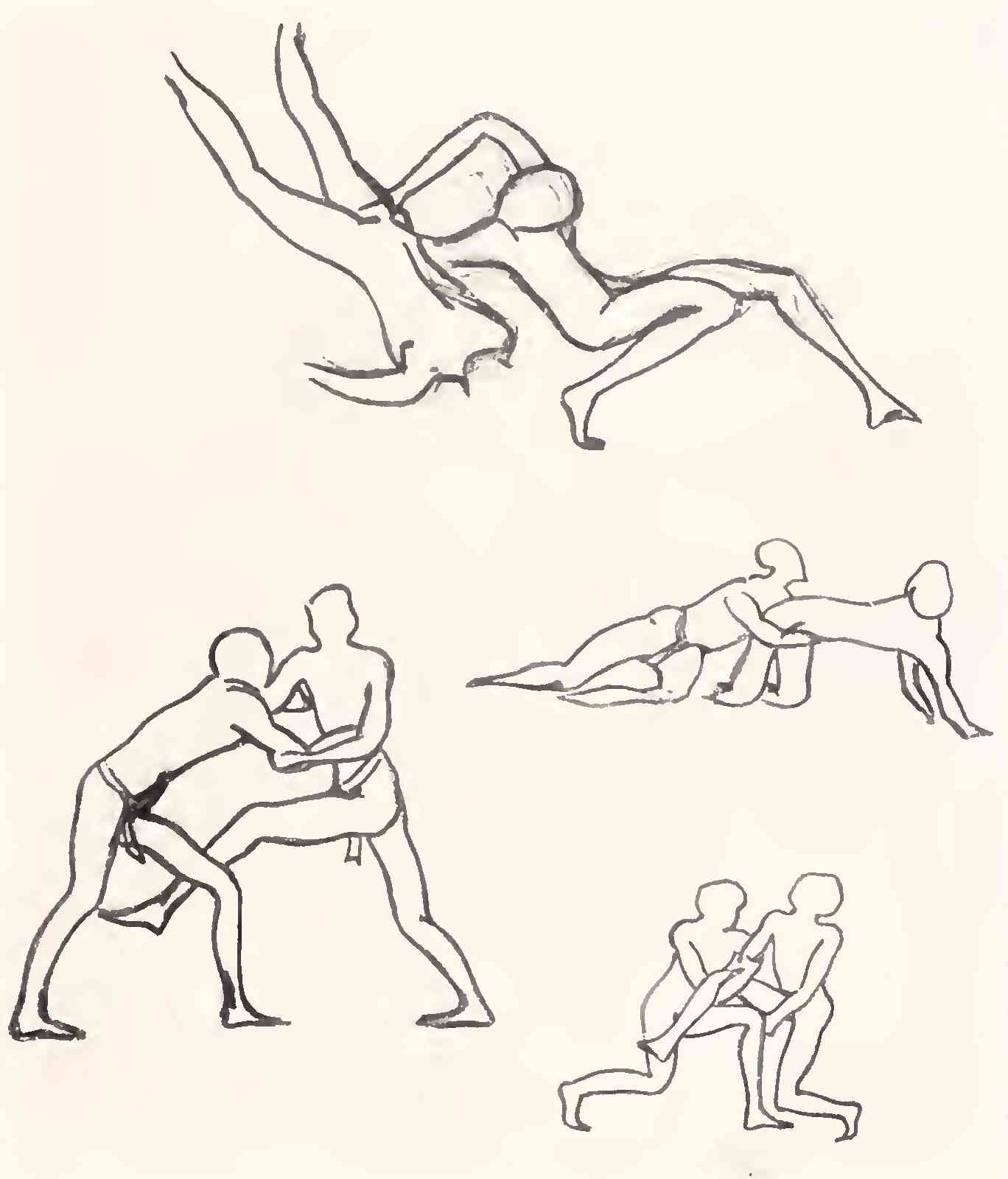
Wandzeichnungen aus einem Felsengrab in Beni Hassan.
Die Könige des neuen Reiches hatten wie ihre Vorgänger eine Sorge, eine ganz persönliche Sorge im Leben, das war die Wohnungsfrage nach dem Tode. Die Könige des Alten Reiches hatten ihre Totenkammern durch darüber aufgebaute künstliche Berge, die Pyramiden, gegen Feinde gesichert und ihrer königlichen Würde entsprechend der Nachwelt gekennzeichnet. Die Könige des Neuen Reiches hatten keine Lust zu den langwierigen Pyramidenbauten; sie ließen sich „einfach“ in die natürlichen Berge ihres Landes versenken.
Und nun begann eine neue Tätigkeit für die Künstler Thebens. Es ersteht eine geheimnisvolle Kunst, die einem König und vielen Göttern gehört. Keine persönliche Eitelkeit wird den Künstler bestimmen, niemals wird die Nachwelt mit dem Auge des Lebens sich an den Bildern freuen—vielleicht wird nur ein einziger Künstler mit seinen Gehilfen an einem einzigen Königsgrab arbeiten, daran altern und vor seinem Herrn sterben. —Freien Phantasien wird er sich noch weniger als andere hingeben können, denn seine Kunst darf bloß dem toten König eine würdige Wohnung für das unterirdische Leben schaffen und braucht nichts als das möglichst sichtbar und faßbar zu enthalten, womit Menschen Götter beschwichtigen, überreden und ihnen angenehm schmeicheln.
Nicht weit von Theben zieht sich ein strenges Kalkgebirge hin. Hier versagt sich der Boden dem lebenshungrigen Samen. Hier spricht nur die Sonne mit dem Stein ... Dann kam der Mensch.—
Vor dem Wesen mit dem harten Schädel, den unbegreiflichen Augen und den unberechenbaren Handbewegungen, der hier nicht Nahrung suchend wie die heulenden Schakale und Wölfe die kantigen Höhen streifte, sondern mit Willen und Idee dem Steine gegenüberstand, mußte der sich öffnen, und selbst die Sonne, seine treue Verbündete, konnte ihm nicht nützen gegen die zähe Kraft des goldhäutigen Menschen.
Und weiter mußte der Stein sich öffnen und die weiße Sonne auf den jungfräulichen Kalkstein brennen, der sich dem Härteren zu fügen hatte.—Tiefe Gänge, breite Kammern und längere Gänge grub der Mensch ein und den Kalkschutt entfernte er. Der Berg ertrug es. Dann holten Bildhauer endlose Züge von Göttern und Tieren aus der toten Fläche hervor, Künstler bestrichen die frischgeschürften, schneeigen Wände mit blutroten, zitronengelben und feuerblauen Tönen, und der Berg ertrug es. In Friedenszeit stieg der König wohl selbst hinab und besah sich seine Totenkammer, während Fackelträger ihm die vollendeten Arbeiten beleuchteten. Der König untersucht alles genau, denn eine unterlassene oder falsch angebrachte wichtige Formel würde ihm sein zweites Leben dort unten zur Qual gestalten.—Die Reise in das Totenreich ist noch beschwerlicher als das Sterben selbst. Ein kompliziertes Netz von Stationen, die erst dann passiert werden können, wenn die feindlichen Hüterschlangen in der bestimmten Formel beschworen oder unschädlich gemacht worden sind, wird den Weg häufig unterbrechen, den der König auf der Totenbarke still zu gehen haben wird. Die bösen Schlangen haben lustige Namen: Zetbi, Ekebi, Teke-hor, Apophis, die der Tote kennen muß. Jede Darstellung in den Totenkammern hat eine Bedeutung für das Wohl des Toten. Liebevoll, ängstlich, dankbar will der König viele Götter abgebildet haben, damit diese dem Toten, der sich kein Verdienst mehr erwerben kann, gnädig sein mögen. Und wenn der König sich alles genau betrachtet hat, kann er ruhig dem Tod in Osiris Armen entgegensehen. Alles ist auf das Würdigste vorbereitet.
Die Luft wird schwer; ich steige tiefer, tiefer hinab, ich suche jede Stufe, die manchmal gar nicht vorhanden ist.—Da haben sie den Sarkophag hinabgeschleift ..., den schweren Granitkessel, in den sie den König betten werden.
Noch weiter taste ich mich. Nun trete ich lautlos versinkend auf Sand, der ganz dünn auch in der Luft schwebt; ich sehe im matten Licht der Lampen Pfeiler, die den ausgehöhlten Raum stützen. Ich atme kürzer, die Luft ist dick und schwül, ich höre mein Herz pochen, und es riecht hier nach trockenen Gegenständen, die keinen Duft mehr tragen.—Aber je tiefer ich eindringe, desto bunter, desto reicher werden die Wände. Der König erscheint viele Male; einbalsamiert, wie er zum letzten Male gesehen wurde; hier opfert er dem Gott Horus, hier bringt er sein Bestes dem Gotte Amon, hier dient er einer sehr einflußreichen Gottheit, die in nilpferdartiger Gestalt wandelt und die Fruchtbarkeit des Landes regelt. Große, grüne Schlangen, die sich in Achtern ringeln müssen, ihrer Länge wegen, ziehen die Wand entlang nach unten hin.—Ich bin von Traumbildern umgeben, die ich nicht deuten kann, die mich aber mit erwartungsvoller Gespanntheit erfüllen, wie in frühen Tagen, da die Welt als ein buntes, über alle Beschreibung schönes, noch unbekanntes Land auf mich wartete ...
Hier fährt ein großer Skarabäus ernst und allein in einer schlanken Barke, dort beugen sich Männer zu den Fersen herab, während ihrem Munde mehrere Skarabäen entspringen. Wo anders halten Skarabäen in den Vorderfüßen Hieroglyphen. Schlangen in Schürzen bedienen, oder speien Gefahren aus ihrem Rachen. Dicke Nilgötter knien mit freundlicher Gebärde. Dazwischen leuchten wieder vielmals die Umrisse des Königs in einbalsamierter Gestalt. Der König ist ganz Diener, Sünder, Bettler.
Manchmal steht er vor Osiris. Sie sehen sich beide an, der Gott und der König. Nie wird einer vor dem andern die Lider senken. Sie starren mit dem großen Auge so lange aufeinander, bis sie sich nicht mehr sehen können. Die Schlangen haben keine Macht mehr. Der König hat alle Namen gewußt. Alle Zeremonien sind an ihm vollzogen worden, auch die Zeremonie vom Öffnen des Mundes, wonach er befähigt sein wird, zu essen und zu trinken. Er ist eingedrungen in Osiris und lebt ein seliges, todloses Leben voll irdischer Wonnen. Er wird auch arbeiten, Schätze aufstapeln; der Weizen wächst dort viele Meter hoch, und weil die Bestellung der unterirdischen Felder oft mühevoll ist, so kann der König seine Grabesfiguren, denen Osiris Leben einhauchen wird, als Gehilfen verwenden. In einem Grabe sieht man diese arbeiten, mähen, ernten, während der König lautlos in der Totenbarke vorüberzieht.
Kein Ton dringt von draußen in die Gräber, und innen ist tiefstes Schweigen.
Da kann ich nicht umhin, ich muß den Bildhauer suchen. Daß das eine Auge der Profilfiguren unverkürzt seine ganze Länge von vorne zeigt, und daß die Menschen an der Wand manchmal zwei rechte Hände haben, stört mich nicht. Wie sollte auch solch eine Kleinigkeit, die dem Auge etwas verschmitzt Tierisches verleiht, weil es viel länger und dadurch schmal wirkt, gegenüber der herrlich schönen Ausführung der Körper etwas bedeuten? In jeder Gruft ist eine besondere Kunst angewandt worden; ich weiß nicht, welche ich am meisten genieße. Manche Reliefs sind so flach, daß nur der Rand der Körper und der Glieder greifbar ist, und so glatt poliert, wie ein elfenbeinernes Papiermesser. —Dann wieder sind sie tief in die Oberfläche einversenkt und dort erst auf das feinste geformt. Diese eingebetteten Creuxreliefs sind wohl verwahrt und darum kaum beschädigt. Die Farben sind frisch, als hätte sie der Kalkstein eben zum erstenmal eingesogen.
Ich sage nicht: „Hier steht der große Osiris auf Plattfüßen in weißem Seidentrikot mit Knebelbart und Krone, Geißel und Krummstab—oder, hier schreitet der Gott Anubis mit dem freundlichen—herzig-schlauen Schakalskopf und der Göttermähne,—oder hier, links vom Beschauer erblicken wir Horus (Harendotes) mit dem Falkenkopf, einem unzufriedenen Tänzer mit Papierkrone und Tiermaske gleichend, nicht zu vergessen den verbissenen Sobek und den großen Ptah, dem eine Lotosblume aus dem kuttenartigen Gewand am Nacken herausguckt.“—
Das alles sage ich nicht und denke es nicht einmal, und wenn jemand fragen würde: „Wer ist denn der große Gelbe da oben, oder warum hocken dort zwei Menschenkäuze einander gegenüber und weshalb steht eine Gans hier so allein und von allem losgelöst, und was bedeuten diese eingewickelten Leute, die Treppen hinansteigen, ohne zu schreiten“, so wäre ich kaum imstande, passende Antworten zu geben; denn, die solche Fragen stellen, sind nicht mit einem xbeliebigen Gefasel zufrieden. Ich aber bin ziemlich unwissend im Punkt Geschichte, Sitten und Gebräuchen, Land und Leuten, und wie diese Zwillinge alle heißen, die der Sprachgebrauch gepaart hat. Augenblicklich sehe ich bloß Kalkstein, der wie Gips so weiß, sehe nur die kleinen Kanäle, welche die Konturen bedeuten und aus denen sich Schulterknochen, Magenhöhle, Brustkorb, Oberschenkelmuskel, schlanke Waden und kaum gewölbte, durch keine Wülste entstellte Bäuche leicht anschwellen, um ebenso unmerklich in den gegenüber fließenden Konturenkanal zu verschwinden; und auf der safrangetönten Wand hebt sich ein weißes Gewand hervor, das, mir scheint, vorgestern erst mit Kalkmilch darauf gemalt worden ist.
Diese toten Herren in Knebelbärten, die so fest ihre Kiefer aufeinanderdrücken, daß die Wangen sich härten, und ihre Mundwinkel so mit Humor, Würde und Süßigkeit anfüllen, daß niemand ihnen etwas abschlagen könnte, haben sich eine wahrhaft in Verlegenheit bringende Miene ausgedacht, um, Aug in Aug, den Göttern sich zu nähern. Auch die Götter können nicht anders als süß, humor und würdevoll die Herren des Weltreiches empfangen. Ist das Absicht der Künstler oder Nicht-anders-können? Wie kommt es, daß ein Schakal oder eine Gans so charakteristisch schakalisch und gansig, wie man sich’s nicht besser träumen kann, von diesen Künstlern geschaffen wurden, während sie ihre Menschen sich in die einheitliche Maske von List, Seligkeit und Blasiertheit verbergen lassen?
Im Grabe Ramses’ IX., etwa 1100 v. Chr., sind schöne Creuxreliefs, die an Glanz der vom Tageslicht beleuchteten Plastik (das Grab ist nicht so tief wie andere) mit dem der Farbe wetteifern und wie ein geschnittenes, von der glatten Seite betrachtetes, Kristallnegativ aussehen, das auf farbigem Hintergrund ruhte. Die Wände sind sorgfältig eingeteilt,—breite, blaue Ränder stoßen auf zitronengelbe, schmale Gesimse,— die Größe der Zeichen paßt sich ihrem Rahmen an. Die Farben sind so frisch, wie auf neuen Landkarten; es sind die Farben vom ersten Malkasten—auf wunderschönem Papier—wie man es zum Geburtstag geschenkt bekommt. Die Konturen sind scharf eingebohrt und an den inneren Seiten viel tiefer als der Hintergrund. Dazwischen schwellen die Figuren— in den Farben des ersten Malkastens.
Merenptah, der Nachfolger Ramses II., liegt in rosa Granit gehauen, flach auf dem Deckel seines Sarkophages. Liebevoll und fest an den Arm gedrückt, als letzter Beweis seiner Königsechtheit, hält er die Zeichen seiner Königswürde mit dem ägyptischen Griff, bei dem vier Finger den Gegenstand, und der Daumen mit dem alleruntersten Glied die vier Finger umklammern, während die Daumenspitze an der gespannten Faust vorbei, schlank und unbenützt ruht.

Aus dem Grab eines hohen Würdenträgers bei Theben.
Alle haben sie diesen Griff. So halten die Götter ihren schakalköpfigen Stab, so führen die Könige Geißel und Krummstab, so hält der Sklave die Zügel der Pferde, so hält die Frau die Lotusblume, wenn sie am Nil ihre Garben zum Schmuck des Hauses pflückt,— die ganze Hand hält, der Daumenschenkel schließt ab,—der Daumenfinger reckt sich als einziger frei über die gebeugten übrigen Finger.
Über den seligen Merenptah wölben sich romanisch geformte Bogen auf kurzen untersetzten Säulen. Der König sieht himmlisch verklärt zur Decke seines Grabgemaches hinauf. Seine großen, guten Ohren liegen wie zwei fremde Gegenstände ihm zu Häupten.
Er ist so rosa, so funkelnd unter der dunklen Halle, so für sich, in sich selbst vergessen; er kommt mir vor wie eine große Speise im Bankettsaal, von der im nächsten Augenblick die Cooksche Herde unter launigen Tischgesprächen alles aufessen wird.
Das Hinaufsteigen zum Tageslicht ist beunruhigend, in dem Maße als das Hinabsinken vorher traumhaft wohltuend wirkte. Ist es wahr, wir werden wieder ins alte Leben uns stürzen? Wer wird da droben auf uns warten? Dieses Königs Nachfolger etwa? Nein! der ruht nicht weit von hier mit seinen eigenen Nachfolgern. Wir wollen auch ihnen vielleicht einen Gruß vom Leben bringen.
Wir kommen wieder an den Inschriften vorüber; ich weiß manchmal nicht, ob ich steige oder hinabgehe —wir haben schon viele Stunden bei Osiris verbracht —ich habe noch nie in wenig Stunden soviel geträumt.
Bei Ramses III. ist der schwarze Stier Meri vom südlichen See und die gefleckte Kuh Hesi vom nördlichen See abgebildet—und soviel ich mich erinnere, sah ich Betten, die sehr einladend bereitet waren und ein praktisches Möbelstück dazu,—ein kleiner stufenreicher Tritt, um bequem in das hohe Bett steigen zu können. Viele Schlangen sehe ich paarweise sich einem Zug voranringeln, paarweise überzeugt besser als einzeln; zwei identisch gekleidete, stehende Wächter sind ein unerbittlicheres Hindernis, als drei verschiedene.
Dann schleiche ich, glücklich den bösen Schlangen Zetbi, Ekebi, Teke-hor, Apophis entronnen, an ungefährlichen, zahllosen, bilderreichen Inschriften vorbei. Nase und Lungen füllen sich mit sonnig warmer Frühlingsluft, und ich erwache!
Diesen Morgen besuchten wir die Gräber der großen Würdenträger der XVIII. Dynastie in Abd-el-Gurna. Ich hatte immer einige bunte Bleistifte und einen Briefpapierblock unter dem Arm. Die Esel warteten draußen im Schatten einer Mauer. Ich versuchte unter dem wackligen Schein einer Stearinkerze einige der über alle Begriffe schönen Wandgemälde zu skizzieren. Diese Gräber haben nicht die Tiefe der Königsgräber; Bildhauer wurden nur in wenigen Fällen zur Ausschmückung derselben herangezogen, aber ich weiß nichts malerisch Großartigeres als was ich heute morgen in den Wänden dieser Berge erlebt habe. Die höchste Periode chinesischer Porzellanmalerei weist keine besseren Werke auf als die dort aufgedeckten.
In dem Grab des Menne, Oberaufsehers der Feldmarken Amons, auf Deutsch glaube ich päpstlicher Gärtner, erlebte ich eine zeichnerische und malerische Vollendetheit, die in Worten kaum wiederzugeben ist; z. B. Wildenten: Konturen zeigen nur die Körper, die hängenden Füße und den Kopf. An den Flügeln aber sind die einzelnen gespreizten Federn, ohne Verbindungsstrich gemalt. Die Farben sind diskret, aber treffend angewendet, ein warmes Rötlichbraun,—die weiße Wand als Farbe benützt—und schwarz; und nun sieht man diese Enten in allen Stellungen zu Hunderten flattern, ruhen, sich drängen; genau nur das, was man von der Ente im ersten Hinsehen aufnimmt, ist hier festgehalten; das starre Auge ist im schön modellierten Kopf an der einzig richtigen Stelle,—so recht in den Schädel eingedrückt.
Ein schlankes Mädchen mit lichtblauer Kopfspange, einem farbig gestreiften Kragen und vielen goldenen Armbändern verschiedener Stärke, steht am Bug eines grünen Schiffes und hält in einer Hand an den Flügeln drei erlegte Enten, die ihre Köpfe noch hoch halten. Sie sind ziemlich schwer—und das Mädchen stützt mit einer gut gesehenen Bewegung den Ellenbogen an die Hüfte und dreht die innere Armfläche nach außen. Im linken Arm trägt es eingezwickt, herabhängende Lotosblumen—und Lotosblumen in der Hand (im ägyptischen Griff). Es beugt sein Profil über die ententragende Schulter, und seine Füße stehen dem Profil entgegensetzt.—Der Mund ist durch die Halsspannung verlängert, das große, schwarze Auge schaut allein nach vorne. Der tiefdunkle, rosa Leib ist auf die weiße Wand mit einer staunenswerten Sicherheit in wenigen roten Konturstrichen hingezeichnet. Es hat einen reizenden Ausdruck von Frechheit und seligem Freiheitsgenuß. Auf dem gleichen Schiff kniet neben der Stehenden ein süßes kleines Mädchen,—so flach es kann. Seine Brust berührt die Knie, und die langen Arme hängen beide über den Schiffsrand herab an einer Lotosblume, die es dem Wasser entreißt. Es trägt einen Schmuckgürtel und Armspangen.—Das Gesicht ist zerstört; die Hände packen den Stiel, der sich unter dem Druck der acht Finger windet, mit einem sicheren, praktisch erprobten Griff. Die kurzen Haare reichen kaum bis zur Schulter. Weiter treibt ein rotbrauner Nubier mit fürsorglich kindsfrauenhafter Miene ein scheckiges Stierkälbchen mit rosa Nase, Hals und Bauch; auch hier ist eine bezaubernde Sicherheit in der anatomischen Linie der Beine, des Rückens, keine Stilisierung, nur das absolut Charakteristische. Die Linie, die das Vorderbein bilden wird, beginnt schon oben an der Schulter, umschlingt den Huf und hört erst am Ellenbogengelenk wieder auf. Welche Übung gehört dazu, um Körper und Glieder so selbstverständlich wie Buchstaben hinzumalen! Farblich sind diese Bilder ungemein reizend. Helles Weinrot und Orangetöne, graublau mit Rosa und Ocker und freche Schwarze legen sich in den Umrissen der Figuren aneinander. Die Gesichter haben Ausdruck; Frauenlippen sind keineswegs nach einem Schema gezeichnet, sondern mit scharfer Beobachtung der Natur abgeschwindelt. Auf einem Profilgesicht lagert sich eine Oberlippe in die Unterlippe, wie ein brütender Vogel in sein Nest ein; dort wieder liegt sie, kurz gewölbt über der anderen Lippe, diese wie eine Haube umschließend. Man möchte die Frauen alle gekannt haben, man möchte die Münder lachen machen, sehen, wie die Zähne stehen.
Auf der gleichen Fläche sind tiefere und hellere Töne erzielt, etwa so wie bei der Porzellanmalerei, wo die Farbe auf einer Stelle hinabfloß und da, wo der Tropfen erstarrte, dunkler wurde; so sind z. B. an dem kleinen bunten Stier abgetönte schwarze Flecken, ebenso an einem Zweispänner von Schecken, lediglich durch verschieden aufgetragene Farben erzielt; und die ganze Fläche ist so frisch und poliert, wie die schönsten italienischen Fresken oder die pompejanischen Wachsmalereien. Auch im Grab der Nacht sind schöne Gemälde auf schneeweißem Grund, aber vielleicht etwas mehr stilisiert. Da wird musiziert, gegessen, geopfert, gespielt, geträumt, Blumen werden berochen, Jagden abgehalten,—es wird geerntet, gebaut, geruht.—
Wie ich in den schmalen Raum trete, der von Schutt und Sand befreit, stolz seine kleine Nummer des aufgedeckten und für Fremde zugänglichen Grabes trägt, bin ich von den heiteren Farben in dem niederen Raum wie geblendet. Viele rothaarige kupferhäutige Menschen mit weißen Schürzen und tüllartig durchsichtigen Obergewändern oder auch ohne diese, bewegen sich leise und heiter, wie sich’s in der Unterwelt nicht anders denken läßt.—Eine kleine, karottengelbe Sklavin, die sich nur in ein schmales Bändchen um die Hüften kleidet, bringt einer vornehmen Dame einen zitronenartigen Gegenstand zum Beriechen. Die Dame ist elfenbeinern und trägt schneeweiße, anliegende Beinkleider.
Der blinde Harfenspieler, dessen Musik drei Damen erheitern soll, singt, auf dem Boden gekauert; sein rotes Haar ist kurz geschoren, und eine rote Fußsohle schlüpft aus dem weißen Gewand am Oberschenkel heraus, was auf das Einfachste zeigt, daß er die Beine untergeschlagen hat.
Ich könnte Hunderte von Bildern beschreiben, alle sind sie wie in Rötel gezeichnet,—knapp und doch so reich erzählend, und so schön restlos zugemalt, wie mit einem einzigen Wischer.
Ein tief gelegenes Loch mit vier Pfeilern im finstern Berg ist das Grab des Sanâferi. Die sehr reizvollen Fresken stellen ihn an einem Tisch sitzend dar, mit Blumen in den Händen,—einem blätterreichen Strauch als Hintergrund und seiner kleinen Tochter, die ihm kniend in Zärtlichkeit die Beine hält. Das ganze Gewölbe ist mit blauen Trauben und Weinblättern bemalt, die einer Laube entwachsen. Die Treppe, die da hinunterführt, besteht aus zu hohen Felsstücken, und man muß lange gebückt kriechen, ehe man unten in der kleinen, heimlichen Weinbergsgruft, voll der rührenden Familienbilder, sich aufrichten kann. Die Weinblätter sind auf geniale Weise gezeichnet: ein grüner Kreis, in welchem dreimal ein Hecht hineingebissen hätte: So entstehen die Einbuchtungen des Rebenblattes.
Ich habe den ganzen Vormittag bei den Gräbern der Minister der XVIII. Dynastie verbracht. Mein Esel trug mich von einem zum andern; dazwischen stürzten gelbe Hunde auf uns,—wütend über die Störung, denn zwischen den Gräbern haben die heutigen Ägypter ihre Hütten aufgebaut. Schwarze, weichohrige Ziegen spazieren hier herum, jeden Stein umdrehend, ob nicht vielleicht doch ein Gräslein daraus sprießen würde. Dann springe ich ab, werfe meinen Hut in eine Ecke und verschwinde in einem Erdloch mit meinen Bleistiften. Kein Wind, kein Regen hat diesen Friedhöfen die heitere Ruhe ihrer in Osiris frohen Toten rauben können. Da unten ist es wie in einem Paradies,—die Wände glitzern wie im Christbaumschmuck —und öde und verlassen scheint mir nur der Lebendige draußen zu sein.
Auch die Gräber der Königinnen atmen Freude und Furchtlosigkeit. Die Königin, die Göttin, die Göttin, die Königin; sie geleiten einander, engumwickelt, sie machen verträumte Gesichter, sie zeigen sich kleine Gegenstände, die umhüllt und verschnürt, wahrscheinlich nur Göttern dargebracht werden.

Wandgemälde aus dem Grab des Sanâferi.
Und dann sah ich den unvergleichlichen Tempel der großen, so schmachvoll verleugneten Königin Hatschepsowet, wo die herrlichsten Flachreliefs von ihren Taten erzählen. Sie selbst, da sie regiert hat, wird als König mit steifem, abgehacktem Bart und dem verschlungenen Schurz dargestellt, gewöhnlich ist aber ihr Bild weggemeißelt, durch die Sorgfalt ihres neidischen Brudergemahls. In den Reliefs erzählt sie uns, wie ihre Granitobelisken auf dem Nile von Assuan nach Theben gesegelt waren, wie sie sich aus fernem Lande Kostbarkeiten, Bäume in Kübeln für den Amonsgarten in Theben kommen läßt. Diese Reliefs sind von auffallender Feinheit, stilisiert, soweit als möglich vereinfacht, zurückhaltend und dadurch wunderbar lebendig in der Erzählung. An diesem Tempel angrenzend, steht noch, ziemlich verschüttet zwar, der „Stall“ der Kuh Hathor ... Was mag der Entdecker dieses Versteckes, wo die Gottheit unversehrt seit Jahrtausenden im Finstern stand, empfunden haben, als die Sonne zum ersten Male wieder ihre guten Kuhaugen und ihren milden Kuhmund mit den naiv lächelnden Mundwinkeln beschien? Wo anders hat die Kuh ihr „Kuhtum“, ihren kuhlichen Ausdruck als in dem rührend wohlwollenden, kindlich eingedrückten Mund, und ich bin dem alten Bildhauer so dankbar, daß er es nicht unterlassen hat, ihr das zu geben.
Das Ramesseum, der von Ramses II. erbaute Amonstempel, und der für mich noch schöner wirkende, nach dem Grundriß des ersteren, von Ramses III. erbaute Tempel von Medînet Habu bildeten das Ziel unseres letzten Ausfluges am Westufer des Nils.
Um einen weiten, mit Steinfliesen gepflasterten Hof legen sich vier schmale, hohe Gänge. An der Größe fühlt man, daß die Räume Amon galten und nicht gewöhnlichen Menschen, denn die Maße drücken uns zu schwachen, menschenköpfigen Zwerglein herab. Die Stufen sind nur für Götterschritte berechnet.
Die Steine, die um den Freiplatz die Hallen bedecken, sind blau gefärbt wie der Himmel und soviel man von unten ersehen kann, von fünfzackigen Sternen gesprenkelt. Es sind schöne gemeißelte Darstellungen an den Wänden und in den Kammern feine, farbige Abbildungen, die die Sonne noch immer nicht zu bleichen vermocht hat. Die Säulen am Allerheiligsten sind geschleift worden und sehen aus wie regelmäßig eingepflanzte Mühlsteine. An der Außenwand kann ich wieder die wundervolle Art der Bauarbeit bewundern. Die alten Ägypter hatten wohl die bestgeschulten Arbeiter; wenn ich denke, daß solch ein gewaltiger Felsenklotz von Tempel fertig dastand—und daß dann, von oben anfangend, diese Menschen über alle Steinfugen hinüber ihre Reliefs meißelten, nach einem kleinen, in Quadrate eingeteilten Modell! Hierfür bedienten sie sich keiner Gerüste: Sie errichteten einen Sandwall, erhöhten ihn mit dem Anwachsen des Baues, und wenn dieser stand, und die Reliefs an die Reihe kommen sollten, fiel eben einfach eine Sandschicht nach der andern; der Hammer zwang den Meißel über die Fläche hinüber, Steinsand feilte die Form auf das feinste heraus, und wenn die letzte Sandschicht weggefegt war, sah man kaum noch die Fugen der trocken aufeinanderruhenden Steine,—ein lebendiges buntes Bild war wie durch einen Zauberspruch darauf festgebannt. Entzückend ist die Darstellung einer Gazellenjagd; das Wild wird mit Pfeilen vom Wagen herab beschossen. Auch tief eingezeichnete Kriegsbilder in der schönen Art der Reliefs von Abu Simbel finde ich hier.—
Kurz vor Sonnenuntergang reiten wir durch die fetten Felder bei Luksor und kommen heim, wenn die Stadt uns mit ihren elektrischen Lichtern daran erinnert, daß die lebendige Gegenwart, die mir die Nacht da draußen hinter engsten Mauern über schmale Wassergräben, bei wohlbestellten Feldern und in Palmengärten vorgetäuscht hatte, in Wirklichkeit längst Geschichte und Sage geworden ist ... und ich, die ich noch soeben wähnte, auf der Flucht nach Ägypten mein Eselein antreiben zu sollen! ...
Im Dunkeln sah ich aus den Lehmhütten schwarze Menschen treten, die aus faltenschweren Ärmeln schlanke Arme streckten, und gedachte der allzustrengen Plagen, die Jehovah einst über die Ägypter verhängen zu müssen glaubte; freilich durfte er nicht länger sein auserwähltes Volk sich an himmelstürmende Bauten verbluten lassen.
Aber die Vernichtung der gesamten Erstgeburt!——
Diese für die Ägypter härteste Plage,—ihr stark entwickelter Familiensinn hatte aus der Kalamität sofort den richtigen Zusammenhang gewittert,—zeigte bald die erwünschte Wirkung, und Moses konnte unbehelligt die Kinder Abrahams in eine Heimat zurückführen, die wohl keiner von ihnen gekannt haben mochte.
In Luksor gibt es noch viel zu tun—ach! und wir müssen es schon so bald verlassen.
Wieder an Bord der „Indiana“....
Adieu Theben—auf Wiedersehen!—
Auf Wiedersehen? Das weiß ich nicht: Du kommst ja jetzt mit mir fort.—Niemand wird dich mehr finden. Wir werden es niemand sagen—, ich habe mit vollen Händen alles fortgetragen.
Ich liege auf dem Rücken und rufe dich;—welches von dir? Heute den Weg zu den Kolossen im Morgentau. Hier gibst du Tau, gute Erde! Auf jedem Halm stellst du den Tropfen zum Frühstück hin—und wie trunken wird dein Gras!—Lasse mich an dich weiter denken ...
... Gleich Göttinnen der Weisheit kommen mir Kamele entgegen, deren Weg ich auf Eselshufen kreuze. Jedem sehe ich auf die Finger, trachte herauszubringen, ob sie echt sind, ob es Tiere sind; es gibt kein anderes Tier, das so wie fließender Sand seine Glieder in sich rollend machen kann. Mit der Grazie einer Katze setzt es seinen Fuß auf irgendwelches Terrain—und gleitet vorwärts wie ein Schwan auf dem Wasser. Seine Klauen können alles,—es ist gemacht aus einer grauen Gummihaut, mit blondem, spärlichen Pelz; es könnte mit der Haut die Glieder überall hin spannen. Das Tier ist sicher eine Attrappe, etwas mit einer genialen Maschinerie,—vielleicht die einzige Maschine, die uns von den Alten überkommen ist, und auf die wir bis jetzt hereingefallen sind—bis daß man auf den Betrachtungsreisen, die man auf seinem endlosen Körper anstellt, plötzlich auf das Auge kommt. Auf einmal erschrickt man und sieht, daß das Tier Ansichten hat, Charakter, Persönlichkeit. Es hat Augen wie Damen, so von Laszlo, mit unwahrscheinlichen Glanzlichtern, —nein viel liebere Augen natürlich. Wie kleine Mädchen tragen die Kamele Halsketten aus Glasperlen. Die Mode dieser Kolliers könnte ins Endlose variieren, —bald trägt man sie oben an der Gurgel, bald unten am Décolleté, bald in der Mitte am ersten Katarakt.—
Ich träume von den Memnonskolossen. Es ist so töricht zu sagen: Träume sind Schäume. Träume sind winzige Luftblasen, die aus dem tiefsten Meer zum Äther hinaufsteigen und jedem erzählen könnten, wie es dort unten aussieht. An den Memnonskolossen blüht in weitem Umkreis eine kunstgerecht durchgeführte Landwirtschaft unter Sonnen-und Bauernlaunen. —Die Riesen sehen zu und freuen sich, daß noch kein neuer Dung und kein neues Korn erfunden worden sind, und daß der Araber den nämlichen flachen Laib Brot formt, wie seinerzeit die k. Bäcker Thebens, und was müssen sie am alten Nil sich freuen, es muß etwas Beruhigendes für sie haben, daß sein weißes Bett heute sowie damals ihnen gegenüberliegt. ...
Wir gleiten auf seinen milchigen Wogen. Es ist schon gut, daß ich da bin, um ihn zu kontrollieren.— Er hat sich wieder unheimlich geschmackvoll hergerichtet, nach Osten ist seine Farbe heller als der Himmel über den rosa bestrahlten Hügeln. Etwas Rosa wird bronzig im kalten Hellgrün des Wassers. Er ist glatt und macht bloß einige Falten, da wo ihn das Schiff rafft. Wollte ich das zeichnen, würde ein böser Kitsch daraus, zumal, wenn ich darauf die Körper unserer Leute anbringen wollte, die wie mit schärfster Schere in Papier ausgeschnitten, dunkel da herum hantieren.
Inzwischen sehe ich in der weiten Sandfläche kleine Nilreste, die genau dieselben Farben vom Großen zeigen. Segelboote gehen schlafend an uns vorbei. Ich spüre stolz, daß unser Dampfer auch nicht schlecht aussieht. Unser Rauch macht herrliche Tuschtöne in den Himmel hinein, und alles was Gitter, Eisenstange, Seil ist, hat eine bedeutungsvolle Art sich am Himmel abzuheben. Vögel fliegen über das Wasser, so nah, daß man zwei sieht; man glaubt, sie rutschen auf dem Parkett.
Jetzt ist etwas Herrliches farblich zu sehen: Ein gelbgrauer Hügel spiegelt sich. Da, wo das Bild aufhört, ist das Wasser perlmutterrosa und gelbgrün. Die Sonne ist weg; alles liegt in feinen schwedischen Handschuhtönen. Zwischen dem Wasser und dem Hügel sind flache Ablagerungsstellen des Nils, erst unbewachsen, dunkel, feucht, dann smaragdgrün von Weizen und Gras.—Der obere Rand des Berges ist so scharf, daß er blendet. Wie macht man das? Und da, wo der Himmel beginnt, genau mit der schwarzen Profillinie des Berges blendet es wieder. Ganz kleine, nasse Sandbänke erscheinen,—sie sind in der Farbe wie sie sein müssen, damit sie in das Bild passen. Die Westseite sehe ich gar nicht an. Sie ist zu herausfordernd. An der Südseite freilich sind gute Übergänge, aber Übergänge sind immer etwas Gemachtes, man merkt zu sehr den vorbereiteten Wechsel. Ich bleibe bei den Handschuhtönen. Unser aufgerolltes Segeldach, das parallel mit dem Berg läuft, bildet sich mit Recht ein, gut zu stimmen. Ich bin ganz bös, daß ich kein Maler bin; gerade dieses Segeltuch, das wie eine dicke Raupe oben auf den Stangen liegt, macht sich gut; seine lustig gebrochenen Schatten sind noch dunkler als der Rauch, der nun den ganzen Himmel durchzieht, auch im Wasser sich spiegelt und eine Beziehung all der gelben, grauen Töne zueinander schafft.
Lebewohl, Theben! Wir sind schon weit von dir.— Ich fürchte, es wird zu schwer werden, dich ganz mitzunehmen. Aber ein buntes Fragment von jedem Tag, den ich auf deinem Boden erlebte, habe ich mir erobert und das werde ich mir sorgfältig aufheben, unter Glas stellen und liebhaben.

Wandmalerei aus einem Felsengrab in Beni Hassan.
Die einsame Kranke, die ich in Assuan kennen gelernt, habe ich nun in Luksor gelassen. Ich habe auch diesmal manche Stunde mit ihr verbracht. Vor ihrem Hotel steht eine Bank, auf welcher eine Dame (Imitation) in Weiß, voller Spitzen, Federn und Ketten saß, während ein Individuum in rotem Fez vor ihr auf dem Kies hockte, auf zwei hochgestellten Fußspitzen. Es sah so aus, als balancierte er sich auf einem einbeinigen Melkstuhl. Sie aber hatte ihm ihre Hand zur Wahrsagerei überlassen und ich hörte ihre etwas zögernde Frage: „And ... have I been happy in my former life?“
Als ich „unauffällig“ nähertrat, schwiegen sie beide, und ich mußte mich leider entfernen.
Vom Tempel von Luksor nehme ich eine schöne Erinnerung mit: Ramses, überlebensgroß, schreitet mir aus dem Schatten zweier Säulen strahlend entgegen; freudvoll und leidvoll ist seines Mundes Ausdruck, frauenhaft herzlich bewegt, glaubt man, und sieht, daß selbstsüchtige Gedanken sich zu Selbstmitleid steigern können und daß daneben grausame Kälte von diesem Gesicht ausstrahlt ...
Dieser Tempel ist der schönste Ort in Luksor und groß genug, daß man stundenlang durch die Trümmer wandern und den lebendigsten Erzählungen lauschen kann. Hier ist es weniger ernst und heimlich als in Karnak; ich bin oft dagewesen, war faul und hatte gute Einfälle, wie immer, wenn ich an gar nichts denken will und eigentlich nur Eidechsen, Schlangen und Skorpionen zu begegnen hoffe. Ich hatte statt diesen sehr schöne Reliefs gefunden und eine köstliche, zeitlose Ruhe. Meinen Feldstuhl hatte ich wohl zwanzigmal wo anders aufgestellt, und überall war es gut und „spannend“, obwohl ich niemand auf meiner Bühne auftreten ließ. Ich erzähle mir soviel Schönes, Unmögliches und Mögliches, manchmal verfolge ich irgendein Problem, während ich mit Interesse einen Kampf zwischen Sperling und Kohlweißling verfolge.
Mrs. E. St. hatte mir gesagt, sie liebte die Menschen, die über die Kleiderfrage erhaben seien, sie haßte aber diejenigen, die tiefer als diese Angelegenheit des Sichanziehens ständen.
„I love people that are above dressing but hate those that are below.“
Daran dachte ich, als ich klein, auf meinem unsicheren Feldstuhl dem großen Ramses gegenüber saß. Und ich erinnere mich, daß allmählich ihm gegenüber bei mir ein Stolz anschwoll, der in einer inneren Lustigkeit seinen Ausdruck fand: „Wir sind auch jemand“, sang es in mir, denn ich liebe unsere Zeit, und ich klappte meinen Feldstuhl zu, schlüpfte mit dem Arm hinein und trug ihn durch alle Hallen, leise singend. Ich glaube an unsere Zeit, ich sehe unsere Tempel—und wenn andere sie nicht sehen, so macht es mich glücklich.
Unser Schiff geht nicht mehr. Zwei Schwarze decken den Tisch. Wir haben irgendwo angelegt. Ich wußte wirklich nicht mehr, daß ich auf einem Schiff bin. Mein eigener Garten ist etwas so Konkretes, daß es mich erstaunt, wie wenig die Außenwelt ihn bemerkt. Freilich, die Mauern sind hoch.
Wir sind früh am Morgen in Beliâne angekommen und wollen von dort aus zu den Tempeln von Abydos reiten, die Sethos I. und Ramses II. etwa 1300 v. Chr. gebaut haben. Ein hoher Dammweg zwischen fruchtbaren Feldern, wo Kamele ackern, führt uns über Brücken und durch Dörfer zu dem großen Tempel des Sethos.
Gleich an der Eingangswand sehe ich wunderbare Porträtreliefs Ramses II. mit der leicht gebogenen Nase und dem starken, fraulich weichen Mund. Er ist von der eben aufgegangenen Sonne herrlich beleuchtet. Die Vertiefung des Creux-Reliefs wirft auf das Profil alle entscheidenden Schatten, wie sie die Photographen leider nie berücksichtigen. Sie sind bei der Aufnahme einer Skulptur schon selig, wenn die Platte genau die Form an sich wiedergibt. Sie haben selten das nötige künstlerische Verständnis. Das richtige Licht für die Plastik ist, was für die Musik die Akustik bedeutet.
Die Morgensonne leuchtet in den Tempel hinein, eine Morgenfrische voll Vogelstimmen haucht uns an, und ich bleibe vor den herrlichsten, bunten Relief-Skulpturen gebannt stehen, während der Tempelhüter im Gegensatz zu anderen seines Berufs uns freundlich einen heißen Mokka anbietet.
Ein blauer Gott, mit blauer Wadenbekleidung und leichtem, anliegenden Orangegewand—(die Farben sind fast überall erhalten) verleiht einem ganz jungen, viel kleineren König Sichel und Keule. Der mit aufgestellten Zehen kniende König trägt einen feinen Türkisschmuck auf dem leuchtenden, zierlich schmiegsamen, rotbraunen Körper. Ein anderer Gott mit Widderkopf, Chnum, gibt mit herablassender Handbewegung seinen Segen zu der symbolischen Handlung.
Auf Tabletten werden Früchte gebracht, Taubenbraten, mit Lotos geschmückte Vasen, in deren Zwischenräumen Lotosblumen schweben.
„Beileibe nicht“ und „wie ihr wollt“ und „ich bin bei euch“ sagen die Handbewegungen.
Die Göttin Mut mit dem Löwenkopf gibt dem jungen Königssohn die Hand, und mit der anderen überreicht sie ihm etwas, mit einem bittenden Gesicht, wie es nur Löwinnen machen könnten. Ich sehe, wie der König freundlich verlegen, sich nicht aus der Lage zu ziehen weiß und im Grunde seines Herzens selig ist. Ich sehe auch hier die Abbildung der großen Göttin, die einem kleinen König die Brust gibt und ihm mit der ganzen Schwere ihres freien Armes liebevoll um die Schulter faßt; oder der kleine Regent sitzt ihr auf dem Schoß, eine Hand faßt ihn um das Haupt, die andere hält sein emporgehobenes Kinn so nah wie möglich an ihr eigenes, feines Gesicht, das ein aufgebauschtes Haar umrahmt. Alles ist in Kalkstein von unnachahmlicher Feinheit gearbeitet. Götter, Göttinnen und anbetende Könige, und nichts vom großen Ech-en-Aton. Seine Träume waren mit seinem Tode in Vergessenheit geraten. Sein Priesterhaß hat keine Folgen gehabt, vielmehr war es den Priestern gelungen, Amon und die endlose Reihe der anderen Götter in ihre Rechte wieder einzusetzen und aufs neue in den ungeheuren, Amon zufließenden Kirchenschätzen zu schwelgen. Der Grundriß dieses Tempels ist von dem gewöhnlich angewandten verschieden. Hinter den vielen Kapellen ist ein Jagdrelief zu sehen, wo die Enten so lobenswahr, wie sie im Grab des Menne gemalt, in Kalkstein als Reliefs gebildet sind. Schwimmende und fliegende sehe ich und solche, die von Sklaven büschelweise an den Flügeln gehalten werden. Die Hast, womit viele, viele Enten schwimmen, weil sie sich nicht trauen aufzufliegen, ist aufs beste charakterisiert. Weiter sind große Reliefs, die darstellen, wie die Opfertiere geschlachtet werden. Das Hauptinteresse für die Geschichtsforscher bildet eine Liste aller ägyptischen Könige. Sethos I. ließ sich diesen Stammbaum des ägyptischen Thrones meißeln. Er selbst und der kleine Ramses sind häufig abgebildet. Die Entenjagd hält Ramses mit einigen Göttern, die zu Gast geladen sind, ab. Einige der erbeuteten Vögel werden Amon und Mut dargebracht als Zeichen der Huldigung.
Der Tempel Ramses II. ist beschädigter als der eben gesehene. Er liegt etwas weiter im Wüstensande und ist wie abgemäht; auf gleicher Höhe ist der große Steinkörper abgeschnitten, und die Blöcke fehlen; der Tempel sieht heute wie eine schön gearbeitete, bemalte Gartenmauer aus.
Wir reiten in der Mittagshitze heim, aber sie tut nicht weh, denn die Felder und Wiesen, die den Weg einfassen, duften gar zu gut nach gesunder Erde, die nie Durst zu leiden hat. Ich sehe von weitem etwas auf dem Weg stehen, etwas ganz kleines, was nicht davonläuft. Gott, nur nicht fortlaufen, ich komme schon. Ich treibe meinen Esel leise an, und gehe ganz nahe hin, und—halte den Hals eines zwei Tage alten Kamels im Arm. Glück muß man haben. Es war dunkelbraun, noch ganz neu, sein Haar aus echter Kamelwolle, um die großen, schwarzen Augensterne ein Strahlenkranz von einzelnen Wimpern, auch am Mund hatte es lange schwarze Börstchen. Als mein Esel ganz nahe war, suchte das kleine Kamel daran zu trinken, obwohl es sich hätte denken können, außer einigen anderen Details, daß seine eigene Mutter sicher viel höher sein müsse.
Dieses Land produziert langwimprige, melancholische Tiere. Die büffelartige Kuh hat auch lange, seidene Wimpern um die nassen Augen, die nichts Rollendes, Weißes, zeigen, sondern schwarzblau, wie die Augen des Wildes sind. Schwarz ist auch ihre Haut und spärlich von lockigem, abstehenden Flaum bewachsen. Das Auge, kummervoll in die Ferne schauend, der Mund hoch und schmachtend, fast horizontal, gibt diesen Kühen einen Ausdruck von Burne Jones-Menschen. Aber sie haben schwere, gesunde Beine und Hufe.
Als wir hungrig wieder an Bord standen und auf die Überraschung des italienischen Kochs warteten, beobachteten wir einige Frauen, die im Nil einen Haufen Wäsche säuberten. Etwas weiter holt ein torkelnder Wasserträger, just an unserem Landungsplatz, natürlich unterhalb der Wäscherinnen, Trinkwasser für die Durstigen von Beliâne ... Der Araber denkt, daß destilliertes Wasser keine Kraft mehr habe. ...
Ich glaube, heut war unser letzter Eselritt. Rrrjâ, challâ, hât, hàte, Bôz und was sie sonst noch hinter einem dreinschreien, weil ich das Antreiben mit dem Stock nicht haben will, werden wir nicht mehr oft hören.——
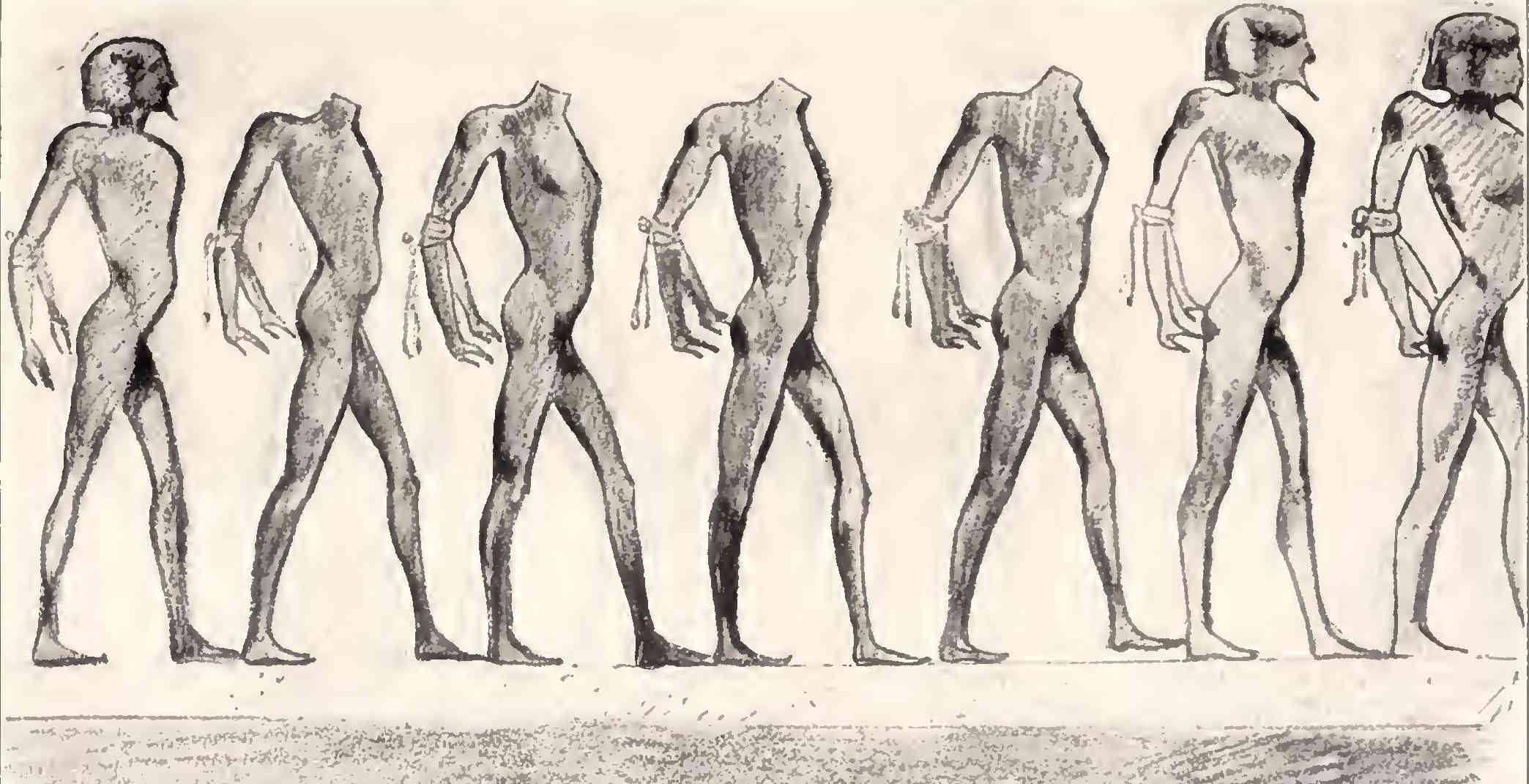
Buntes Creux-Relief aus dem Grabe Ramses IX.
Wir fahren an verschiedenen Cooks-und Regierungsdampfern vorbei, die traurig auf unsichtbaren Sandbänken hocken. Unser Pilot kennt den Nil; an den runzeligen oder allzuglatten Stellen geht er im Bogen vorbei. Am Ufer sehe ich genau die Ränder, die den letzten Wasserstand markieren; schon sind die Krusten mit Gras bewachsen und harthufige, hölzerne, zottelige Ziegen galoppieren darauf herum, gefräßig und übernervös an den Grasbüscheln äsend. Diese Ziegen, mit weichen, biegsamen Dackelohren und klugem Gesichtsausdruck sind meine Freunde. Sie schreien nicht „Bäh“ sondern „Mé“ mit deutlichem m und accent aigu; und wenn sie größer wären, könnte man sicher darauf reiten, so fest sehen sie aus.—
Ich liege auf meinem Korbstuhl unter dem großen Segeltuch an Deck. Die Maschine spüre ich kaum, der Luftzug da oben massiert mir den Haarboden. Die Augen habe ich halb zu, da der Wind sie kalt macht; aber ich sehe alles, die grauen Leinenkissen auf den Strohsesseln, die sicher in irgendeinem Gefängnis von Sträflingen hergestellt worden sind, die Bretter vom Deck, die solid im erkalteten Teer stecken,—das Gitter, auf dem ich so gerne sitze, mich an der Eisenstange haltend—und vor mir der Nil, der Nil, der Nil. Ganz vorne geht er zu, weil die Ufer sich ineinander verschieben, und man kann spielen, daß er ein See ist. Am Himmel sind große Wolkenballen, die ein unordentlicher Wind ziellos umhertreibt. Zwei Nubier klettern wie Eichkatzen zum Segeltuchdach und stellen sich auf die obere Stange des Gitters, mit Fußsohlen, die zu greifen vermögen. Die Fesseln sind so dünn, daß ich sie in einem Ring von Daumen und drittem Finger einschließen könnte, und aus dem Gelenk strahlen in sanftem Bogen fünf Knöchelein zu den Zehen. Eine hohe, steile Ferse, ohne den unschönen Einschnitt der Achillessehne oberhalb ihrer Rundung, gibt diesen Füßen etwas tierisch Vollendetes. Die Nubier mußten auf Befehl des Rais das Dach zusammenrollen, weil der Wind für die Maschine zu stark und das Dach die Richtung des Schiffes beeinflußt. Nun ist es fort, und ich werde eine Beute des Rauches. Heute abend ist der Nil gewiß nicht wie Kopenhagener Porzellan. Wir haben hohen Wellengang. Ich gehe in meine weiße Kabine; da kracht die Holzwand vom Wind. In meinem Glas stehen Akazien aus Abydos. Wir fahren ziemlich nahe vom linken Ufer, dort scheint das Wasser tiefer zu sein. Auf einem kleinen Steig längs des Flusses sehe ich Schafe, die heimgetrieben werden, aber sie sind noch immer freßbereit. Sie finden den Heimweg nur dann genießbar, wenn sie denken, daß sie rechts und links mit heftigen Genickbewegungen Gerste und Luzerne stehlen werden. Es macht ihnen nicht den geringsten, abschreckenden Eindruck, wenn der Hirte mit dem Stock auf ihrer schon gestrickten Wolle herumklopft. Auf der Böschung gehen Frauen, die ins Schiff heruntersehen. An den feinen braunen Knöcheln schimmern silberne Spangen. Silber steht dieser Haut viel besser als Gold. Nubische Frauen tragen einen kleinen Silberring in einem Nasenflügel, was sicher in der Sprache der Gefallsucht die Bedeutung eines Grübchens hat. Mir kommt die Farbe des Silbers so bekannt, so heimlich, so richtig vor auf dieser kaffeefarbigen Haut. Ich weiß auch warum. Mokka fließt aus Silberkannen; auch Farben können wie Töne eine ganze Welt von Begriffen hervorrufen: Mokka und Silber bedeuten gemütliche Häuslichkeit, geschmackvolle Eleganz ohne Protzerei, Einfachheit ohne Gemeinheit.
Ich frage unseren Dragoman Murad, weil er eben vorübergeht und weil ich immer, wenn mir jemand meine Einsamkeit nimmt, sofort darauf eingehe, indem ich geräuschlos meinen Privatschrein schließe,—ob es denn für mich möglich sei, einem Krokodil zu begegnen. Er erwidert bedauernd, daß man sie nur jenseits von Khartum häufig sehe, sagt mir aber, daß in seiner Kindheit in der Nähe von Abu Simbel ein Mann und ein Kind von Krokodilen angefallen und verspeist worden wären. Der Mann sei beschäftigt gewesen, im Sande des zurückgetretenen Nils Wassermelonen zu pflanzen, und war gebückt, als ein Krokodil heraussteigt, ihn mit einer heftigen Bewegung des Schweifes schlägt und ihn in das Wasser zerrt, alles in wenigen Augenblicken. Das Kind hätte Ziegen gehütet und wäre in gleicher Weise getötet worden. Er sagt aber, daß das Vieh ruhig und auch der Mensch ins Wasser gehen könnten, je tiefer, desto besser. Gefährlich sei nur das Heraustreten. Mit dem Rachen würde das Krokodil nie angreifen—und mit dem Schweif hätte es nur außerhalb des Wassers Gewalt. Ob das stimmt, weiß ich nicht; jedenfalls bin ich traurig, keines dieser bösen Tiere gesehen zu haben,—meine einzige „Enttäuschung“ in Ägypten, denn darauf hatte ich gezählt.
Die Sonne wird gleich ins Totenreich sinken. Sie muß mir noch schnell ein schönes Bild beleuchten;— am Wasser steht ein sechsjähriges, braunes Mädchen in einem von oben bis unten gestreiften Kleid. Farben: breite blendende, lila Streifen wechseln mit scharfen lachsrosa geblümten und gesprenkelten ab; auf dem Kopf ein Tuch von grober Musseline, teils grellorange, teils fuchs-zimmt-rotbraun. Das Tuch hing rückwärts lang herab. Das Kind breitet die Arme aus und winkt mit den Mokka-Händen zu unserem weißen Schiff herüber.
Ich sehe die unermeßliche Kiesebene von Tel-el-Amarna. Ihr Rand ist ein Kreis von unbewachsenen, zackigen Bergen. Ich stehe am Rand einer großen, flachen Schale, die mit Sand und Steinen gefüllt ist. Man muß es wissen, um es zu glauben, daß hier der große Schwärmer, der Sonnenanbeter, der Mißbilliger von Vielgötterei und Priesterwirtschaft, der Fanatiker für die Idee des Natürlichen, des Menschlichen, der junge Ech-en-Aton, einziger Sohn Amenophis III. seine Residenz aufgeschlagen hatte. Aufgeschlagen wie ein Zelt, denn allzubald nach seinem Tode wurde die junge Stadt Echut-Aton, d. i. Sonnenhorizont, wieder verlassen. Die Könige kehrten nach Theben zurück, und ebenso die Scharen der Götter mit ihren schlauen und habsüchtigen Priestern. Hätte Ech-en-Aton außer seinen sieben Töchtern einen Sohn gehabt, wer weiß, wie es um die Dauer der ägyptischen Weltherrschaft gestanden hätte. Wer weiß, ob nicht die junge Residenz und mit ihr die neue Kunst des Impressionismus, die Ech-en-Aton ins Leben gerufen, sich soweit erstarkt hätte, daß heute in den Gymnasien ägyptische Hieroglyphen den Ausschlag für die Zensuren geben würden. Aber der junge, kränkelnde Idealist sprach nicht mehr über seinen Tod hinaus. Er starb mit 28 Jahren nach 17jähriger Regierung und hinterließ der Nachwelt seine unfertige Seele, die über seinem unfertigen Werke schwebte, und seine sicher nicht allzu schwere Mumie der Obhut seiner Nachfolger. Sie wurde in ein Felsengrab am östlichen Ende der heutigen Kiesebene versenkt.— Die Großen seines Reiches wurden in den Bergen der nördlichen Seite bestattet auf halber Höhe des Berges; und hier sitze ich, lasse meinen Blick über das Kiesmeer ziehen und stelle dort die Stadt und Ech-en-Atons Palast wieder auf. Für ihn muß der schöne Fußboden in seines Vaters Palast zu Theben eine Erinnerung aus der Kinderzeit gewesen sein. Auch er ließ sich einen phantastisch schönen Stuckfußboden, einen Teich mit Wassertieren und Schilf—und soviel ich weiß, eine lange Reihe von Sklaven malen, auf die er so täglich königlich treten konnte. Ein Jammer ist es um dieses Kunstwerk: Es scheint, daß es im Jahre 1912 böse Buben zertrümmert haben. Als wir hinkamen, fanden wir alles verschlossen und hörten diese Erklärung. Außer Sand-und Steinfarbe gibt es bis zu mir, die ich auf dem schmalen Steig heraufgeklettert bin, keine Farben; nur der Himmel glänzt über allem Schutt wie eine große, blaue Schale. Hinter mir gähnt die Öffnung zum Grab des Merirē, dem einstigen Oberaufseher des kgl. Harems. Die Wände des hohen, gleichmäßig vierseitigen Raumes, den zwei Pfeiler stützen, sind voll von eingemeißelten Darstellungen. Aber die Fanatiker des Amonkults und die rohen Wüstlinge der nachchristlichen Zeit haben hier die Schönheit der Arbeiten zerstört;—zumal das Haupt des Königs ist sorgfältig zerhackt und unkenntlich gemacht worden, aber seinen Hals und das Kinn mit dem Ansatz der Unterlippe, jene charakteristische Kopfhaltung auf dem langen, dünnen, nach vorne geneigten Hals, der wie ein Blumenstengel die schwere Dolde kaum tragen kann, haben sie ihm gelassen, und daran erkennt man ihn. Seine Gemahlin Nefertiti gießt einen Trank in die Schale, die ihr Ech-en-Aton entgegenreicht. Seine Linke ruht müde unterhalb der Brust, den Magen umschließend. Der Ellbogen ist spitz und krampfhaft geschlossen, wie die Arme sehr magerer, abgehärmter Frauen. Der Arm, der das Wasser entgegennimmt, ist auch müde, aber unendlich anmutig in der Bewegung. Leider ist die zerstörende Hacke auch an dieser Hand tätig gewesen, aber ich erkenne noch die obere Daumenlinie. Der dritte Finger ist am weitesten vorgestreckt. Die Hand ist trotz der Zerstörung sprechend. Ich kenne Frauen, die nur in Ech-en-Atons Stellung, mit dieser Handbewegung, auch die Linke gehört dazu, reden; Frauen, die vom Leben genug wissen, um leise und verzeihend für die Härten, die es für sie gehabt hatte, andere auf die Schönheiten aufmerksam zu machen, statt über das Leben herzufallen mit hackender Gebärde ... Trotz allem und allem, es ist doch herrlich schön.——
An einer Wand, wohl in Erinnerung an den Lebensberuf des Verstorbenen Merirē, sind viele Hundert spielender Mädchen zu sehen; rote, eingefärbte Creuxkonturlinien, auf rot überstrichener Kalkwand zeigen in skizzenhafter Lebendigkeit mehrere Gruppen aufjauchzender, hüpfender Mädchen, die ebensogut von der Hand unserer heutigen Zeichner stammen könnten. In diesem Grabe hätte ich nicht ungern meine kleine Hütte aufgeschlagen,—links die Schlafstelle, rechts meine Bücher, Bleistifte, Papier. Einen guten Esel könnte ich auch noch unterbringen in der zweiten Kammer.——
Die Aussicht ist so schön klar und weit, und vor meiner Klause macht der Felsen eine Art Altane, für die Abende vor dem Schlafengehen, wenn ich den Himmel zu inspizieren habe.——
Wieviel ungeöffnete Grabstätten mögen hier noch auf die Hacke der Ausgraber warten. Leider waren die Esel zu schlecht und die Zeit zu kurz; zu den entgegengesetzten Gräbern konnten wir nicht mehr reiten, da wir am gleichen Tage noch die hochgelegenen Felsengräber der Großen des Mittleren Reiches in Beni Hassan besuchen wollten.

Die Kuh Hathor.
Die Darstellungen dieser Gräber, die nicht tief, daher auch gut beleuchtet sind, öffnen sich mir wie ein schönes ägyptisches Bilderbuch. Die Verstorbenen stammten fast alle aus einer Provinz mit märchenhaft klingendem Namen, dem „Gazellengau“. Die Gazellen bilden hier einen Hauptgegenstand und sind meisterhaft frei und sicher gezeichnet und al fresco gemalt. Unzählige Gruppen von Ringkämpfern, die genau unsere heutigen Stellungen zeigen, schmücken die Wände eines Grabes. In einem anderen sehe ich die Handwerker der XII. Dynastie, die Töpfer, die Maurer, die Schreiner, die Maler, die Goldwieger, die Barbiere, die Weber, die Zolleinnehmer und auch Bauern. Vor den Totenzügen tanzen Mädchen;—die Lieblingsbeschäftigungen des Verstorbenen, wie Jagen, Fischen werden aufgezählt. Die Räume stützen sich auf den im Felsen ausgehauenen Säulen, die teils rund, teils kantig gearbeitet sind. Die Farben der Figuren und Tiere sind da, wo sie erhalten sind, schön kräftig, ölig, von bestimmten dunklen Konturen oder, wie z. B. bei den Ringkämpfern, nur Ton in Ton rot gehalten.
Von oben sehen wir den Nil, der heute ein blaues Kleid angezogen hat, und unser weißes Schifflein. Wir steigen wieder hinab. Die Maschine hustet, und der Schlot zeichnet mit einem weichen, schwarzen Kohlenstrich Bänder in den Himmel hinein. Wir fahren wieder. Die Dreiuhr-Sonne brennt gelb und schief in alles herein, und die Fliegen haben Sonntag. Sie sitzen dumm und flach, aber sehr unstet auf Büchern, Haaren, Händen, Stoffen. Sie singen, wenn sie fliegen, und waschen sich die Hände mit Kopfnicken, kaum daß sie Fuß gefaßt haben. Man sollte einige Dutzend Laubfrösche hier auslassen, aber die würden in der Hitze vertrocknen, und die Fliegen würden sich auf die Leichen setzen und sie auffressen.
Weil wir uns der letzten Station unserer Nilfahrt, Assiût nähern, um dann den Zug nach der Hauptstadt zu benutzen, bemerke ich, wie ich mich immer mehr mit den vierzehntägigen Erinnerungen an Kairo beschäftigte; ich sehe die äußere Stadt, ihre Straßen, das arabische Viertel, das europäische, die Wagen mit Gummirädern, von verhetzten, unbarmherzig gepeitschten Hengsten gezogen; ich sehe die Plakate mit angepriesenen Unterhaltungen für den naiven Fremden, —das Heer der geldhungrigen Faulenzer in bunten Gewändern und das Heer der lärmenden Hotelbesucherinnen in noch bunteren, die dem Sphinx ihre Hüte und Toiletten zeigen, um einmal den Scherz umzukehren und ihm Rätsel aufzugeben.—(Aber der Sphinx schaut darüber weg.)
Und die Pyramiden ... Den Montblanc zu bauen, das ist nichts; die Erde schickt einfach aus ihrem kochenden Innern eine Zornesblase an die Luft und ohne Grundriß und Kopfzerbrechen für die Gesetze der Zahlen hat sie den Montblanc erbrochen und dann erkalten lassen, bis er selbst ein Stück Erde wurde.— Die Pyramiden.—Mir scheint, ich höre noch die Menschheit schreien, weinen, sterben.—Die Pyramiden sind gebaut von Kraft und Schwäche, von Willen, Kühnheit, Trotz und Schwäche.
Von dem Sphinx reden wir lieber nicht und auch nicht zuviel von den Pyramiden.—Heute noch nicht, vielleicht niemals. Kairo, Museen; zoologischer Garten; Kairo, Spaziergänge außerhalb der Stadt bei den Kalifengräbern in der Totenstadt, die wie eine im Winter verschlossene Sommerfrische aussieht;—Kairo, einsame Spaziergänge im arabischen Viertel außerhalb der Basare; —ja, das ist gut, lebendig, da war ich gern, da war es schön, da werde ich wieder hingehen.—
Wenn Menschen über Kairo oder Konstantinopel— was dann immer Cospoli genannt wird—etwas erzählen, so heißt es immer: „Die Stadt mit ihren Moscheen und ihren Minaretts“. Ich sehe das wie „Die Dame mit ihrem Hündchen“. Warum sagt man auch immer: „Florenz mit seinen Kirchen und Klöstern?“ Ist denn wirklich Florenz ganz in Kirchen und in Klöstern? Ich fand es ganz in noch viel engeren Grenzen. Nun, Kairo mit seinen Moscheen und Minaretts muß durch ein Sieb gelassen werden, aus welchem hoffentlich der größte Teil der Fremdenlockspeisen herausfällt.
In den Moscheen von Kairo trage ich einen Schuppenpanzer, nein, eine Hornhaut, ich kann einfach nicht warm werden; ich weiß auch was es ist, ich kann die moderne Auffassung des Islam nicht schlucken. Die Moscheen sind eigentlich angefüllt mit dem französisch-orientalisierenden Geschmack der achtziger Jahre; die meisten Moscheen sind so renoviert, so eiskalt überarbeitet —und selbst, wenn ich über genug Gegenkraft verfügte, um trotzdem den großen Fanatiker Mohammed und die kleinen Kinder des Korans da herauszufühlen, alles erstirbt in mir unter den lauernden Augen der Führer und Türhüter, der Betenden, die den Okzidentalen innerlich anspeien; ich würde gewiß nie in eine Moschee dringen, während sie von Gläubigen angefüllt ist, wäre ich nicht überzeugt, daß die Leute persönlich gar nicht davon unangenehm berührt sind.— Nur selten trifft man den echten, warmen Gläubigen, der kindlichen Herzens Allah sein Leid klagt. Und wahrhaft im Geiste Mohammeds, einem Asketen ähnlich, mit dürrer Haut auf den Knochen, mit großen, verzückten Augen, die durch Mauern dringen um gen Osten sich festzubohren,—beugen sich diese Treuen in den Staub der Gebetsteppiche. Sie sehen den Fremden nicht, der sich bemühen soll, nicht die magnetischen Wellen zwischen Allah und dem Betenden zu durchkreuzen; aber die übrigen!—Aus verzückten Augen schleicht sich eine ganz unverzückte Neugierde —und noch ganz andere widerwärtige Gesinnungen; wenn auch der Mund im Bart, die Hände in den Ärmeln, der ganze Körper in den Falten des großen Mantels,—und die Stirne im Turban sich heuchlerisch verstecken, die Pupillen unter ihren sie nicht genügend beschützenden gewölbten Lidern und die schnüffelnden Nasenflügel verraten genug, um in mir die bunte, rankende Poesiestimmung des Orients und des islamischen Kults zu unterbinden.—Da nicht,—da unmöglich. Ich sehne mich nach Amon-re, Isis, Osiris und Mut! Ich nehme eine einzige, kleinwinzige Perlmuttermoschee mit schöner Holzarbeit aus und den Hof der grünen Moschee, wo der Brunnen, die alten Bäume und die leuchtenden Rhoduskacheln mir meine Hornhaut langsam abnehmen. Aber das Innere der anderen Moscheen, wie gesagt,—es ging eben nicht, und da helfen keine Ermahnungen, keine Vorstellungen. Kairo ist eine hoffärtige Dame geworden, die sich nicht die geringste Mühe gibt, weil sie sich sagt,—ich gefalle, so wie ich bin—, was brauche ich mich zu ändern. Meine Basare sind ja nicht mehr, was sie zu Zeiten Nur-al-Dins waren, die Geschäftsleute haben fast alle europäische Kassiererbildung; sie spielen Orient, aber sie haben ihre Waren längst mit Buchstaben ausgezeichnet; sie spielen Orient und verkaufen europäische Fabrikate; sie spielen Orient aber man glaubt irgendeinen Rasta vor sich zu haben, für den der Begriff Paris alles bedeutet. Wie sollte es auch anders sein, wie sollte ein echter Basar die täglichen, demoralisierenden Fremdenzüge in zweispännigen Fiakern, die kaum einander ausweichen können, aushalten, ohne zu versuchen, die von den Fremden begehrte Note zu forcieren? Zumal, da der Fremde ohne Unterscheidungsvermögen in der Mehrzahl ist? Zum Glück gibt es aber auch hier unzerstörbare Typen, und die Straßen des arabischen Viertels werden trotzdem eine Bühne mit einem guten Zugstück bleiben, an dem auch der böseste Kritiker seine Freude haben kann.
Einige Straßen sind an sich schon bezaubernd durch die Architektur ihrer Häuser und die lustigen Windungen; herrlich ist manche Moschee von außen, oder ein Straßenende, an dem ein graues Minarett wie ein Ausrufezeichen steht, und die holzvergitterten Haremsfenster, die der männliche Fremde mit Stolz auf arabisch zu benennen weiß, und bei welchen er sich Rehaugen und weißbusige Orientalinnen vorstellt. Die vorübergehenden Einheimischen, wenn es nicht kleine Türken mit rotem Fez, Knopfstiefeln und englischen Anzügen sind, mit zu hellen Westen, tragen wunderbar fallende Gewänder. Das schönste ist die Halshaltung der Männer; gertenschlank sind die Hüften, unerwartet breit die Schultern und flach wie ein Schrank der Rücken, und die Falten fließen kerzengerade daran herunter, während ein feingerundeter Hals sich zwischen Mantel und Turban in freier, zierlich gestreckter Haltung zeigt,— keine Querfalten, keine Fettwülste, keine Kropfansätze verunzieren diese Hälse, die den Rumpf mit dem turbangekrönten Haupt verbinden, wie eine Säule das Dach des Tempels trägt. Die Mäntel zeigen schöne Tabak-oder violette Töne, oder sie sind aus feinfadigem, ewig haltbarem schwarzen Kaschmir.
Die ägyptischen Frauen tragen goldene Fadenspulen auf der Nase, aus denen sich schwarze Schleier über das Gesicht ergießen, die anderen haben den weißen Gesichtsschleier. Beide aber schleifen über den Staub und über den mit Gemüseresten gespickten, feuchten Lehm der Straßen ihre schwarzseidenen oder wollenen Röcke; ich möchte wissen, was damit geschieht, wenn sie vom Staub ausgefranst oder von der feuchten Erde verklebt sind.—
In Kairo dominieren nebeneinander und abwechselnd der Islam, die europäische Unterhaltungssucht und eine bestimmte Art europäischen Verfalls. Das wäre gewiß alles unerträglich, wenn es mir nicht möglich wäre, meine Sinne auf andere Welten einzustellen. Ich suche immer das Ägypten meiner Kindheit, das schöner als alle Märchen noch heute meine Phantasie gefangen hält. Ich bin hierher gereist, weil ich endlich sehen wollte, ob ich auch alles finden werde, wie es sein muß. —Alle Märchenländer zusammen reichen an dieses Land meiner Kindheit nicht heran: Ich wußte, daß es Könige und Königinnen gab, mit schönen Namen, denen nie ein Wunsch unerfüllt blieb, die nie Angst hatten, weil sie gleichzeitig Götter waren.—Tiere gab es, die nie zu arbeiten brauchten, nie getötet wurden, für die mit Ehrfurcht Leckerbissen bereitet, die liebevoll gebettet und gepflegt wurden.——
Ich träumte gern von dem geheimnisvollen Nilstrom, ich wußte oder glaubte, daß das Innere der Pyramiden einen Schacht von unendlicher Tiefe berge,—wirft man einen Stein hinunter, so hört man ihn nicht auffallen —und dann, die beunruhigende Tatsache, daß die alten Ägypter Brot vom Bäcker aßen, und daß Goldschmiede Ketten und Spangen auf das feinste arbeiteten, zu einer Zeit, wo Europa Gott weiß welchen Schlaf schlief. Und ferner die Papyrusstaude: Sie allein hatte es meiner Phantasie angetan; es ging so weit, daß ich im Alter, in welchem Kinder so leicht Wortgewohnheiten annehmen und nur mit Willenskraft sich davon befreien können, nie Papier sagte, sondern immer nur Papyrusstaude. Das ungeduldige Gesicht der Lehrerin kann man sich vorstellen, wenn ich immer wieder sagte: „Fräulein Kurz, ich brauche Papyrusstaude“ und dabei ließ ich jedes s pfeifen und schälte das a, i, u, au schön heraus.
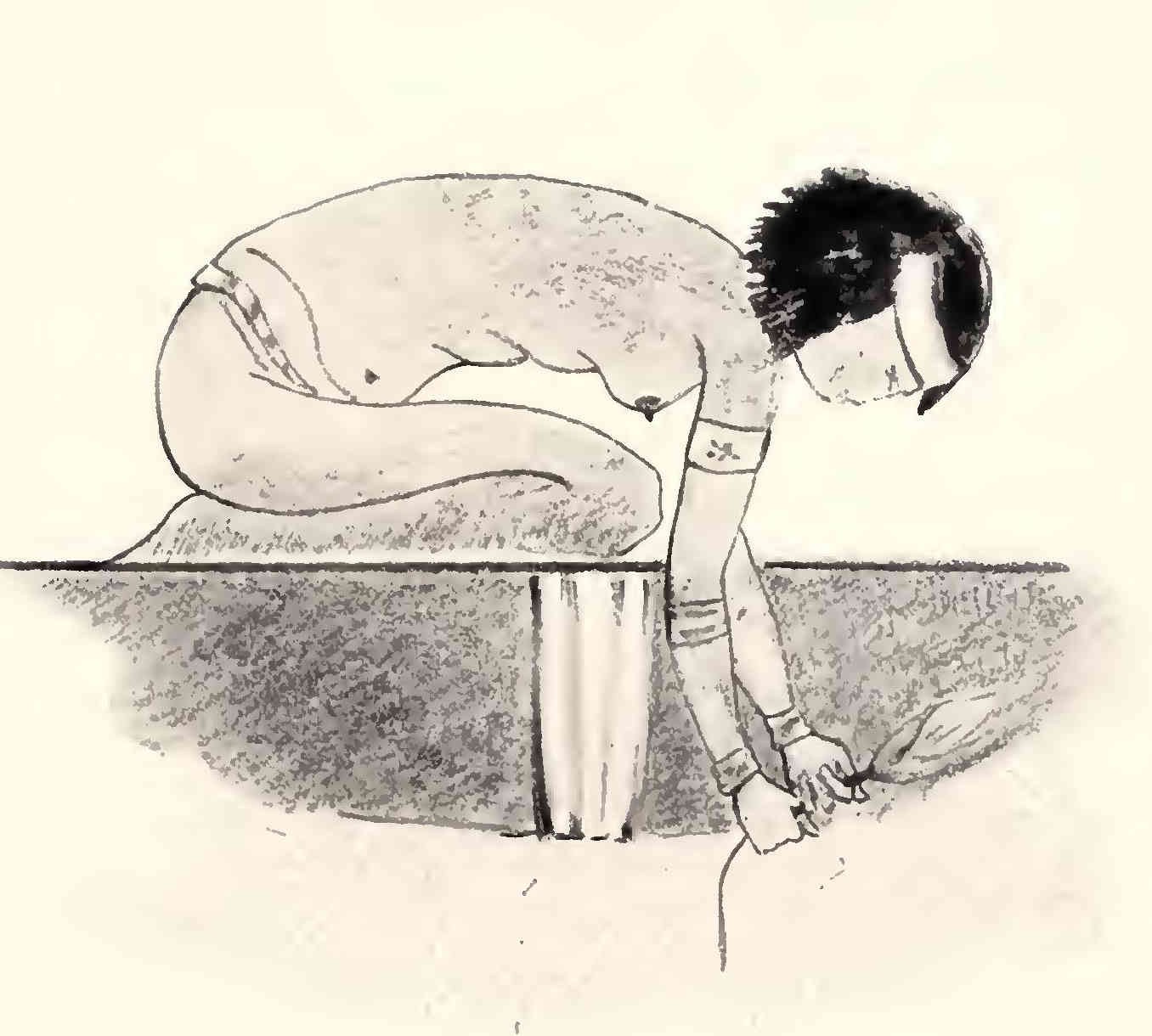
Wandmalerei aus dem Grab des Menne.
„Jetzt hören Sie einmal mit Ihrem Blödsinn auf.— Sie bekommen kein Papier.“
Ich habe den armen Blödsinn bald aufgegeben, da ich Papier notwendig brauchte und mir anders keines verschaffen konnte. Der Weihnachtsvorrat war längst vergriffen, als wir in der Geschichte bei der Papyrusstaude waren.
Von den Wasserträgern, die frisches Wasser oder Limonade anbieten, indem sie mit zwei Messingschalen in einer Hand klappern, will ich nicht viel erzählen. Die frisch gefüllte Ziegenhaut, vom Wasser triefend, steckt prall ihre vier zugesperrten, kurz gehackten Füße in die Luft, der Hals der einstigen Ziege ist auch fest zugebunden und bildet den Hahn dieses tragbaren Brunnens. Daß die Mütter ihre Säuglinge auf einer Schulter reiten lassen, ohne sie zu halten, während sie selbst auf viel zu kurzen, hochstöckeligen Schlappschuhen anmutig in schöner Freiheit der Bewegung schreiten, ist ebenfalls ein allbekanntes Bild. Diese Säuglinge reiten wirklich selbstständig. Aber das alles gehört zum Straßenbild und läßt mich in seiner Besonderheit eigentlich kalt; es ist ganz gleichgültig welches, aber jedes Straßenbild ist für mich schön und mannigfaltig.
Der Reiter steckt in jedem Araber, aber fahren tut er niederträchtig. Das Pferd ist eine Maschine, die er immer auf das Höchstmaß ihres Könnens arbeiten läßt, ohne das geringste Verständnis. Mag sein, daß auch diese Erscheinung der durch unterhaltungslüsterne Fremde demoralisierten Großstadt zu verdanken ist. Es ist auffallend beim Ankommen in Kairo, wie alles, was Pferd, Esel, Maulesel, Kamel ist, frischgemähten Klee bekommt und nichts anderes und das dreimal im Tag. Der Klee liegt am Boden an den Vorderfüßen, er wird den im Schritt gehenden Tieren in das Maul gestopft, er liegt in Ladungen von einigen 150 kg auf den Kamelen verpackt, die ihn vom Lande täglich hereinbringen; es werden die herabfallenden Reste von braunen Buben aufgehoben und neuen Eseln angeboten. Und der Erfolg dieses allgemein verabfolgten Menus meldet sich bei den Tieren ebenso bald wie häufig.
Die Hotels von Kairo sind eines so gut wie das andere. In der Halle, wo siebenzüngige Portiere, wie Ptah und Amon thronen, fällt mir eine Verdoppelung allen Personals auf. Zwei Türöffner in theatralen Gewändern, vier Direktoren, vier Liftboys, ein Dutzend Schwarzer und ebensoviele Dragomans lungern da herum. Im Speisesaal gibt es nur neunstellige Menus, ein Heer von deutschen Kellnern und arabischen, weißgekleideten Jünglingen, die nur gebähtes Brot bringen dürfen, für sonstige Fleißaufgaben werden sie von den Kellnern mit bösen Augen gestraft. Der europäische Diener sieht mit Verachtung auf den arabischen herab, der um ein Bedeutendes natürlicher seinen Dienst verrichtet, als z. B. der übertrieben eifrige, zu familiäre deutsche. In jedem Hotelzimmer ist auf einer Tafel, wenn auch nicht wörtlich, zu lesen: „Liebe Herrschaften, alle Montage, Dienstage, Mittwoche, Donnerstage, Freitage, Samstage und Sonntage ist in einem der Hotels Ball. Bitte hinzukommen; diese Bälle sind zwar alle ohne Ausnahme furchtbar, aber sie bringen uns das nötige Geld, was trotz der Räuberpreise der Zimmer in ungenügender Menge fließt.“
Die Spekulation liegt auf der Hand. Sie beruht darauf, daß der Fremde, der den Orient bereist, und aus dessen Dummheit schon manches Vermögen gemacht wurde, in seinem Herzen gar zu gerne einiges von dem ihm geläufigen Begriff „Orientalische Pracht“ vor seinen Augen verwirklicht sehen möchte. Das ist ein ganz runder, farbiger, saftiger Begriff, etwas vage, aber immerhin. Dann kommt der Begriff der „Schönen Fremden“ hinzu, Russin, Französin, Amerikanerin, Engländerin vermischt mit Vollmond, Palmen, Parfüm, Reichtum, Diamanten.——
Die Frau, die sich das sinnig in der Nähe des Waschtischs angebrachte Täfelchen ansieht, erwägt ihre Möglichkeiten zu glänzen, exotischen Bewunderern zu begegnen. Der Zimmerkellner rühmt das jeweilige Ballfest des Tages und Hotels, namentlich wenn es sich um ein Kostümfest handelt.—Die Begriffe Odalisken, Harîm, Perlenketten, gestickte Schuhe, Schleier, Augen folgen sich wie auf einem Kinofilm, so verlockend, daß nur wenige widerstehen können.
Einmal, als unser Hotel seinen Balltag hatte, konnte auch ich dem Wunsche, mir das ein wenig anzusehen, nicht widerstehen. Schon das Diner um 8½ Uhr sah anders aus als gewöhnlich. Mehr Tische, mehr Kellner, weniger Platz. Ganz neue Menschen, Gäste anderer Hotels sitzen in Frack und Balltoilette vor schwach gefüllten Tellern und auf den Tischen liegen geschlossene und offene Hände,—Hände, die fast ganz natürlich sind, weil sie nicht annehmen, daß sie beobachtet werden, und daß sie auch ihrer Offenherzigkeit wegen beobachtenswert sind. Englische Offiziere in Zivil, mit den Gesichtern, die man aus englischen Illustrierten kennt, blicken ihren Nachbarinnen tief in die Augen. Gott, immer noch! Es ist so lange her, daß ich Tauchnitz Edition in Händen hatte.—Hier sind sie alle „the tall men with dark wavy hair“—, deren Augenbrauen und Größenmaß beschrieben wurde, obwohl es so wenig zur Charakterisierung half ... und alle haben sie das ohne Übertreibung gepflegte Äußere, auf das die Autoren solchen Wert legen. Ältere und jüngere Damen füllen die Zwischenräume in angenehmer Buntheit aus. Alle haben das eine Bestreben, der Tafelmusik durch konsequentes Reden Herr zu werden; keiner ruht sich aus; keiner ißt ein Stückchen Brot; das, was man dem Munde schenken wollte, wird in den Fingern gehalten, während jener den perlenden Redeschwall herauszugeben hat. Steine blitzen, Phantasieschmuck, ebensowenig Phantasie als Schmuck, und echte Perlen liegen auf weißem Fleisch—und alle Frisuren verraten Mühe, Zweifel, Unselbständigkeit. Hier sitzt eine Dame, von der ich weiß, daß sie um 5 Uhr nachmittags schon mit Anziehen begonnen hat; in nächster Nähe sitzt eine, die mit zwei Dragomans ausfährt. Nicht allzuweit von unserem Tisch schäkert rein schematisch ohne jede innere Lustigkeit—woher sie auch nehmen!—eine große Dame, die niemals ihren Körper in die Wanne taucht, sondern täglich von der Zofe mit Fett aus zahllosen Tiegeln „gewaschen“ wird.
Am Nebentisch ist ein hiesiger Prinz gepflanzt, schwer, fett, jung, an welchem außer seinem Schmuck die Nägel, die Augen, die Zähne glänzen. Unangenehm matt ist nur die Stirne zu nennen. Er prangt inmitten von Sekretären und offiziellen Begleitern und verschlingt fast ebenso gierig mit den Augen wie mit dem Munde. Es ist erfreulich, zu konstatieren, wie die geheimsten Abweichungen im Beobachten koranischer Disziplin die Frevler mit Korpulenz bestrafen. Hier gibt es übrigens eine Anzahl von stattlichen Damen aus Europa, die vielleicht von Marienbad allein übertroffen wird.
Ich denke daran, wie Herodot so hübsch erzählt, daß bei den Gelagen der alten Ägypter, wenn die Stimmung auf das Höchste gestiegen war, ein Mann ein in Holz geschnitztes, mehrere Ellen hohes Menschengerippe herumreichte, mit dem ermunternden Bemerken: „Dies sieh dir an! und freue dich, trinke und genieße, da du nicht bist wie der!“
Ich staune auch über die geringe Zahl der ganz jungen Damen; manche haben schöne Augen; aber was ist ein schönes Auge bei solchen Mündern! Ich sehe mich um nach einem möglichen, nach einem ruhigen, guten, klugen, freundlichen, glücklichen Mund. Es ist keiner da; vielleicht habe ich auf der Fahrt zum oberen Nil zu schöne Münder gesehen und kann diese herausfordernden, hungrigen, häßlich lachenden, nicht mehr ertragen.——
Die Musik macht verzweifelte Anstrengungen. Man sieht nur die Arme der Geiger, die sich auf und nieder bewegen. Wie muß ihnen heiß sein von dem Gesummse und von dem krampfhaften Spiel, das sie selbst nicht hören können. Die Musikanten werden nachher bis um 1 Uhr in einen tolleren Lärm hineinspielen. Ob sich für sie die Seereise lohnen wird, die sie vielleicht zum erstenmal mit einer vagen Glückshoffnung angetreten haben?
In der Halle steht man Körper an Körper und kennt sich gegenseitig nicht. Ich lasse mich auch irgendwo hinzwängen. Die Hälse recken sich alle, und ich besehe mir interessiert aus nächster Nähe Haaranwuchs und Korn der Haut. Die Herren rauchen alle irgendwo, und die sich gegenseitig unbekannten Russinnen, Amerikanerinnen, Deutschen und alle anderen fühlen die Zwecklosigkeit ihres Daseins als eine bedrückende Tatsache. Ich will jetzt eine gute Linie, eine gute Bewegung suchen, und wäre sie bloß in einem schönen Fluß der Haare zu finden; aber ich suche vergebens. Und was hälfe es? Gegen die Trivialität der Münder ist ja nichts zu wollen. Horchen wir etwas, die Stimmen sind ja laut genug.
„Meine Liebe, je suis une fouilleuse d’âmes, hier gibt es Leidenschaften; dieses Klima bringt es mit sich.“ (Mein Gott, das bißchen Staub, den der Wind einem in die Augen jagt ... so blind macht er niemand.)
„Der junge G. ist ein bezaubernder Mann. Ein Schatz ist er.“
„Wie begehrenswert sieht doch heute wieder Mrs. S. S. aus.“
Ich folge dem Blick. Mrs. S. S. ist braun gekocht, hat überhitzte Augen, trägt Fransen von gefärbtem Mahagonihaar über die Augenbrauen einer Brünetten, schiebt den Mund in drei rhythmisch sich folgenden Bewegungen über gut gepflegte Zähne—na ja, natürlich! —und das dumme, heiße Gesicht sagt deutlich: „Ich weiß alles, ich verspreche alles und bin eine Falle für Trottel.“ Sie ist natürlich schlank und trägt natürlich ein Kleid, das niemals für sie erfunden worden ist. Sie trägt es, und die große Dicke da drüben, mit zu schweren Ohrläppchen, trägt ein ähnliches, und alle stecken sie in hohen Schuhen, die sie falsch ausfüllen, nirgends hängt eine gute Menschenhand, und über allem liegt 3 cm dick der Schein und die Lüge.—Es gibt doch so schöne Menschen, so viel schöne Menschen ....
Jetzt beginnt das Orchester einen schmierigen, die Eingeweide rührenden Walzer. Daß er die Gesellschaft ernst stimmen würde, war ja zu erwarten. „Ach ja, der ist so wundervoll.“ Stiergefechtsmusik,— Stiergefechtspublikum. Morgen gehe ich in den Zoologischen; da ist doch wenigstens Manigfaltigkeit und Abwechselung in den Tieren.
Am Eingang steht ein Kellner. Bevor er hier war, diente er vielleicht als Kellner für den Kuriertisch, vorher als Laufbursche, nach der Schulbubenzeit auf dem Dorfe. Sein Vater war vielleicht Gärtner. Der Kellner steht an der Türe und glaubt, daß das die Welt ist, die vor ihm wirbelt.—
Man schämt sich in der Gesellschaft; ich schleiche leise, leise fort, schwimme wie ein Huchen durch die warmen Menschen hindurch und überlasse diese Welt den Kellnern.

Tänzerinnen aus einem Felsengrab in Tel-el-Amarna.
Ich habe mehrere Stunden vor mir und weiß vor Freude nicht, was und wo anfangen. Ich bin im ägyptischen Museum; ich kenne mich ziemlich gut aus, weiß, wo meine Lieblinge stehen. Ich grüße den grünen Chefren im Vorbeigehen—„ich komme schon zurück zu dir, muß mir meinen Alabasterkönig ansehen“.
Herrgott, daß der so schön ist, hatte ich ja ganz vergessen. Am Munde leuchtet der Alabaster wie von innen heraus, die Lippen leuchten sich gegenseitig mit einem Licht an, als steckte in dem Kopfe eine Lampe, breit sind die Backenknochen, die Augenbrauen tief eingefurcht bis zu den Schläfen, ebenso sind die Augen vollkommen ausgehöhlt und beide, Augen und Brauen, sind schwarz gemalt. Der Kopf ruht über mächtigen, fast hochgezogenen Schultern. Eine ganz unheimliche Zusammenstellung ergibt der mattleuchtende Mund, darunter das kleine, runde Kinn zu den kalten, schwarzen, pupillenlosen, schmalen Augenschlitzen mit den langen Pierrettenbrauen.—Das Schädeldach fehlt.—Starr, wie in Verzückung, wie eine Somnambule, wie ein Märtyrer, wie ein Seliger, wie ein Träumender lächelt dieser Alabasterkopf einer Zukunft entgegen.—Ist es Sethos I. oder ist es Hatschepsowet, ist es ein Gott, ein Gedanke? Niemand kann es sagen.—Sethos sagt man.—
Der Alabaster ist goldrosa, warm. Unterschenkel und Hände fehlen. Er gleicht ... ja, soll ich es sagen? Er gleicht zwei Mädchen, die ich in meiner Kindheit gekannt: Franziska D. und Zdenka A. Sie hatten beide eine Alabasterhaut, breite Backenknochen, schmale, langgeschlitzte Augen und einen großen, schönen, reinen, breithingerollten Mund, der auch so süß, so gesund lächeln könnte.
Im gleichen Saal ist der kolossale Kopf Ramses’ II. in meisterhafter Ausführung. Die Stilisierung des Mundes ist hier eine der schönsten des tausendfach porträtierten Königs. In dem Gang in der Nähe dieses Saales ist ein auch überlebensgroßer Kopf aus rosa Granit, der einen speziellen Zauber auf mich ausübt. Die Augen liegen tief unter schweren Brauen. Die Pupillen sind vom Augendeckel an nach innen abgeflacht, so daß sie sehr dunkel und tief aussehen; um den Mund liegen Schatten, die kaum plastisch angedeutet sind, aber ihm einen rätselhaften Ausdruck verleihen, als wollte er weinen. Von der Seite gesehen verschwindet das, und ich sehe nur ein strenges, undurchsichtiges Menschenprofil. Und da in der Nähe steht die Kuh Hathor, deren leeren Stall ich in Hatschepsowets Tempel am Fuß der Berge besucht habe.
Ich stehe vor Prinz Ra-hotep und Nofret, seiner Gemahlin. Ich weiß nichts von ihnen. Othello und Desdemona.—Ich weiß nicht, wann die beiden lebten, es heißt von ihnen nur, Ende der III. Dynastie, also etwa 2600 v. Chr. Memphis.—Sie sind so, wie sie da unter Glas stehen, in einem Grab gefunden worden. —Es ist märchenhaft, daß diese Weiße des feinen Tuchs, in das sich Nofret eng einhüllt, in solcher Intaktheit sich halten konnte; daß ihr hellgelbes Gesicht mit der spitzen, gebogenen Nase, deren gespannte Flügel zu beben scheinen, nicht vorgestern im Kalkstein gehauen und gemalt wurde. Sie sitzen beide abgesondert voneinander auf einfachen Sitzmauern mit Lehne, unter einem Glasschrank, um welchen ich staunend gehe, um mir so nah wie möglich die beiden Figuren im Profil zu besehen. Sie haben echte Augen, d. h. in Elfenbein schwarz eingelegte, goldbraune Glassteine oder Topase; Ra-hotep ist dunkelbraun, wie die heutigen Nubier oder Araber. Seine Rechte hält er auf die linke Brust, die linke Faust ruht auf dem linken Knie. Oberkörper und Beine sind nicht bekleidet. Er hat das Haupt etwas erhoben, etwas nach rechts gehalten und blickt in weite Fernen mit zusammengepreßten Lippen, ängstlich und von einem peinigenden Gefühl beseelt, von einer rückhaltlosen Hingebung— Othello.—Seine Gattin, weniger konzentriert, zeigt eine leicht spöttische Note in ihren großen, dunkelgoldenen Augen; die fein gemalten Brauen verstärken den Ausdruck von leisem Sarkasmus, denn sie heben sich am Ende in lustiger Schweifung dicht unter das gescheitelte, schwarze Haar. Sie trägt über ihrem eigenen Haar eine mächtige Mähnenperücke von Tausend Zöpflein, die in Kinnhöhe gerade abgeschnitten sind. Ellenbogen, Brust, Arme, Beine, fast bis zum Knöchel, ihr ganzer Körper ist straff in eine Art einfachem Bettuch gehüllt. Der Körper zeichnet sich durch den Schal. Die Oberschenkel schwellen leicht an, von weißem Tuch umspannt, so daß der Körper wie in weißem Trikot erscheint. Nofret ist keine rechte Desdemona. Sie weiß zu viel über sich selbst und andere, und vergißt ihr Wissen niemals, ist unfähig, naiv-leidenschaftlich einem Manne oder geduldig-gläubig einem Schmerz zu begegnen ...
Ra-hotep ist breitschultrig mit gut entwickelten Muskeln, etwas untersetzt. Das Haar ist kurz geschoren. Er zeigt keine Attribute irgendwelcher Macht, ist ein Mensch wie Menschen sind; die Stirne kraust er in schwerem Denken; die Nase ist schlank, schmal, mit spitzem Ende, keineswegs eine Ramsesnase. Einen kleinen, schwarzen Schnurrbart hat er sich auf der Oberlippe stehen lassen, wie ein Lehrling.—So ausdrucksvoll der Kopf, der Rumpf und die Füße sind, so plump sind Hände und Unterschenkel, allein um so erschütternder wirkt dieser einfache, braune Mann mit den Sonnenaugen, der so aller Welt preisgegeben im Glasschrank thront, nachdem er fast 5000 Jahre in der Finsternis seines Grabes mit der geliebten, fremden, weissen Frau gehaust hatte.
Schätze gibt es in diesen Hallen, man kann nie genug bekommen. Ich gehe von einer Schönheit zur andern, nicht weil ich mit der ersten fertig bin, sondern, weil ich nicht ewig vor der gleichen Sache stehen kann; das Leben ist so kurz, der Tod kommt, und ich habe nicht alles gesehen.—Eine einzige Skulptur genügte hier, sie allein könnte ein Leben lang sprechen. Ich sehe Frauen, die Lotosblumen halten, und in ihrer Mitte einen Mann, eine Art reinen Tor, Frauen, die ernst wie ein Schicksal einen Mann in ihrer Mitte führen, ihn je an einem Arme haltend, Göttinnen wohl, die den Blinden lieben; und alle drei holen zu einem Riesenschritt aus—und bleiben ewig an dem gleichen Fleck stehen, ohne etwas von der klaren Starrheit in ihrem Auge einzubüßen. Ewig gehen sie so fort, ohne vorwärts zu kommen,—der Mann, der blinde König, den zwei Göttinnen führen. Mir sagte jemand, die alten Ägypter seien nur gute Arbeiter gewesen, nie hätte es unter ihren Bildhauern ein Genie gegeben. Hallo! das war Wasser auf meine Mühle, Öl in mein Feuer, Feuer in mein Dynamit. Sie hätten nicht die, meinetwegen unbewußte, Passion für das Schöne gehabt? Die Naturtreue sei bloß ein Erfolg der peinlichen Handwerkerarbeit? Die Naturtreue kann überhaupt nicht ohne eine sinnliche Freude an der momentanen Ausführung erreicht werden, und die Freude daran ist ein schon vor der Arbeit, vor der Handwerkskunst vorhandener Zustand—und auf den Zustand kommt es an. Es ist wie mit der Schrift. Der eine gute Schrift hat, empfindet schon im Moment des Schreibens eine sinnliche Freude daran; das ist nicht reine Technikfreude, sondern ein immer vorhandenes Bedürfnis, sich an die der Natur abgewonnenen Erfahrungen in verklärter, geheimnisvoller Form selbst im Hinmalen der Buchstaben zu erinnern.
Ich lungere herum, beglückt, daß nur wenige Fremde mit mir lungern. Ich habe Sarkophage hier stehen, die mir gehören, mir allein. An dem einen, der aussieht wie rauhgehaltener Untersberger Marmor, sind die herrlichsten, kameenfeinen Miniaturreliefs, die man sich denken kann. Wie fein die Nasenbeine sich von der Nasenwand abheben! In wieviel Stufen die Lippen sich aneinanderlegen! Wie gut der Backenknochen unter der straffen Wange fühlbar ist!—Eine kniende Figur rudert auf einem schmalen Kahn, der Totenbarke wohl, und mit ihr ein Reiher oder Ibis, und vorne am Bug hockt eine Eule, wie angeklebt an ihrem Flaum. Rückwärts steht eine Figur mit erhobenen Händen. Jeden Meißelstrich sieht man. Die Form ist wie mit scharfen Besen gekehrt. Diesem Sarkophag gegenüber ist ein ebenso schöner in schwarzem Granit. Auch da sind feinste Reliefs zu sehen. Frauenkörper und Frauenantlitze von bezauberndster Schönheit. Sie haben alle spitze, feinknorpelige Nasen, etwas vorgebaute Augen und Münder, an denen der obere Rand der Lippe wie ein kleiner Saum das Lippenrot umgibt. Ich sitze auf meinem Feldstuhl, den Bleistift in der Hand, aber zum Zeichnen komme ich kaum vor lauter Schauen.
Bei den Mumien war ich oft.—Ramses, was hat man aus dir gemacht? Wo ist der Zauber deines Lächelns? Nicht daß jetzt der Zauber geschwunden wäre. Er liegt nur an anderer Stelle, oberhalb der Augen auf der wunderbar feinen Schädellinie, die zur Nase herabführt. Tief in den Höhlen liegen die geschlossenen, leeren Augendeckel; es gab eine Zeit, da schlugen diese Deckel über dunklen Augen ihre Flügel auf und zu, wie Schmetterlinge—und in diesen jetzt stofflich gewordenen Haaren war Glanz, Leben; ein Diener durfte sie täglich salben.—
Kein Zauberwort kann den König mehr aus diesem Glasschrank erlösen. Ich möchte ihm die Spannung der Kiefer und der Wangen nehmen, ich möchte ihn bequemer betten; ich sehe mich selbst so liegen. Wie klein würde mein Gesicht werden, meine große Stirne würde als einzige nicht schrumpfen, und meine Zähne würden den Mund halten, aber der Rest würde wie eine gedörrte Zwetschge halb verschwinden; ein Stecknadelkopf auf breiten Schultern.
Schön ist Ramses’ Vater, Sethos der Alabasterkönig. Die breiten, wülstigen Lippen haben etwas Lebendes; —fast erkenne ich daran das Leuchten des Alabastermannes. Am besten erhalten ist die Mumie des alten Ju’e, Großvater mütterlicherseits von Ech-en-Aton. Der Alte, für den ich in mir die Gefühle einer Enkelin entdecke, liegt da mit hochgehaltenen Händen, an denen lange, gelbbraune Nägel gewachsen sind. Wie von Rauchern sind diese Hände. Er muß ein schöner, alter Herr gewesen sein; seine gelbweißen Locken ringeln sich dicht bis zur Stirne. Sein Stoppelbart ist ihm noch im Tode nachgewachsen. Sein gutmütiger, breiter Mund und das hohe Nasenbein, die Steinwülste oberhalb der Augenbrauen, die abstehenden Ohren geben ihm etwas so charakteristisch alt-Herrenhaftes, daß man wähnt, er müsse gleich aufstehen und gegen gewisse Neuerungen predigen, die er nicht mehr mitmachen kann. Er muß ein guter Großvater für Ech-en-Aton gewesen sein, denn ich kann mir denken, wie stolz er auf seine kluge, begabte Tochter war. Weigall sagt in seinem schönen Buch über Ech-en-Aton, von diesem Großvater,—er hätte das Gesicht eines Geistlichen gehabt, und seine Mumie erinnerte um den Mund an Papst Leo XIII. In seinen wohlerhaltenen Zügen erkennt man vielleicht den Urvater der religiösen Bewegung, die durch die Tochter Tyi und den Enkel in Ausführung gebracht worden ist.

Kleines Profil aus Glasmasse,
Im Besitz der Verfasserin.
Eine kleine, magere, recht hilflos aussehende, gelbe Frauenmumie, die sich halb in Weinen, halb in Lachen windet und aus dem schief vertrockneten Mund tadellose Zähne zeigt, zieht die meisten Fremden an. Sie sieht recht arm und verlassen aus und als hätte man ihr übel mitgespielt. Ihr armer, kleiner, leerer Leib ist zugenäht, die schwachen Hüftknochen starren unter der Lederhaut hervor, ihr Mund ist ganz zur Seite gekehrt, als wäre ihr Tod ein einziger Schrei gewesen. Ich kann nicht verstehen, durch welchen Vorgang die Lippen sich derartig weggezogen und wie es kam, daß die Kiefer sich so verzerrt haben, wie ausgehängt.— Und jetzt stehe ich am Sarg einer Königin, die im Kindbett starb. Ihr kleines Töchterlein ruht neben ihr. Wer hat um beide geweint? Wer hat sie liebevoll gebettet?
In dem Sarge Amenophis I. liegen Blumen, ich erkenne deutlich fettstielige Wasserblumen,—Nilblumen. Die Kelche sind zu, umgedreht wie Mohnblüten, und eine naseweise tausendjährige Wespe liegt mitten darin. Ein Sonnenstrahl, der eben hereinleuchtet, kann da keine Farbe mehr hervorzaubern. Die Blüten sind einen Ton dunkler wie die Stiele; aber alles ist ziemlich von derselben Farbe wie die Mumie. Diese armen Könige ...
Ein einfaches Sandgrab hätte ihnen mehr Ruhe gebracht als die Felsengrüfte, die von Priestern und Gesindel vergewaltigt worden sind, bis daß man ihnen in Dêr-el-Bachri endlich etwas Ruhe versprechen konnte. Nun werden sie wohl ewig in Frieden liegen; aber was für Augen müssen sie über sich ergehen lassen.——
Der Besuch der Mumien bildet eine Feiertagsbelustigung.
In dem ersten Stock des Museums ist eine reiche Sammlung des herrlichsten Frauenschmuckes aus Gold und glasierten, feinsten Tonfigürchen, von Gebrauchsgegenständen der Alten, Geräten, Speisen, Broten aus den Totenkammern und Kleinplastik. Ich komme alle Tage hierher, wenn ich nicht in das arabische Museum gehe, wo die herrlichsten Gläser, Fayencen und Holzarbeiten mich festhalten. Hier ist noch eine wunderbare Alabaster-Canope für mich, aus Ech-en-Atons Grab, worin seine Eingeweide versenkt wurden. Der Deckel ist ein Kopf, der des Königs idealisierte Züge trägt. Ein wunderliebes Menschengesicht!
Wir haben nur wenige Tage noch in Kairo und werden Alexandrien auf einem rumänischen Schiff verlassen.
Heute fahren wir zum größten Friedhof der Welt. An den Pyramiden von Gîze, wohin uns das Auto brachte, erwarten uns Esel. Wo ist mein Arîs aus Luksor, mein weißer, starker Rennesel? Die hiesigen sind übermüdet. Des Morgens, wenn sie sich erheben, haben sie noch die Parforcetour des vergangenen Tages in den Knochen.
Wir wollen nicht zu lange an den Pyramiden und beim Sphinx verweilen; wir sind, wie unser Begleiter sagt, heute nicht zum Vergnügen hier. Aber ich muß es wiederholen, der Montblanc ist nichts, überhaupt ist nichts etwas.—Wenn ich ganz nah hintrete, habe ich die Empfindung, die Pyramide nimmt mir drei Himmelsrichtungen weg, so unermeßlich lang erscheint eine Seite. Die Quader, die über einen Kubikmeter groß sind, liegen übereinander getürmt wie Felsenriffe am Meer; und ich muß meinen Kopf weit in den Nacken beugen, um die Spitze sehen zu können.— Menschenweh und Menschenmacht.—
Jeder mußte für die Sicherheit seiner ewigen Seligkeit sorgen—wem es nicht vergönnt war, seinen Leib diebessicher für alle Zeiten zu umschließen, der hatte sein Leben lang ein banges Gefühl.—Allein, die Pyramiden waren zu auffallend, als daß nicht Frevler aus Habgier versucht hätten, gleichgültige, tote Könige in ihrer Freude zu stören.
„Wollen Skarab koofen?“ berliniert ein Araber, der ein paar bunte Käferlein und einen kleinen Ptah zu verkaufen wünscht. Fort! wir wollen das Totenfeld von Sakkâra erreichen. Wir reiten auf schmalen Wegen, die die menschlichen Sohlen bauen, an Dörfern vorbei, aus denen es bitter würzig riecht. In einem Hof liegt ein verendetes Kamel mit einem endlosen Fellbein in der Luft, während die Hunde aus weitem Umkreis sich unter den Rippen eine freßbare Höhle graben.— Die Gegend ist lieblich. Ein Wasserarm umschließt hier eine Art Insel, auf welche Hütten aus ungebrannten Ziegeln sich malerisch hingehockt haben. Schiffe schlafen auf dem Wasser.—Wir treten auf glänzendes, duftendes Gras. Fette Felder strotzen von Saaten. Vor uns steht eine schöne, melancholische Burne Jones-Kuh, der man einen jungen Stier zuführt.
Wir besuchen einen von der Deutschen Orientgesellschaft ausgegrabenen Tempel, dessen Grundrisse deutlich erkennbar sind, und in dessen Schutt noch leuchtend blaue Tonglasurstücke von zerschmetterten Kunstwerken erzählen.
Die Sonne brennt, aber der Wüstenwind erfrischt.
Wir sind auf dem Totenfeld von Sakkâra; in nächster Nähe vom Memphis, dem heutigen Mît Rahîne.
Die Wohnung der Toten hat die der Lebenden überdauert. —
Der Sand hat die vormals freistehenden Totengebäude derartig bedeckt, daß sie heute unterirdisch genannt werden müssen. Die Wüste zeigt, soweit mein Auge reicht, große Maulwurfshügel, welche ebensoviele Grabstätten bedeuten. Wird man noch herrlichere aufdecken, als die Mastaba des Ti, der in der V. Dynastie als kgl. Oberbaumeister lebte? Soviel ich weiß, soll im Herbst ein spezielles Werk über die einzig schönen Bildnisse mit Photographien erscheinen. Mich rühren die Szenen aus dem häuslichen Leben eines Ägypters der damaligen Zeit, deren Fortsetzung er sich für sein zweites Leben wünscht, das er als einen mächtigen, nie endenden Orgelpunkt des ersten sieht. Ti besaß Herden, wie uns die Bilder zeigen. Sie wurden wie die heutigen Viehherden zur Kühlung durchs Wasser getrieben, voran ein Mann, der ein unmündiges Kälbchen auf den Schultern trägt. Die vorletzte Kuh, seine Mutter, schreit ihm sehnsüchtig nach, während das kleine Kalb mit erhobenem Schweif sich den Hals nach der Alten ausreckt. Ganze Reihen von Pächterinnen bringen Lämmer, Früchte, Vögel als Opfergaben.
Feinere Reliefs in Farben habe ich nicht gesehen. Mich, der ich in der 30000. Dynastie lebe, wirft die Freigebigkeit, der Mangel an Eitelkeit dieser Menschen um.—Hier, wie in den Königsgräbern von Theben, der lieben Hunderttorigen, galt es Schönheit, Kostbarkeit wegzuwerfen, einzugraben.—Zwar, solange man lebte, konnte man, falls sie fertig war, seine künftige Totenwohnung stolz zeigen, aber dann, wenn die Tore vermauert, wenn kein Sonnenstrahl mit den bunten Farben kosen, wenn kein Freund, kein Nachkomme mehr mit Bewunderung und Neid die Werke bestaunen durfte? Ja, das war eine wahrhaft vornehme Art Schönes zu tun.——
So wie der „Christ“ das Gute, so tat der „Heide“ das Schöne.—Niemand wußte mehr davon.
Alle Handwerke und die Bebauung der Felder sind hier veranschaulicht in kleinem Maßstab und von unbeschreiblich feiner Ausführung. Hier hockt ein Mann, seine Beschäftigung ist mir nicht ganz klar, aber eines weiß ich, sein Körper ist herrlich durchgeführt. Mit den Armen umschließt er die hochgehobenen Knie und arbeitet an einem Werkzeug mit aufmerksamster Beobachtung,—eine Momentaufnahme, wie sie ein Kodak nicht treffender wiedergeben könnte. Ähnlich fein sind die Reliefs in Hatschepsowets Tempel, aus dem Anfang der XVIII. Dynastie,—man hatte also nichts Neues gelernt seit der fünften.——
Eine beladene Eselin, deren kleines Euter liebevoll in Spitzen beigefügt ist, darf ihr Junges auf ihre Tagesarbeit mitnehmen. Sie trägt die müden Ohren nach unten; das Junge aber hält sie noch in Fröhlichkeit hoch und nach vorne zugespitzt.
Zu Tis Zeiten stopfte man nicht nur die Gänse, sondern auch die Kraniche, die sich bequem, fast in Manneshöhe an den langen Hälsen halten ließen, während der Mann, der die Gänse stopft, sich dazu auf den Boden kauern muß.
Ti fährt mit dem steif nach vorne gebauschten Schurz durch Papyrusdschungeln auf seinem kleinen Nachen, während sich die Papyrusblüten oben unter der Last der Vogelnester krümmen. Böse, langschweifige Katzen schleichen auf den Stielen hinauf, während die Vögel ihre dumm dasitzenden Jungen verteidigen. Die kleinen Vögel sind so gut dick, mit zu kurzen Flügeln gemacht. Ti aber fährt über Fische hinweg und über junge Nilpferde, die wie Schweine aussehen.
Die Mastaba des Mereruka, eines hohen Würdenträgers, liegt auch unter der Erde. Viele Kammern, Gänge machen sein Totenhaus zu einer geräumigen Villa. Plötzlich stehen wir dem Toten gegenüber, der, aus der Mauer kommend, nur ein Paar Stufen herabzugehen braucht, um uns selbst durch seine Wohnung zu führen. Seine Augen leuchten schwarz auf weiß, seine Haare stehen weit ab, sein orangebrauner, starker Körper, mit Hünenschultern, steckt wie alle Männer dieser Zeit in einem blendend weißen Röckchen, das ein Luftzug nach vorne zu blähen scheint. Mich fesselt eine hübsche Gruppe von tanzenden Mädchen. Die Mittlere breitet beide Arme aus und zwei andere hängen sich an die Hände, indem sie beide Arme so weit wie möglich nebeneinander von sich strecken und die dargebotene Hand halten. Ihre Füße aber stützen sie an die Beine der in der Mitte Stehenden und beugen sich mit dem Oberkörper soweit als möglich nach rückwärts.
In Mariettes Haus aßen wir von unseren mitgenommenen Vorräten, während die guten Esel sich im Sande etwas ausschliefen. Als ich fertig gegessen hatte, setzte ich mich zu ihnen in den warmen Sand. Sie glotzten auf den Boden, wedelten in vollkommener Geistesabwesenheit nicht vorhandene Fliegen ab und hielten die Augen halb zu und die Ohren nach unten, wie Frauen ihre unaufgesteckten Zöpfe.—

Der Alabasterkönig.
Kairo, Museum.
Der Heimweg führt durch den Palmenwald im tiefen Staub, ich weiß, daß wir über die alte Stadt Memphis geritten sind. Alte rissige Palmen wiegen sich im Wind, schwarze Kinder hocken im Staub und graben ihre Füße ein. Unsere Esel wirbeln den Sand auf und brechen gelegentlich zusammen, weil sie nie einen Tag Ruhepause haben dürfen. Heute noch werden sie den ganzen Weg mit den Eselbuben von der Station Bedraschên an den Pyramiden von Sakkâra vorbei zu denen von Gîze zurückgehen müssen. Es trottet sich bequem auf ihnen, und meine Gedanken machen den kleinen Rhythmus mit, ich denke fast in Reimen, breche eine Sache ab, weil der Esel langsamer ging, und kann erst wieder meinen Gedankengang beschleunigen, wenn das Eselchen seine Hufe rollen läßt. Ich habe heute viel aufgenommen. Wir waren zwar nicht zum Vergnügen dagewesen, aber ich kann nicht sagen, daß ich nicht vergnügt gewesen wäre. Unter der Erde in hohen finsteren, fast luftlosen Hallen, in den Katakomben für Stiere bin ich gewesen. Die heiligen Apisstiere ... Ich weiß nicht, mußten sie weiß sein mit einem schwarzen Stern auf der Stirne oder umgekehrt, sicher ist, daß auf einer Seite die weiß in schwarz gezeichnete Mondsichel erforderlich war, und daß ein Sonnenstrahl die Mutter befruchtet hatte. Dieser heilige Stier, von einer Färse geboren, muß ein herrliches Leben geführt haben, will man aus der Kostbarkeit seines Begräbnisses schließen. Es fiel den Priestern wohl schwer, den richtigen Stier aufzutreiben. Welches Glück für den einfachen Landmann, wenn ihm das entsprechende Kalb zum künftigen Apis unverhofft geboren ward, er half auch wohl mit den entsprechenden schwarzen Dreiecken nach und ich nehme an, daß eine allgemeine Konkurrenz für die Beschaffung des Apis sich unangenehm fühlbar gemacht hat.
Wir schleichen durch den hohen Gang, in welchem Viererzüge sich bequem ausweichen könnten. Wir halten flackernde Kerzenlichter, und wir wissen, daß wir, wenn diese ausgehen sollten, niemals allein zum Tageslicht zurückfinden können. Zum Glück begegnet man gewöhnlich einer Kolonne von anderen Besuchern, was sich recht mitternächtlich ausnimmt, namentlich, wenn beide schweigend mit flackernden Lichtstümpfen aneinander vorüber ziehen. Man glaubt selbst an irgendwelchem eigentümlichen Kult beteiligt zu sein. Die Wände sind schmucklos, steinern, roh herabgehämmert. Plötzlich gähnt uns statt der Wand eine tiefe Kammer an, wir halten die Lichter hin und diese erscheinen doppelt, im Spiegel eines gewaltigen Sarkophages ... und darin haben sie einen toten Stier hineingelegt ... Einen toten Stier?
Vierundsechzig solche Kammern folgen sich und ebenso viele glänzende Sarkophage. Für den Besuch sind einige von Schutt und Mauern befreit worden.
Die Gefangenen, die ein siegreicher Krieg dem Lande zuführte, waren bequeme Arbeiter. Einige standen, soweit es die Breite von 2,30 m gestattete, mit Hebeln hinter dem 4 m langen Granitungeheuer, das ein Durchschnittsgewicht von 65000 kg vorstellt, bei etwa 3,30 m Höhe, und viele Hunderte mögen sich die Schultern in tiefe Wunden geschürft haben unter dem Seil, an dem sie es zogen.—Und waren Hunderte niedergebrochen, so rückten Hunderte von neuen Syriern, Assyrern, Hebräern an ihre Stelle, und der Block stöhnte und knirschte mit der neuen Mannschaft über den von andern vorbereiteten Weg. Für einen fremden Stier mußten die Unglücklichen bluten, für einen feisten, fremden Stier, der sich zu Tode wiedergekäut hatte.
Die ägyptischen Darstellungen von derartigen Arbeiten haben etwas Erschütterndes. Fremde sind es, die eingespannt werden; für die Ägypter bleiben die leichten Handwerkerarbeiten, bei denen sich’s bequem hocken läßt. Die neuen syrischen Sklaven, die in der Heimat Äcker, Häuser, Weib und Kinder zurückgelassen hatten und hier im Sonnenland an der würdigen Bestattung eines Spalthufers ihre Manneskraft vergeuden mußten, unter Hieben und schlechter Ernährung, ohne andere Hoffnung als die der Erlösung durch den Tod, werden nicht lange ihre stolzen, dem Ägypter fremden Profile mit dem spitzen Kinnbart gezeigt haben. Um den Mund haben sich bald die Falten eingegraben, die an den Augen im Tränenwege, an der Nase vorbei, den Mund im beständigen Krampf von Schmerz und Sehnsucht herabzogen.
Zum Bau der Pyramiden mußte jahrelang erst ein Weg angelegt werden; auf ihm konnten Menschen und Tiere später mit Seilen Block um Block herbeiziehen, den andere Arbeiter, die wohl im Steinbruch zur Welt kamen und dort starben, ausgebrochen und behauen hatten.—Der Nil mag im Erbarmen um die arme Menschheit durch sein Steigen einige Monate Bauferien gebracht haben.
Wir gehen den langen Gang, den unter Ramses’ II. Regierung Prinz Cha-em-weset als allgemeine Apisbegräbnisstätte anlegen, und den später ein König großartig vollenden ließ. Die Kammern, die sich regelmäßig zu beiden Seiten öffnen, was man daran bemerkt, daß die Stimmen einen anderen Widerhall geben, liegen viel tiefer als unser Weg; will man sich einen Sarkophag von unten besehen, muß man die kleine Holzleiter benützen, die vom Gang hinabführt. Schwarz in Schwarz liegen die Schatten aneinander, kalt glänzen die Wände des Steines. Der schwere Deckel ist auch hier zur Seite geschoben wie an allen anderen.
Der Stein fühlt sich kalt an. Und klebt doch soviel Menschentum daran ...
Ich steige langsam die Stufen empor, die ein Hineinsehen in den hohlen Raum des Sarges gestatten. Da drinnen hat sich das Echteste des Lebens still vollzogen: die Verwesung, die eine noch so sachgemäße Einbalsamierung nicht ganz hintan zu halten vermocht hat. Ich blicke in einen finsteren, auspolierten Schacht hinab, beide Ellenbogen auf den Rand und den Kopf auf die Hände gelegt. Es ist wirklich ganz finster— und die Menschen haben doch daran geglaubt ... Einem Gott ist nichts unmöglich, und der Sinn für Komik, Humor und Groteske fehlt ihm. Warum sollte er sich nicht in einem Wiederkäuer verbergen? Unter Umständen konnte der mehr Sicherheit gewähren als der Sohlengänger, der allzu manigfaltigen Gelüsten fröhnt.
Ein großer Granitsarg versperrt den Eingang. Verlassen steht er da in seiner ganzen Schwere, als hätte der Nil die müden Schlepper plötzlich von der Arbeit fortgescheucht. Nie hat darin ein Apis seinen letzten Schlaf geschlafen, und als der Strom zurückgetreten war, da war der Kult erloschen. Die Apisstiere fraßen wieder draußen, führten ein einfaches Rinderdasein und endeten auf dem Tisch der fremden Beherrscher dieses Landes, nachdem sie ihrem Besitzer, der sie weiter nicht verehrte, folgsam alle von ihm verlangten Dienste verrichtet hatten.
Als wir, die letzte der Pyramiden hinter uns lassend, den steilen Weg zum Damm hinunterritten, brach aus Wolken ein merkwürdiger Strahl hervor, der das gegenüberliegende Gebirge scharf aufs Korn nahm. Uns schien es, als arbeitete dort ein Scheinwerfer; die Berge zeigten etwas wie Schnee auf ihren Gipfeln. Ich dachte an die Israeliten, die Moses, aus dem Land der Apisgräber und der Bauten aus Menschenfleisch herausführte, und denen der Herr als Morgenimbiß Manna herabregnen ließ.
Auf dem Boden, worunter sich die ehemalige Stadt Memphis befindet oder befand, wird ausgegraben. Da liegt in einer Holzbaracke mit einer Stufenleiter und einer Brücke, damit man ihm so recht ins Auge sehen kann, einer der beiden Ramseskolosse. Sein Gesicht ist unversehrt; der Mund eine Gebirgslandschaft, das Auge ein See, die Nase ein Berg.—Er sieht uns aber trotz der Größe wunderbar fröhlich an, als wüßte er nichts vom heiligen Apis des großen Ptah. Wir trotten weiter, erreichen Bedraschên und sind nach kurzer Bahnfahrt in Kairo.
Eine einzige Stelle an den Pyramiden gibt Ruhe: ganz oben, die letzte Plattform.
Stehe ich unten, so wird mein Blick mit wirbelnder Wucht nach oben gerissen; hier angelangt, fällt er, sich in zwei Richtungen teilend, und umspannt, herabgleitend abwechselnd an den beiden Endpunkten die ungeahnte Breite der Basis.
Die Sonne ist schon wieder in der Unterwelt, der Himmel leuchtet ganz allein, grün aus der Mitte, gelb an dem Rande, und die Pyramiden, drei große wunde Pyramiden, halten sich ebenso an ewige Gesetze—sie werden, von unten anfangend, kalt, und zum tausend-tausendsten Male umkost der Abendwind ihre noch heißen Gipfel, die tagsüber eine selten umwölkte Sonne anstarren.
Leer stehen sie heute da, aber dennoch erfüllt von den Namen der drei Könige, und jede scheint ihres Königs besonderes Gesicht zu tragen—Cheops, Chefren (Dich, Chefren, grüße ich wieder!), Mykerinos aus der IV. Dynastie.
Ich übersehe ein weites Land jenseits des Nils; nach Norden zu verliert sich das grüne, saftige, wasserdurchtränkte Delta, im Osten der rosa, leicht vergoldete Mokattam, vor ihm die Kalifengräber. Ich selbst berühre den Sand der libyschen Wüste, mache mir’s bequem und versenke die Hände in den lachsfarbigen Sand. Ich hebe die vollgefüllte Rechte auf und lasse ihn durch die Finger rinnen, langsam bis zum letzten Staubkorn. Unerbittlich, wie eine Sanduhr fühle ich mich— und ebenso hilflos. Denn wenn niemand die Gläser umkehrt, bleibt die Uhr stehen, und wenn ich nicht immer neuen Sand heraufholte, bliebe die Hand leer ...
Dieser Sand ist so rein dadurch, daß alle Elemente ihn säubern! Das Licht tötet, der Sturm entfernt, der Regen wäscht—und was übrig bleibt, wird wie Gold.
Das meiner Hand Entfallende bildet auf dem Boden winzige, kleine Pyramiden; ebenso dicht sind sie, wie die großen, nur zu leicht, zu leicht!! Die großen alten aber, die können allen Stürmen trotzen, allen Elementen. Sie erinnern sich nur eines Feindes, der auch einst ihr Schöpfer gewesen war, des Menschen.

Aus dem Grab des Menne.
Ein paar Wolken tauchen aus dem Unendlichen hervor; ich sehe sie in weiter Ferne über den Pyramidenspitzen vorübergleiten, so daß nach ihnen tiefblaue Sphären wieder gähnen. Mein Bewußtsein flieht dahinauf, und Chefrens Grabmonument verschwindet. Da oben herrschen Osiris und Isis. Wunderbar ist, wie noch heute die Religion der Cheops, Chefren, Mykerinos stillschweigend weiterlebt. Die wohltuende, belebende Kraft, die dem Lande Fruchtbarkeit aus dem süßen Nilwasser schenkt, mit einem Wort Osiris, wird alljährlich durch eine Zeit der Trockenheit, glühender Hitze, so, wie der Sage nach, Osiris durch seinen Bruder Seth—dem Symbol der Unfruchtbarkeit, dem Verneiner, überwunden; alljährlich vollzieht sich dieser Urkampf der beiden Brüder. Der beispiellosen Fruchtbarkeit, dem Reichtum folgen—wie die Alten glaubten, nach der Zahl der mit Seth befreundeten Verschwörer, 72 Tage der Trockenheit, des Nichts, bis der Nil sich wieder seinem Lande schenkt, indem er aus den Ufern tritt. So wurde auch Osiris wieder von Horus belebt —zu ewigem Leben, als Lebensspender für die Verstorbenen. Seth aber, das Element des Bösen, der finstere, glühende Hasser alles Fortschreitens, versinnlicht den wahren Tod, von dem es kein Erwachen gibt.
Wunderbar sind die vier Gottheiten dieser drei Könige: Von Isis, der Treuen, habe ich schon erzählt. Hier gedenke ich ihrer noch einmal. Symbolisch wird, wie sie den Schrein mit ihrem scheintoten Gatten dem salzigen, unfruchtbaren Meere entreißt, um ihn unter Tamariskenbäumen auf einer Insel des süßen Nilstromes zu bestatten. Ihr Sohn Horus, der Wiedererwecker seines Vaters Osiris, stellt fortan als Gott die Kraft dar, die Jugend, die Zukunft, den Überwinder aller Widersacher.
Wie oft habe ich ihn in den Tempeln abgebildet gesehen als unmündiges Kind, einen Finger zwischen den Lippen, die Jugendlocke an der Schläfe. Diesem wundersamen Baldur, diesem „Sonnengott beider Horizonte“, wurden nicht umsonst die Zeichen des Falken zugeteilt: Schärfe des Auges, Mut zur Tat, Schweben über dem Gemeinen in nächster Nähe des Sonnengestirns.
Neben ihm steht die anbetungswürdigste aller Göttinnen, Hathor, die Gebärerin, Göttin der Fruchtbarkeit. Die Kuh ist daher ihr Symbol. Gleichzeitig aber ist sie „die Herrin des Scherzes und des Tanzes“. Also Freude und Fruchtbarkeit, die höchsten Grade menschlichen Könnens und Erlebens sind ihre Elemente ....
Hathor erhält als Diadem zwischen zwei Kuhhörnern eine Sonnenscheibe, die ihre Zusammengehörigkeit zu Horus bezeichnet, dessen Augapfel sie zu sein scheint; „Auge der Sonne“ lautet ihr Name.
Osiris aber, der „Herr der unzähligen Tage“— auch die alten Ägypter träumten von der himmlischen Gabe „Verweile doch“—Osiris aber wählt sich zum Symbol den immergrünen Tamariskenbaum, und alljährlich befruchtet er aufs neue Isis, d. i. die Erde seines Landes Ägypten.
Ich fühle ein leises Erwachen zum Leben von heute. Noch jagen die Wolken da oben, aber Osiris und Isis, Horus und Hathor sind entschwunden ....
König Ech-en-Aton hätte diese vier Großen beibehalten können—und nur die Neben-, Seiten-, Zwischen- und Lokalgötter abzuschaffen gebraucht ... Allein, sie waren wohl alle von ihrer poetischen Höhe gesunken und waren nicht mehr zu beleben ...
Ich lehne an meinem knienden Kamel und höre in seinem Innern, daß es oben wiederkäut. Es seufzt ab und zu, beugt den Hals zu mir herunter und läutet leise bis es den Kopf wieder in die alte Stelle geordnet hat. Sonst bin ich allein: Chefren ist fort, Cheops ebenso und Mykerinos’ Sarkophag ruht zwischen Ägypten und England am Meeresgrunde mit dem Schiff, seinem Entführer, während seine Mumie mit dem bunten Sykomorensarg im British Museum ausgestellt ist.
Ich gehe langsam von den Pyramiden zum Sphinx herunter. Diese tote Wüstengegend ist von unbeschreiblicher, heimlicher Anmut. Die Pyramiden lasse ich hinter mir—sie werden immer höher je mehr ich mich von ihnen entferne;—ich folge einem schmalen, steinigen Weg und sehe schon längst das Ziel meiner Schritte ....
Ich will ihn überraschen—ich überfalle ihn von rückwärts.—Schon sehe ich seine linke Wange, seine hochgezogenen Schultern, auf die er das Haupt stützt —und erkenne seine gekrallten Löwenhände.——
Chefren! Du täuschst mich nicht! ich erkenne dich, erkenne dich an deiner selbstbewußten Ruhe.
Menschenhaupt auf Löwenkörper—Weltenrätsel du? Keineswegs. Wir verstehen uns .... Kein anderes Rätsel bist du als jenes, das wir alle in uns tragen, kein gewöhnliches, da du selbst die Auflösung nicht kennst. Du bist, und das ist das Rätsel; aber da begegnen wir uns eben, du und ich; bin ich nicht wie du auch? Für mich gibt es kein größeres Rätsel als unser Dasein, meines zuerst, und dann deines, als Ausfluß des meinigen.
Auch du hast jenes Lächeln des Besserwissens, das nur den Großen bekannt——
Sieh! nun stehe ich neben dir, und wir beide hängen mit unseren Blicken am Himmel, den wir niemals berühren können.—
Es ist nur gut, daß wir trotzdem daran hängen bleiben. Großes Menschenhaupt, geschlechtslos wie die Zeit, der du jeden menschlichen Ausdruck anzunehmen scheinest, gedenke meiner, wenn du der vielen überdrüssig sein wirst, die dich besuchen kommen—gedenke meiner, die ich auf dem Wege Steine und Feinde zu überwinden wage, um mit dir aus gleicher Höhe schauen zu dürfen.
Wenn ich nur einen anderen Ausweg aus dem Hotel wüßte, um nicht an den Gauklern, die auf den Stufen lauern, vorbeigehen zu müssen, und an den Dragomans, die nur wissen, was sie zeigen wollen und niemals was ich zu sehen wünsche. Da letzteres sehr unbestimmt, ist es mir nicht einmal möglich, einen diesbezüglichen Wunsch zu äußern: Wenn ich gern zum Fenster hinaussehe, ist es nicht, weil ich auf bestimmte Schauspiele warte, sondern weil ich mich im Gegenteil gern überraschen lassen möchte, und da ich ebenso bescheiden wie anspruchsvoll bin, komme ich nie zu kurz. So geht es mir auch in den Straßen.—
Den Weg zum Bazar und zum arabischen Viertel kenne ich, wo die Geschäftsleute den führerlosen Kunden dem anderen vorziehen, da sie nicht Bakschisch zu geben brauchen. Aber unser magerer Dragoman, dessen mit Sockenhaltern geschmückte, in zu großen Knopfstiefeln steckende Beine ihn unermüdlich gegenüber der Hoteltüre auf-und abtragen, läßt mich nicht allein gehen. Nur mit Anwendung meiner Schlauheit ist es mir in ganz seltenen Fällen gelungen, seiner Wachsamkeit zu entschlüpfen.
Heute haben böse Gesellen aus einem Sack zwei müde Schlangen gezogen und sie durch einen aufreizenden nasalen Gesang und durch rohes Zerren zu einer Art Aufbäumen gebracht: Schlangenbeschwörer für Jahrmärkte in Niederbayern; diese Unglücksschlangen sind in keiner Weise dressiert, sondern bloß, da ihr Biß todbringend wäre, unschädlich und krank gemacht: es heißt, sie bekommen einen Lumpen vorgehalten, in den sie sich in der ersten Gefangenenwut verbeißen, wonach er ihrem Maul mit einem vehementen Ruck entrissen wird, so daß sämtliche Zähne daran hängenbleiben. Eine derartig operierte Schlange lebt nicht lange mehr, aber zwischen Operation und Tod müssen die armen Tiere auf dem Bürgersteig von Kairo kriechen; und wenn sie das nicht mehr können vor Müdigkeit, so zerrt man sie so lange am Schweif, bis sie es dennoch zu einer Art Tanz bringen, wobei der Name Allah unzählige Male eitel genannt wird. Die Schlange aber ist nur von einer Idee beseelt: entkommen, irgendwo ruhen und Hungers sterben, denn der zahnlose Mund kann nichts mehr greifen. Aber der Mann packt seine Cobra, stopft sie in den Sack und erbettelt sich Backschisch.
Ich kreuze die Straße hinüber, wo es schattig ist, und überhole einige unschlüssige Touristen, die sich nicht über das Frühstückslokal einigen können— der eine schlägt sein Hotel vor, der andere möchte im Bazar essen, ein dritter warnt vor Pest-, Cholera- und Blatternbazillen. Das alles hallt mir in den Ohren, trotzdem ich gar nicht stehenbleibe, sondern im Gehen gedankenlos meine Augen ins Straßenende bohre.
An den Juwelierläden stehen Fremde. Schmuck kann man in Kairo billig kaufen. Die Auslage glüht von der Pracht indischer Steine und Perlen, während die glasierten Augen des Geschäftsinhabers aus der Finsternis seines Ladens die Neugierigen zu hypnotisieren versuchen.
Aus dem offenen Bureau für Expeditionen nach Oberägypten und dem Sudan tönt ein lustiges Morgengespräch über Löwen-und Büffeljagd.
Die Häuser im europäischen Viertel sind von überzeugender Häßlichkeit. Steife Gardinen, zu schwere Brüstungen, Eingangstüren mit neuorientalischen Eisenarbeiten, zuviel Fenster ohne ruhige Zwischenflächen, unverständliche Abschlüsse am Dach und viel zu viel Metalle an Fenstern und Altanen. Das alles blendet, schreit, scheint zu tanzen, um mich herauszufordern. Aber zu einer Szene kann es nicht kommen, da ich 1 mm etwa vor Ausbruch eines Affekts halten und prüfen kann—um gewöhnlich zu bemerken, daß ein Ignorieren den Feind viel sicherer trifft, als der von Irritation geschwächte Versuch, ihn zu erziehen.
Aber draußen im arabischen Viertel, da ist es lustig, da lache ich hinter den Augen, die so viel schauen müssen, daß unbedingt der Mund zu schweigen hat.
Wie schlafen, die da wohnen? Was essen sie? Sie schlafen wie die Hunde, einerlei wo, eingerollt, über und über in Falten zugedeckt, und ich bin überzeugt, daß sie ruhig schlafen. Wer seinen Tag in Gelassenheit dahinrinnen läßt, der übertrifft sich selbst an Ruhe in der Nacht.
Die Straßen sind übersät mit Paradiesapfelresten und fetten Bohnen; schmale, tiefschmutzige Katzen schleichen unter den Holzsitzen umher und packen, was ihnen lecker scheint, unter den steif abstehenden Barthaaren, die sie nicht gern verunreinigen; sie müssen sehr vorsichtig zu Werke gehen, weil das wollige, feinfüßige Schaf, ihr Rivale, auf nichts anderes lauert, als auf Bohnen, und der Katze mit dem Kopf einen nicht mißzuverstehenden Stoß gibt, der sie anderweitig befördert. Über dem zottigen, leise, trocken auftretenden schwarzen Schaf hängen kopflos seine toten Brüder. Die grotesk hergerichteten Köpfe, mit offenen blauen Augen sind auf einem Brett aufgestellt, teils roh, teils schon auf das appetitlichste abgekocht. Daneben hockt in einer Nische, die er Laden nennt, ein Schneidermeister an einer vorsintflutlichen Nähmaschine, die ihm enggestreifte Seidengewänder herunternäht. Seine Lehrlinge arbeiten mit der Hand, gebückt, andächtig den Faden leckend, während die Augen zu mir herüberblitzen. Am Eingang stauen sich farbig behangene Nichtstuer. Schwarzumhüllte Frauen zeigen außer den Händen nur Stirne und nackte Fersen auf hohen Lederpantoffeln, die ihnen spitz die Zehen umschließen, und gehen königlich erhaben vorüber. Von all den Augen, die hier spazieren getragen werden, scheinen mir die ihrigen allein aus dem Verträumt-Gleichgültigen zu erwachen; man könnte manchmal von ihnen denken, sie beobachteten etwas.
Ganz vorne schaukelt ein Zug von mehreren kleebeladenen Kamelen heran, einem verträumten Führer folgend, zu Riesenhöhe anwachsend, wenn ich dicht bei ihnen stehe, und dann lautlos hinter mir in meine Träume fallend. Aus verborgenem Hinterhof höre ich einen Esel sich freuen, wofür er den melancholischsten Ton anwendet, den je ein Tier hervorgebracht. Namentlich der Schluß ist wie eine schmerzvolle Anklage. Ich sage mir, daß er’s zum Vergnügen tut, hoffentlich irre ich mich nicht.
Die holzgeschnitzten Fensterläden sind an der Straßenseite geschlossen. Alles Leben schiebt sich auf die Gasse hin, zwischen den Rücken der nach beiden Richtungen davonklirrenden Pferdchen und Esel. Niemand wird gedrückt, keiner schreit, nur die Ausrufer haben die wundervolle Akustik einer engen, hochbewandeten Straße für sich—und ich kann in aller Muße die angepriesene Ware betrachten, Süßigkeiten, Fett-und Fleischspeisen, Kämme und Tücher,—und alles ist erstaunlich neu und sauber.
Ich bewundere, wie liebevoll intakt das süße Naschwerk erhalten wird, und wie geschickt ein junger Araber eine vollständige Mahlzeit mit Suppenterrine, Getränken und Gebackenem auf dem Kopfe balanciert, während ein barfüßiger Eseltreiber geschwind mit einhalb Dutzend ungesattelter Grautiere unter dem Tablett verschwindet. Aus einem Torweg flattern zwei geköpfte Hühner heraus. Niemand holt sie—sie verspritzen ihr Blut auf dem lehmigen ungepflasterten Weg, und wir alle weichen ihnen unmerklich aus, ohne sie besonders anzusehen.
In diese enge Straße zwängen sich gefüllte Fiaker im Trab, von schön gebauten, schlecht ernährten Hengsten gezogen. Neben dem schwarzen Kutscher, dessen Peitsche nie ruht, dreht sich mit Kreiselbewegungen der Dragoman.
„Oh please tell us,“ sagen die Touristen, und der Schlaue faselt ernst und enthusiastisch und deutet mit unsauberen Fingern auf die Minaretts und die Kuppeln der Kalifengräber.
In dem Viertel, das ich nun betrete, ist es eigentümlich still; die Straßen kreuzen sich,—Sand und abermals Sand—und nicht ein lebendes Wesen. Aber auf dem Sand steht eine Stadt—Villa an Villa—und alle Läden sind geschlossen—und die schlüssellosen Türen sind merkwürdig verstaubt. Ich spaziere in der stillen Stadt umher,—ich bin im Totenviertel.
Wohnt der Tote hier, oder kommen seine Angehörigen alljährlich hierher und ziehen in die hellblauen Häuser ein? Niemand kann es mir sagen. Ein Gartentor ist offen, ich bleibe daran stehen. Eine alte, zahnlose Ägypterin ladet mich ein, ihr zu folgen. Sie zeigt mir die Kaktusanlagen, über welche Kletterrosen wuchern, und fettstielige Wüstenpflanzen mit fleischroten Früchten, die sie ihren Toten gespendet hat. An den weißen Mauern hängen Zweige und Blüten; wie sie sich aus dem trockenen Sandreich ernähren, weiß ich nicht. Die Alte stellt eine Schüssel mit Durra, einer Getreideart, auf die Mauer für die Vögel. Ein halbwüchsiger Bub gesellt sich zu mir und ein kleines Mädchen, dem die Fliegen das Tränenwasser aus den Augen trinken. Ich schenke ihnen einen Korb voll Orangen. Die Früchte waren bald verteilt. Aber der Korb ward zur Hauptfreude. Der schwarze Bub schrie und sprang und drückte das Körbchen an sein Herz—es mag lange her gewesen sein, daß solche Freudentöne die Totenstadt erfüllten! Gewöhnlich sind nur die Jammertöne der Klageweiber vernehmbar, wenn ein Mensch zu Grabe getragen wird. Sie lassen sich zu diesem Zweck vermieten und verbringen so den größten Teil ihres Lebens mit Jammern und Heulen, wobei sie sich keineswegs etwas entgehen lassen, dessen Betrachtung ihre Neugierde befriedigen könnte. Sie heulen ganz affektlos und sind, soweit dies überhaupt bei ihren geistigen Verhältnissen möglich, seelisch anderweitig beschäftigt. Ich sah eine von ihnen ihre dramatischsten, Schiffsirenen ähnlichen Töne hinausschreiend, in aller Seelenruhe einen Säugling trocken legen.
Sonst wird der Tod auf das vollkommenste ignoriert. Diesen Hunderten von Häusern, die allerdings selten zweistöckig gebaut werden, merkt man den gemeinsamen Gast nicht an, und so soll es sein; man weiß ja genau, daß Er die Respektsperson ist, daß man stets Ihn rechts sitzen und zuerst aus den Türen gehen lassen sollte. Aber schließlich, solange Er sich’s gefallen läßt, warum sollte ich nicht rechts von ihm sitzen und frech vor ihm aus den Türen schlüpfen? Er scheint meine Art Unhöflichkeit ihm gegenüber stillschweigend anzunehmen: Stets an Ihn denken und Ihn stündlich ignorieren.
Ein Wort noch über die wirklichen Beherrscher des Orients,—die Antiquare. Sie sehen alle einander ähnlich, —ein syrisch-französischer Typus. Tritt der Fremde ein, so macht jeder ein Gesicht, als sei er kurzsichtig, und sucht möglichst schnell herauszufinden, ob er einen Jäger oder das liebe Wild, einen Kenner oder einen Käufer—einen kaufenden Kenner oder einen neugierigen Geizkragen oder einen blinden Verschwender oder die Dame, die acht Piaster für eine persische Schale gibt, in seinem Laden begrüßt. Um sicher und schnell herauszufinden, mit wem er es zu tun hat, spitzt er den Mund und fragt: „Sie wünschen?“ Da muß man Farbe bekennen. Die Dame mit den acht Piastern Bewegungsfreiheit läßt sich persische Schalen zeigen. Die Gute ist selig bei den lichtgrünen und himmelblauen Töpfen, die leider wortlos anmarschiert kommen. Sie hätte so gerne gehabt, daß sich der französische Syrer äußerte. So muß sie wieder das Schweigen brechen, und da ihr in Gegenwart dieser Töpfe nichts anderes einfällt, beginnt sie mit dem Schluß, der auch ihr Todesurteil enthält: „Was kostet dieser?“
Der Händler ist nun genau orientiert; er sagt einen frei erfundenen Preis,—er hat längst die Dame mit den acht Piastern erkannt. Sie will noch nicht gehen und wagt es, nach Teppichen zu fragen und nach Stickereien. Aber der Mann hat alles auf die Münchener Ausstellung geschickt und bedauert unendlich.
Die Türe schließt sich hinter ihr, und der große Teppichmann setzt sich wieder bequem an seinen Tisch hin und verbrennt sich die schwarzen Pupillen mit Zigarettenrauch, der seine Finger schon längst in gelbe Krallen verwandelt hat.
Auf das „Sie wünschen?“, was ich nur bekomme, wenn ich zum erstenmal in das Heiligtum dringe,— habe ich eine Antwort, die jeden Antiquar entwaffnet: „Meine Wünsche, lieber Herr, sind unerfüllbar, möglich, daß Sie sie erfüllen können,—das werden wir ja bald sehen.“ Auf das hin macht jeder ein ganz neues Gesicht, und ich stehe eine Stufe höher als er, was einen Vorteil bedeutet.—Derweil schnüffle ich herum und habe ziemlich schnell los, was für ein Mann vor mir steht; die Herren Antiquare klassifizieren uns,—wir haben aber auch ein kleines Schema, um sie zu sortieren. Der Auslage nach, wenn sie eine haben, sind sie alle gleich: ein glasierter Napf steht auf zwanglos gerafften Gebetsteppichen, während mehrere kleine Sphinxe, Welträtsel im starren Auge tragend, den geduldigen Spaziergänger anlächeln. Eine Schale mit tönernen Mistkäfern und ein halber Kilometer Bernstein- und Glasketten geben dem ernsten Bild eine munter klirrende, freundlich-bunte Note. Will der Leiter des Etablissements den ernstzunehmenden Kunstliebhaber betonen, so legt er noch eine kleine Mumie dazu. Besser aber ist es für ihn, diese im Innern des Ladens zu verbergen, um einmal wortlos vor dem erschauernden Käufer einen Vorhang wegzuziehen. Vorher hat er an einigen Stellen Karminpulver—vertrocknetes Blut—eingestreut, das so recht die Prozedur des Ausweidens, Sezierens, Einbalsamierens vergegenwärtigt. Die Mumie heißt immer Ramses—und stammt—o weh!—immer aus den allerersten Dynastien. —
Den ersten Ausbruch von Intimität leitet jeder Antiquar mit den Worten ein: „Wissen Sie, ich, ich bin nicht wie die andern; ich gebe Ihnen so etwas für soviel, —die anderen verlangen von Ihnen Ihre Augäpfel dafür!“ Nun, ich klassifiziere die Antiquare erstens in die großen Herren, zweitens in die Menschen und drittens in die Geschäftsleute.—Die schönsten Sachen sieht man bei den großen Herren, die nur mit Museen und Krösussen sich einlassen, aber ein freundliches Auge für den Kunstkenner haben.
Zu den Menschen rechne ich die Antiquare, die weder vom Kunstenthusiasmus noch vom Geschäftssinn ganz gefangen genommen sind, die also etwas über Dummheit, Laune, Wankelmut, Kunstunkenntnis und wiederum über etwas Freude am Schönen verfügen. —Diese sind mir die liebsten, denn man findet hie und da schöne Sachen, an welchen bei ihnen die viel geprüften Börsen noch nicht zugrunde zu gehen brauchen.
Die dritte Kategorie ist die unsympathischste. Die Herren, die unter diese fallen, haben eine genaue Kenntnis des augenblicklichen Marktwertes ihrer Sachen und kaum ein lauwarmes Gefühl für das Schöne, das bei ihnen aufgestapelt sein mag.—Einem gewissen Gaunertum begegnet man natürlich bei allen—aber einerlei, ich habe, wenn ich in eine neue Stadt komme, immer das erhabene Gefühl, vor einem Wald zu stehen, in dem ich Steinpilze suchen werde.—Werde ich welche finden?
Sie sind da,—das fühle ich—, werde ich sie aber finden?—Giftpilze und die gewöhnlichen eßbaren gibt es gerade genug,—aber die Steinpilze, die gesunden, starken, fehlerlosen, nußbeizbraunen, mit der blonden runden Säule unter dem Dach—und die jungen unvollendeten, harten? Wenn ich einen sehe,—plötzlich, —unverhofft—trotzdem ich blind zehnmal an der gleichen Stelle vorübergegangen war,—da steht mir das Herz still. Der Steinpilz sieht mich, wir erkennen uns, jetzt brauche ich ihn nicht einmal zu pflücken, —ich kann mich faul daneben hinlegen. Er ist mein, ich brauche nur den entscheidenden Schnitt zu tun.——
Ja, genau so geht es mir bei den Antiquaren. Plötzlich steht man vor dem Steinpilz.—— Ich habe einen kleinen Basaltkopf im Auge. Er ist mein, aber ich habe ihn noch nicht abgeschnitten. Wäre ich nur einen Tag lang ein Krösus.
Sich losreißen.—Das gräßliche Zurücksinken,— das Verschwinden des Gewesenen.—Das alles wird Wachstum genannt.—Und so wachse ich wieder— und fühle, daß ich in mir ein Größeres beherberge. Es ist ja nicht die Abfahrt aus Alexandrien. Es ist auch nicht das starke Gefühl von Kühnheit, das mich erfüllt, sobald ich mich von den paar Brettern über Meeresabgründen getragen weiß. Es ist wie das Hervorkommen aus den Königsgräbern, aus dem Totenreich ins Land der Blinden. Es ist das Gefühl: Nun verläßt mich Ägypten, dem ich so viel geschenkt—und trotz dieses Verlustes an meinem eigenen Besitz weiß ich mich schwerer,—wie dicht muß ich geworden sein.
Ob es je fertige Menschen geben wird? Ich hoffe nein. Immer wird der Gott oder das Tier in ihnen stärker hervortreten. Doch gibt es Augenblicke der Vollkommenheit—Gott mit Tierhaupt—Tierleib an Menschenantlitz—Augenblicke höchster Vollendetheit hinter starren Augen, geraden Mündern und gelassener Körperhaltung. Es gibt ein Schlucken scharfer Gifte, ein göttliches Wohlwollen allen Schuften gegenüber, ein in strengster Bescheidenheit herrschendes Besitzen der ganzen Welt, das wie eitel Musik durch die gespannte Seele rieselt.
Schon sehe ich das Land der Sphinxe nicht mehr, erspähe längst nicht mehr die Pyramiden-Dreiecke am Horizont, und mein Blick, der sich an trübe Nilwogen gewöhnt hatte, begreift die klare Härte des Meeres noch nicht ganz.
Unser Schiff schießt wie eine Möwe über das Blaue, Unfaßbare, Hartgefrorene und doch geschmeidig Weiche.
Und ich gehöre auch dazu, ich darf mittun.
Es wird Abend wie alle Tage, aber ich glaube wieder einmal, es ist heute etwas Besonderes darum. Ich bin oben bei den Schloten, wo es nach Ölbraten riecht. Mich rührt der Schweiß meines Schiffes.
Aus dem Körper stöhnt es leise.
Nun ist Ägypten wieder zum Traum geworden. Was ich auch tun mag, ich kann es nicht mehr anfassen.
Ich habe darin durch meine Abreise keine Lücke gelassen.
Über die Schatten meines Dortseins schließen sich die Wogen der Gegenwart. Andere werden meine Wohnung, mein Schlaflager, meine Esel, meine Tempel nehmen.
Ja, und nicht nur für Ägypten gilt das.
Gewiß, es gibt nichts Natürlicheres als das Fortgehen. Das Kommen und das Begegnen, das sind die köstlichen Zutaten des Lebens, die sofort wie das Gewürz im All verschwinden und nur den Duft hinterlassen. —Das Wahre ist das Gehen, das Fortgehen.
Dann wähle ich die Lüge—und bin zu jeder Lüge bereit, nur darf ich nichts mehr niederschreiben.
Mit einem Male höre ich hartes beschleunigtes Sprechen, hastiges sich Zusammendrängen mehrerer Menschen, Hüteschwenken; sie wollen etwas fangen, und nun sehe ich einen verängstigten Vogel von Stelle zu Stelle flattern. Unser Dampfer ist schmal: die Möglichkeit, sich darauf zu verbergen gering; dem Vöglein, das in Alexandrien zu Hause ist, hat er einen schlimmen Streich gespielt. Nun ist der Entführte zur Besinnung gekommen.—Es ist zu spät zur Flucht—er muß auf diesem trügerischen Boden verweilen. Ein kleiner, bunter Vogel ist er—o möchte er seinen Verfolgern entkommen! Wenn er geschickt ist, gelingt es ihm. Nur nicht untergehen!
Möchte er für die Nacht ein sicheres Versteck finden! Möchte er die zwei Tage Fasten ertragen! Wenn wir an Land kommen, wird er Futter und Wasser, Ruhe und Sicherheit finden.
Kleiner blinder Passagier! Das letzte Tier aus Ägypten.
Ägyptens zarter, letzter Gruß an mich.
Mis-spelled words and printer errors have been corrected. Where multiple spellings occur, majority use has been employed.
Punctuation has been maintained except where obvious printer errors occur.
Some photographs have been enhanced to be more legible.
[The end of Götter, Könige und Tiere in Ägypten by Mechtild Lichnowsky]