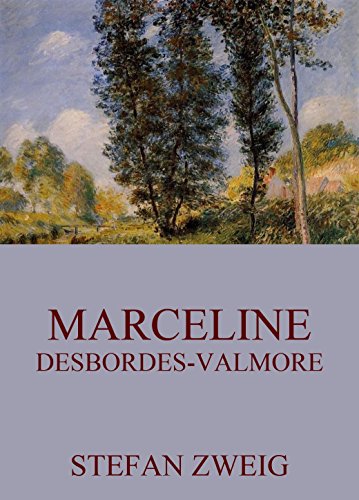
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Marceline Desbordes-Valmore, Das Lebensbild einer Dichterin
Date of first publication: 1927
Author: Stefan Zweig (1881-1942)
Date first posted: July 4, 2021
Date last updated: Sep. 22, 2021
Faded Page eBook #20210705
This eBook was produced by: Delphine Lettau, Mark Akrigg, John Routh & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
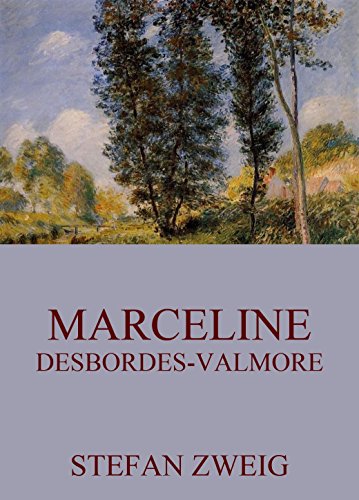

Constant Desbordes: Marceline Desbordes-Valmore
Gemälde im Museum von Douai
MARCELINE
DESBORDES-VALMORE
Das Lebensbild einer Dichterin
von
STEFAN ZWEIG
Mit vier Lichtdrucktafeln
IM INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG
MCMXXVII
ERSTER TEIL
BILDNIS IHRES SCHICKSALS
„D’un cœur de femme il faut avoir pitié,
Quelque chose d’enfant s’y mèle à tous les âges.“
In der ersten Morgenröte des Jahrhunderts, im Kriegsjahre 1801 steuert eine kleine französische Karavelle Westindien zu, vierzig Tage und vierzig Nächte durch den unendlichen Ozean. Nur ganz Verwegene wagen ihr Leben damals an solche Fahrt, denn die englischen Fregatten durchkreuzen raubgierig das Meer und jagen jeder Napoleonsflagge als erwünschter Prise nach. Auf dem Verdeck zwischen Offizieren, Abenteurern, Kommissären und Kaufleuten, zwischen all den Heimatlosen des Wunsches und des Schicksals zwei weibliche Gestalten, eng aneinandergelehnt in ihrer Angst, wenn die Wellen wie gierige Tiere über Bord springen, zwei kranke und schwanke Gestalten, ein vierzehnjähriges Kind, blond und zart, eine kleine Madonna, mit ihrer sorgenvollen Mutter zur Seite. Stürme schüttern das schwanke Fahrzeug, tropische Sonne brennt auf die gerafften Segel, wenn in der Windstille das winzige Fahrzeug sich ohnmächtig in der endlos flimmernden Schwüle des Ozeans wiegt. Nachts blicken fremde Sterne herab auf das niedere Deck, wo sie auf und ab gehen, sorgenvoll und ohne Freund. Manchmal singt das kleine Mädchen mit ihrer gebrechlichen Silberstimme altmodische Romanzen, um die Mutter zu trösten und eine Heiterkeit vorzutäuschen, von der das eigene Herz nichts weiß.
Dieses vierzehnjährige blonde Mädchen unter fremden Sternen ist Marceline Desbordes, mit ihrem späteren Doppelnamen Marceline Desbordes-Valmore als Frankreichs größte Dichterin bekannt. Zu Douai in Nordfrankreich ist sie am 20. Juli 1786 geboren, in jenem flandrischen Grenzkreis, der von je der französischen Sprache die höchsten Meister des Liedes geschenkt hat: Verlaine, Samain, Rodenbach, Verhaeren, Lerberghe. Den Desbordes, einer alten Familie, steckt der Künstler im Blut. Der Oheim ist Maler, und auch der Vater, im Handwerk der Kunst verwandt, dankt behaglichen Wohlstand dem durchaus höfischen Beruf des Heraldikers und Schildermalers. Jahrzehntelang hat er die Karossen des Adels mit Emblemen geschmückt und mancherlei Prunkgerät mit Wappen und Spruch verziert. Aber die Revolution hat die Schlösser zertrümmert, die Karossen sind selten geworden und die Wappen zersplittert: aus gemächlicher Wohlhabenheit stürzt die Familie nieder in eine plötzliche Armut, und die grauen Schwestern Dürftigkeit und Sorge umschleichen das Haus. Der Erwerb ist verloren, nirgends in der Nähe Hilfe und Ersatz. Da beschließt die Mutter in phantastischer Kühnheit, Rettung von einem entfernten Verwandten in Guadeloupe zu erbitten, einem Plantagenbesitzer, von dessen Reichtum Legenden über das Meer gedrungen sind. Ohne sich von Vernunft und Gefahr abmahnen zu lassen, rüstet sie die Reise und nimmt als Begleiterin gerade das Schwächste, das Jüngste, das Liebste mit, die zwölfjährige Marceline, ein Kind, goldblond und zart, mit blaßrosig durchleuchtendem Antlitz wie das der Madonnen des van Eyck. Der Hafen wäre nahe, aber es fehlt den beiden das Geld zur Überfahrt. Nahezu zwei Jahre ziehen sie durch ganz Frankreich, ehe sie die Barschaft zusammengespart und gebettelt haben. Die Mutter ist untüchtig und schwächlich, so muß es Marceline, die Zwölfjährige, sein, die das Brot erwirbt, Tag für Tag. Im Alter der Sorglosigkeit, da andere Kinder noch mit ihren Puppen spielen, muß sie schon, wie Mignon, die Heimatlose, in Komödiantentruppen Dienst tun, muß täglich mit ihrer kindischen, fragilen Stimme Lieder singen und tanzen, um nur das Kärglichste der Notdurft zu verdienen. Und mit wie viel Tränen ist dies schmale Brot genetzt! Die Truppe, die sie aufnimmt, macht Bankrott, ein anderes Mal jagt sie eine unfreundliche Prinzipalin mit Schlägen davon, und vor dem Hungertod bewahrt sie nur das Mitleid gütiger Kameraden. Aber sie dulden alles, um nur hinüber zu gelangen ins Goldland, denn dort drüben harrt ihrer ja Reichtum, die Rettung. Sie hungern, sie betteln, sie frieren, sie darben sich durch von einem Ende Frankreichs bis zum andern, diese beiden Frauen; zwanzig Monate kämpfen sie, bis endlich in Bayonne jemand ihnen genügend Geld leiht oder schenkt, um die gefährliche Reise anzutreten. Vierzehn Jahre ist die kleine Marceline jetzt alt, aber ihre Kindheit ist unwiederbringlich untergegangen in Not und Sorge.
Und nun reisen sie über den Ozean vierzig glühende Tage, vierzig sterndunkle Nächte dem Vetter entgegen, der ihnen helfen soll. Aber ehe das Schiff landet, tauscht der Kapitän seltsame Signale mit denen am Ufer, und seine Mienen verdüstern sich. Entsetzliche Nachricht erwartet sie: Guadeloupe steht nicht mehr unter französischer Herrschaft, ein Aufstand der geknechteten Neger hat die Insel verwüstet. Und ihr Vetter, der reiche Plantagenbesitzer, auf den sie alle Hoffnungen gesetzt hatten, ist als einer der Ersten von der Meute ermordet worden. Ratlos stehen die beiden Frauen am Ufer, allein in einer ungeheuren Wildnis von Menschen und Dingen. Die Mutter trägt es nicht lange, das gelbe Fieber rafft schon in den ersten Tagen die Enttäuschte hinweg, und nun steht die vierzehnjährige Marceline ganz allein, meilenweit von der Heimat, unter fremden Menschen und Sternen, angewiesen auf das Mitleid oder Übelwollen von Unbekannten. Nichts an Grauen bleibt ihr erspart. Ein Erdbeben schüttert die Stadt, sie sieht Feuersäulen aus den harten Bergen brechen und die Häuser zusammenstürzen. Auf den Knieen bestürmt sie den Gouverneur, er solle ihr die Heimreise ermöglichen. Aber nach Wochen erst — nach namenlosen Wochen, von deren Elend niemand weiß — wird ihr Wunsch erfüllt, und siebenfach heimatlos, eine Waise, kehrt sie wieder zurück auf einem elenden Kauffahrteischiff, wieder vierzig Tage und vierzig Nächte. Das Kind ist das einzige weibliche Wesen auf dem Fahrzeug, und der Kapitän, ein trunkener und brutaler Geselle, sucht aus ihrer Verlassenheit Vorteil zu ziehen. Er stellt ihr nach, und die Erschreckte muß zu den Matrosen um Hilfe flüchten, die sie in einer Art humaner Revolte vor seinen Zudringlichkeiten schützen. Aus Rache fordert er nun Bezahlung für die Überfahrt und behält der Waise bei der Ausschiffung in Havre den kleinen Koffer zurück, der all ihre Habseligkeiten enthält. In schwarzen Trauerkleidern, ohne Geld und ohne Freunde steht die Fünfzehnjährige nun in der fremden Stadt, aber ihr Mut zur Entbehrung ist gestählt von all den bitteren Erfahrungen. Niemand weiß, wie sie sich weiter bis nach Lille geschleppt hat, wo sie einige Menschen kennt. Dort taucht sie im Jahre 1803 plötzlich auf, und freundliche Bekannte, von ihrem Schicksal gerührt, organisieren eine Theatervorstellung zu ihren Gunsten. Die Ankündigung, ein Kind, das aus dem Massaker von Guadeloupe gerettet sei, werde auftreten, bringt dem Theater einigen Zulauf und ihr genug Ertrag, daß sie endlich nach fast dreijähriger Wanderung wieder nach Douai in das Heimathaus zurückkehren kann. In traurige Stuben tritt sie dort mit ihrer bösen Botschaft ein. Der Vater bringt sich nur kümmerlich weiter, ihr Bruder, unfähig zu ernster Arbeit, ist aus Not Soldat geworden und kämpft in Spanien für Napoleon. Dunkel auch hier wie überall. Ein paar Tage bloß ruht sie aus bei den Ihren, dann wandert sie eilig weiter, um nicht länger zur Last zu fallen. Früh ruft sie das Leben: schon vom zwölften Jahre an wirft sich die ganze Notdurft der Existenz schwer auf die zwei schmalen Schultern und erdrückt ihr die Kindheit.
„Toujours du talent, mais trop de sensibilité.“
Der offizielle Theater-Rapport von 1814
Die guten Bürger von Lille und Rouen sehen nun in diesen Jahren, wenn die Stafetten frohe Nachricht aus Napoleons Hauptquartier melden und sie, über die Weltlage beruhigt, ihrer Schaubühne Besuch abstatten, inmitten des heimischen Klüngels mäßiger Komödianten und abgetakelter Heroinen eine rührende Gestalt: ein halbreifes Mädchen von zartem Wuchs und verschüchtertem Gebaren, ernst und doch milde, keusch und doch nicht kühl. Aus Mignon ist Ophelia geworden, die Sanfte, die Schwärmerische; aber die frühe Strenge des in Sorgen verdüsterten Antlitzes wird schön beschwichtigt durch eine anziehende Kindlichkeit, die jedes Wort und selbst die flüchtigste Geste dieses Mädchens beseelt. Ihre Erscheinung ist gewinnend. Eine lichte Aureole von Blond umschmiegt Marcelines Gesicht, von dem nicht zu sagen ist, ob es jemals wahrhaft schön gewesen sei. Sie selbst, die Bescheidene, fand sich „laide aux larmes“, und die wenigen Bilder von ihr sind ungewiß und nicht recht authentisch. Aber die Kritiken aus jenen verblichenen Provinzgazetten wissen ihren Eindruck von damals deutlich zu beleben und bezeugen trotz ihrer ledernen Pathetik im letzten doch die gleichen Vorzüge ihres Wesens, die später die Dichterin inspirierten. Hier und dort, in jeder Kunstäußerung war ihr Zauber die tiefe Aufrichtigkeit einer Seele, die jedes und auch das unwertigste Gefühl mit einer wundervollen Kraft der Expansion ins Grenzenlose ausspannte, und dann jener innerste, vom Genie ihr eingesenkte Sinn für Musik. Dazu kam damals noch der Schimmer von Anmut, der ihre kindliche Gestalt umschwebte. Etwas Unirdisches und hold Sentimentales muß ihr damals zu eigen gewesen sein, etwas von der geheimnisvollen Magie der sanften Tiere, der rührenden Anmut der Rehe, der flüchtenden Leichtigkeit der Schwalbe, Schönheit von der Schönheit der wehrlosen Wesen, denen die Natur jede Waffe versagt hat, um ihnen dafür jenen Zauber der Seele zu schenken, der Rührung und Mitleiden schafft. Und wirklich: die Wehrlosen, die Leidenden, die unschuldig Gekränkten, das sind die Rollen, die Marceline damals zugewiesen sind. Niemals spielt sie die Heroinen, die Amoureusen; denn Leidenschaft, die begehrende und große, Pathos und Emphase, das glitzernde Funkenspiel der Koketterie sind ihr fremd. Sie vermag — hier ist Grenze und Größe der Dichterin und Schauspielerin — nur darzustellen, was ihrem eigenen Schicksal nahe ist. Damals wurde ihr noch die Rolle der Verfolgten zugeteilt, die gekränkte Waise, die verachtete Schäferin, das Aschenbrödel bei den bösen Schwestern, die verfolgte Unschuld, die liebende Tochter — alle diese himmelblau sentimentalen Mädchenfiguren, die wir noch besser als von jener verstaubten Literatur aus den affektierten Bildern Greuzes und den Kupfern der Almanache kennen. Aber diese Verlogenheit durchdringt sie mit Seele, weil ihre schon in kindlichen Jahren rege Güte selbst dies künstliche Schicksal mit Ergriffenheit überfühlt. Nur die seelische Sensibilität, die auf die geringste Vibration der Menschlichkeit mit stärkstem Ausbruch des Empfindens reagiert, macht sie als Schauspielerin bedeutsam. Und dann: sie hat die Träne, die leichte und doch die echte, nicht die erpreßte der Komödianten, sondern schon damals die der Dichterin, die Träne, die aus den Quellen eines heißen Herzens stammt und, aufsteigend in die Kehle, erst die Stimme warm durchschüttert, ehe sie feucht an den Wimpern blinkt.
Abend für Abend tritt sie vor die Rampe, und viele hundert bunte Schicksale hat sie in diesen zwei Jahren zur Freude der wackeren Bürger von Lille und Rouen dargestellt. Aber ihre wahre Existenz, die hinter den Kulissen, ist monoton und matt, ein freudloses proletarisches Dasein zwischen Arbeit und Entbehrung. Wenn oben die Kerzen verlöschen, der Vorhang sinkt, eilt sie müde nach Hause, wo die beiden Kostgängerinnen, ihre Schwestern, auf sie warten, die, ärmer noch als sie selbst, an ihrem armen Leben zehren. Bei der flackernden Lampe muß sie dann noch Kostüme schneidern, Kleider waschen, Rollen abschreiben, um sich mageren Zuschuß zu verdienen, und durch ein unerhörtes Mirakel der Aufopferung gelingt es ihr sogar, ab und zu von diesen achtzig Franken Gehalt etwas nach Hause zu senden. Aber unter welchen Entbehrungen sind diese Groschen gespart! Es ist oft das nackte Brot, das sie den Ihren opfert. „Man warf mir Blumen zu,“ schreibt sie später, „und ich kehrte hungernd nach Hause zurück, ohne es irgend jemandem zu verraten.“ Und Marcelines ganzes Grauen vor ihrem Schicksal ermißt man an dem Schrei, mit dem sie zwanzig Jahre später, selbst in tiefster Notlage, davor zurückschreckt, ihre Tochter dem Theater zu geben: „Lieber sterben, als sie das erleben lassen, was ich selbst erlebte.“
Ein gnädiger Zufall erlöst sie von der Provinz. Die Künstler von der Opéra Comique, auf einem Gastspiel in Rouen, hören ein kleines Lied, von Marceline in einem der Stücke gesungen, und die Lieblichkeit ihrer Erscheinung sowie eine seltene Beseelung des Vortrags erwecken ihre Aufmerksamkeit. Sie verhelfen ihr zu einem Engagement nach Paris, an die Opéra Comique, und mit einem Male ist sie auf anderer Bahn, ist ohne Schulung und Übung Sängerin an einer Weltbühne. Grétry, der große Meister, wendet ihr seine väterliche Zuneigung zu, nennt sie „sa chère fille“ und öffnet ihr sein Haus, gute Rollen werden ihr zugewiesen, obzwar ihre Stimme, die zarte, eigentlich nicht recht ausreicht und im weiten Saale zu verhauchen droht. Aber die Musiker, auch sie wie alle andern Kollegen von ihrem kindlichen Liebreiz und der schüchternen Güte ihres Wesens gewonnen, dämpfen mit Absicht, wenn sie singt, heimlich ihre Instrumente, damit ihr Gesang nicht gedeckt werde und besser zur Geltung komme. Fünf, sechs Jahre verbringt Marceline an dieser Bühne, eine drängende, geheimnisvolle Zwischenzeit. Das Kind in ihr ist längst versunken im Anstrom der Sorgen, der Flut der täglichen Geschäfte, aber auch die Frau in ihr ist noch nicht ganz wach. Denn noch haben die beiden Stimmen in ihr nicht geklungen, die sie in ihre wahre Welt erwecken und ihr harrendes Gefühl ins Grenzenlose heben: die Liebe und mit ihr die Dichtung.
„Mon cœur fut créé pour n’aimer qu’une fois.“
Sie ist nun einundzwanzig Jahre alt. Ihr Gefühl, das übermächtige, hat sich bislang nur an kindliche Demut und schwesterliche Aufopferung verschwendet, jetzt aber tastet es weiter in die Welt, dies drängende „besoin d’aimer pour aimer“. Die Frucht ihres Gefühls ist reif. Unkund seiner Bestimmung gibt sie sich in dieser Zeit leidenschaftlich der Freundschaft hin, und am meisten wendet sich Marcelines Neigung einer jungen Griechin Delia zu, einer begabten Schauspielerin des gleichen Theaters. Zeitgenössische Beschreibungen schildern sie als eine übermütige, leichtfertige, sinnliche Frau. Wie immer wirkt hier Gegensätzlichkeit des Charakters als Anziehung. In ihrem Hause begegnet Marceline dem Verführer. Hier beginnt der tragische Roman ihres Lebens. Kapitel auf Kapitel können wir ihn aus ihren Gedichten lesen, Zug um Zug den Feldzugsplan ihres Verführers, das Ermatten ihres Widerstandes, die Peripetieen ihres Gefühls verfolgen, denn dies ist das Wunderbarste dieser Dichterin, daß sie, zaghaft im Wort und keusch im Wesen, sich bis auf das Letzte verriet in ihren Versen. Ihre Seele war immer nackt im Gedicht.
Delia spielt auch hier wie auf der Bühne die Rolle der Verführerin und Marceline die der Unschuld. Der Hauptakteur ist ein junger Dichter, Delias Geliebter, der „Olivier“ der Elegieen. Die allererste Szene muß man sich ersinnen. Eines Tages (vielleicht hat Marceline eben die beiden verlassen) stellt der junge Dichter ganz absichtslos in heiterer Neugier die Frage an Delia nach ihrer Freundin Herzensangelegenheiten und staunt bei der verräterischen Mitteilung, die Zwanzigjährige noch völlig unschuldig zu wissen. Delia rät ihm lächelnd, sein Glück zu versuchen. Die Zumutung reizt und versucht ihn, sie verbinden sich beide übermütig zum Komplott, dies kühle Herz zu entflammen. Das nächste Mal schon setzt er sich an Marcelinens Seite und spricht Worte zu ihr, die sie beglücken und verwirren, er spricht mit seiner sanften Stimme, deren Schmelz sie in zahllosen Gedichten gerühmt und deren Zauber sie immer wieder unterlegen ist. Delia bleibt abseits, lächelnd und der verstatteten Abirrung ihres Geliebten neugierig froh. Unmerklich ebnet sie ihm die Wege und fördert durch Rat die leichte Mühe. Später, viel später erst begreift Marceline diese frivolen Zettelungen, später, zu spät, wie sie aufschreit:
„Ce perfide amant, dont j’évitais l’empire,
Que vous aviez instruit dans l’art de me séduire,
Qui trompa ma raison par des accents si doux,
Je le hais encore plus que vous!“
Aber anfangs ist sie nur selig und verwirrt. Sie fühlt zwar gleichzeitig Gefahr; unbewußt, mit dem Instinkte schauert sie vor der Versuchung, sie sucht zu flüchten. Eine düstere Ahnung wetterleuchtet in den Himmel voll Glück: „Je l’ai prévu, j’ai voulu fuir.“ Aber ihr klarer Wille will schon nicht mehr zurück. Zwar rettet sie sich zu ihren Schwestern und vertraut ihre Angst dem Gesang und der Dichtung, die zum erstenmal an dieser erhöhten Wärme des Gefühls in ihr aufkeimt, aber das Verhängnis ist schon im Zuge, sie ist ihm verfallen.
„J’étais à toi peut-être avant de t’avoir vu,
Ma vie, en se formant fut promise à la tienne,
Ton nom m’en avertit par un trouble imprévu,
Ton âme s’y cachait pour éveiller la mienne. —
Je l’entendis un jour et je perdis la voix,
Je l’écoutais longtemps, j’oubliais de répondre,
Mon être avec le tien venait de se confondre,
Je crus, qu’on m’appelait pour la première fois.“
Er merkt ihre Verwirrung und seine Macht. Immer dringlicher werden seine Bewerbungen. Er spricht zu ihr in Delias Gegenwart, sie wagt ihm nicht zu antworten. Sie flüchtet aus dem Haus (Zug um Zug kann man die Szene aus ihrem Gedicht verfolgen), um ihm, nein, um sich selbst, ihrem eigenen Verlangen zu entgehen.
„Je fuyais tes regards, je cherchais ma raison,
Je voulais, mais en vain, par un effort suprême,
En me sauvant de toi me sauver de moi-même.“
Aber er folgt ihr auf die Straße. Sie sind zum erstenmal allein, sie erschreckt, schüchtern, mit klopfendem Herzen, er klug und berechnend. Mit unnachahmlichem Geschick weiß er an die einzige Saite ihres Herzens zu rühren, die bisher geklungen, an das Unglück. Er weiß, daß ihre Güte stärker ist als ihre Lust, und vertraut lieber dem Mitleid als Mittlerin, als stürmisch leidenschaftlicher Werbung. Er stellt sich traurig, melancholisch, heuchelt Weltschmerz und Überdruß, und sie, die Leiderfahrene, vergißt ihn zu fürchten, weil sie ihn leiden sieht und selbst das Leiden kennt. Die Tröstung scheint ihr eine Pflicht. Nun weigert sie ihm nicht mehr das Beisammensein, und rascher folgen nun die Kapitel im Roman ihrer Liebe. Ein Rendezvous wird vereinbart. Ihr ganzes Wesen fiebert ihm entgegen, vergebens sucht sie mit einem Buche ihre Ungeduld zu täuschen, aber ihr Herz spricht lauter und überschlägt alle Worte:
„Ah, je ne sais plus lire!
Tous les mots confondus disent ensemble: il vient!“
Sie kann nicht mehr lesen, sie kann nicht mehr leben, sie kann nicht mehr atmen, sie kann nicht mehr schlafen. Aber alle diese Qualen liebt sie um seinetwillen, sie liebt diese Schlaflosigkeit, weil sie von Denken durchwirkt ist, von Denken an ihn:
„Je ne veux pas dormir; oh! ma chère insomnie,
Quel sommeil aurait ta douceur?“
Und wenn er nun naht, so weiß sie nicht mehr zu fliehen, magnetisch hält seine Nähe sie fest:
„Hélas! Je ne sais plus m’enfuir comme autrefois!“
Schon ahnt sie, daß sie ganz an ihn verloren ist und jener große Sturm über ihre Sinne gekommen, den sie manchmal auf der Bühne durch fremdes Schicksal brausen sah. Ihre Angst ist längst nicht mehr Widerstreben, sie ist bloß Furcht vor dem Neuen, Furcht vor dem Glück. Sie erkennt sich erschreckt seinem Willen leibeigen und daß gar nicht mehr sie es ist, die dem Letzten noch widerstrebt. Er kann sie nehmen, wann er will, sie fühlt es, sie weiß es. Und der Aufschrei:
„Ma sœur, je n’avais plus d’appui que sa vertu“
sagt ihr ganzes Schicksal.
Er zögert nicht länger. Der Augenblick — auch einem minder Wissenden unverkennbar — ist gekommen. Er naht drängend und glühend. Ihre Tränen scheuchen ihn zurück, eine letzte kurze Sekunde lang, aber seine sanfte Stimme, diese Stimme, deren Bezauberung sie immer und immer wieder erlag, löst ihre Arme, und sie fühlt ihre Seele entfliehen in einem ersten Kuß:
„J’ai senti fuir mon âme effrayée et tremblante:
Ma sœur, elle est encore sur sa bouche brûlante!“
Alle Bedenken des Gefühls und der Vernunft sind geschwunden, Vergangenheit und Zukunft gehen unter im Überschwang, die Sinne glühen auf:
„Et tout s’anéantit dans notre double flamme!“
Nun brechen Ekstasen aus ihren Versen, Feuergarben der Lust. Wie ein Sklave in die Freiheit stürzt sie in den Kerker dieser Leidenschaft. Nur wer das Glück nie gekannt hat, nur eine Frau, der wie Marceline die ganze Kindheit in tragischer Trauer sich verdüstert hatte, kann dermaßen aufglühen im Rausch. Sie, die nie wie die andern die Liebe vorgekostet in Spielen und Träumen, wird trunken von dem brennenden Trank seiner Lippen, sie jauchzt in der Seligkeit ihres Schwachseins, sie fiebert in der Lust, unter seiner Stimme zu erschauern. Fast zu viel scheint ihr seine Nähe, kaum kann sie „le bonheur accablant“ seiner Gegenwart ertragen. Aber um wie viel furchtbarer ist doch der Wahnsinn des Ferneseins. Sie leidet im Zuviel des Glückes und verlangt sich doch immer noch mehr. Immer tiefer dringt sie ein in die Liebe:
„Tu ne sauras jamais comme je sais moi-même
A quelle profondeur je t’atteins et je t’aime.“
Immer höher schwingt sich ihr Jubel auf, er zerreißt alle Dämme der Besinnung, und ihre ganze Seele flutet fessellos über in das neue Gefühl.
„Il n’aimait pas... J’aimais!“
Am 24. Juni 1810 trägt ein Beamter des Pariser Magistrats den Namen eines neugeborenen Kindes männlichen Geschlechts in die Register der Stadt ein und fügt der Meldung den bedeutsamen Vermerk bei: Vater unbekannt. Irgendein Freund Marcelinens dient als Zeuge, da „Olivier“, der geheimnisvolle Geliebte, nicht geneigt scheint, sich öffentlich zu bekennen. Jeder Legitimierung ihrer Beziehung setzt er den Vorwand entgegen, sein Vater würde niemals in die Vermählung mit einer Schauspielerin einwilligen. In Wahrheit denkt er nur, das ihm lästige Verhältnis zu lösen. Marceline, mit allen Sinnen trunken von Liebe und Mutterglück, ahnt nichts von dem mählichen Erkalten seiner Leidenschaft. Sie glüht ihn an mit allen ihren Flammen, voll der Sorge um ihn gibt sie dem Fliehenden noch die zärtlichsten Wünsche mit, da er ihr ankündigt, er müsse verreisen, seinen Vater zu sehen, ihn zu überreden:
„Partir! tu veux partir! oui, tu veux voir ton père...
Va, dans tous les baisers d’un enfant qu’il adore
Lui parler des baisers de l’enfant qu’il ignore:
Mets sur son cœur mon respect, mon amour;
Il est aussi mon père, il t’a donné le jour!“
In Wirklichkeit promeniert der Ungetreue aber nach Italien und bleibt lange fern. Die Nachrichten von ihm fließen spärlich; aber sie, die unendlich Gütige, die Vertrauensvolle ahnt noch nicht die volle Wahrheit. Durch Zufall erfährt sie von seiner Rückkehr und zugleich das Entsetzliche, daß er längst mit einer anderen Frau in Beziehungen steht. Wie ein Blutsturz bricht die Erkenntnis aus ihr:
„Malheur à moi! Je ne sais plus lui plaire!“
Mit einem Male wird sie der ganzen tragischen Wirklichkeit bewußt, und mit dem grauenhaften Irrtum erkennt sie schauernd die abgekartete Komödie, der sie zum Opfer gefallen. Sie erkennt, daß sie, auch diesmal wie so oft im Theater, ihr eigenes unendliches Gefühl an ein Spiel gewandt hat. Ihre Brust birst von Verzweiflung. Aber wem soll sie klagen, wem? Von Delia, der Freundin, ist sie verraten, alle andern Menschen hat sie vergessen, verloren über diesen einen. In dieser Herzensnot wirft sie sich an die Brust ihrer Schwester, und an sie gerichtet ist das unsterbliche Gedicht des Entsetzens, in dem die gellen Schreie der ersten Verzweiflung noch nicht in das strömende Metall der Worte eingeschmolzen sind. Spitz und heiß von ihrem Blute, durchstoßen die Schreie wie Dolche die zitternden Zeilen:
„Ma sœur, il est parti! Ma sœur, il m’abandonne!
Je sais qu’il m’abandonne, et j’attends, et je meurs!
Je meurs! Embrasse-moi! Pleure pour moi... Pardonne!
Je n’ai pas une larme, et j’ai besoin de pleurs.
Tu gémis! Que je t’aime! Oh! jamais le sourire
Ne te rendait plus belle aux plus beaux de nos jours.“
Sie weiß, daß er ihr verloren ist, aber sie will es nicht glauben. Sie betet, sie fleht um einen Betrug, um eine Hoffnung, weil sie die Wahrheit nicht ertragen kann. Gleichsam auf die Kniee wirft sie sich vor ihrer Schwester und bettelt, bettelt um eine fromme Lüge:
„Sans retour! Le crois-tu? Dis moi, que je m’égare,
Dis, qu’il veut m’éprouver, mais qu’il n’est point barbare,
Dis, qu’il va revenir, qu’il revient... trompe-moi,
Mais obtiens qu’il me trompe à son tour comme toi.
Va le lui demander, va l’implorer...“
Und dabei weiß sie ihn bei einer andern, sie weiß es, sie sieht es. In weißen, schlaflosen Nächten taucht das Bild greifbar nah auf:
„Oh comme il la regarde, oh comme il est près d’elle,
Comme il lui peint l’ardeur qu’il feignit avec moi.“
Und sie flüchtet vor ihm, vor jeder Bewegung, vor seinem Blick, sie rettet sich zu ihren Schwestern auf das Land, in die Einsamkeit. Sie verläßt das Theater, sie gräbt sich ein in ihre Trauer, irgendwo in einem verlassenen Winkel Frankreichs. Das Kaiserreich stürzt um sie zusammen, die Völkerschlacht bei Leipzig wird geschlagen, die Kosaken ziehen ein in Paris, aber man spürt es nicht in ihren Versen, ihren Briefen. Ihre ganze Nation, Zeit und Raum, alles ist ihr, der echten Frau, gering gegen das Gefühl. Sie weiß nur, daß sie ihn liebt, noch immer liebt, trotzdem sie längst das verwegene Spiel durchschaut. Nur um den eigenen Stolz zu retten, das Gefühl zu entschuldigen, das dem Ungetreuen doppelt getreue, forscht sie im eigenen Verhalten nach einer Schuld. Sie sucht in sich einen Anlaß zu finden. Vergebens. Sie sucht und sucht in sklavischer Demut und muß es doch gegen den eigenen Willen verneinen:
„L’ai-je trahi? Jamais! Il eût mon âme entière;
Hélas! j’étais étreint à lui comme le lierre.“
Aber trotz alledem gelingt es ihr nicht, ihn zu hassen, ihm zu zürnen. Resigniert gesteht sie’s ein:
„Ah! je ne le hais pas, je ne sais point haïr“,
und bald weiß sie, daß es mehr ist als Nicht-Hassen; beschämt, vernichtet, erniedrigt wird sie gewahr, daß sie trotz alledem noch immer Liebe für ihn fühlt. Erschreckt vertraut sie es den Versen an, erschreckt über sich selbst:
„Ma sœur, je l’aime donc toujours,
Quel aveu, quel effroi, quelle triste lumière.“
Und wie glücklich ist sie, da sie hört, daß er krank ist, wie glücklich, einen Vorwand zu finden vor sich selbst, ihn wieder lieben zu dürfen:
„Comment ne plus l’aimer quand il est malheureux.“
Endlich nach zwei Jahren Widerstand ist ihr ganz klar, daß keine Härte in ihr ist, kein Haß und kein Widerstand, und nichts als der Wunsch, ein einziger, brennender, glühender Wunsch, ihn wiederzusehen. Sie sucht, sie bettelt um eine Versöhnung, sie wendet sich an ihre Schwester, wendet sich selbst an Delia, die sie verraten hat, nur um ihn wiederzugewinnen. Bedingungslos kapituliert sie, erlöst gibt sie ihren Stolz preis:
„Fierté, j’ai plus aimé mon pauvre cœur que toi.“
Er läßt sich erbitten. Sie soll ihn wiedersehen. Und kaum daß sie es weiß, daß ihr Wunsch erfüllt werden soll, überkommt sie das alte Schreckgefühl. Sie zögert, sie sucht Entschuldigungen und findet sie schließlich:
„Dieu! sera-t-il encore mon maître?
Mais, absent, ne l’était-il pas?“
Sie weiß, daß eine neue Verbindung nicht Glück mehr sein wird wie einst, ein Glück der Wollust und des Taumels, sondern ein Glück in Tränen, Glück des Mißtrauens; aber sie nimmt das Joch freudig auf sich, obwohl seiner Schwere bewußt. Wie eine Gefangene tritt sie vor ihn hin. Ihren Stolz hat sie zertreten und ihre Scham, schauernd beugt sie den Nacken für dieses Glück der Erniedrigung:
„Prenez votre victime et rendez lui sa chaîne,
Moi, je vous rends un cœur encore tremblant d’amour.“

Constant Desbordes: Marceline Desbordes
Bleistiftzeichnung um 1820
Er hebt die Knieende zu sich empor, ein kurzes Zwischenspiel der Versöhnung beginnt. Aber dies von Demütigung und Mitleid genietete Beisammensein ist nicht von langer Dauer. Bald verläßt er sie wieder, und diesmal wird es ein Abschied für immer. Er verstrickt sich in andere Abenteuer, seine Gestalt verlischt im Namenlosen. Marceline faßt ihr Kind, ihren letzten Besitz, und wandert wieder zurück ins Leben. Die Zuflucht ihrer Liebe ist vernichtet, aber eine andere Macht im Tausch erstanden, Tröstung ihres Unglücks: die Dichterin in ihr ist geboren. Ihr Gefühl, zurückgestoßen von dem einen, entlädt sich nun gegen das All, beschwingte Verse entäußern ihre einsame Qual, ihre niedergehaltenen Tränen werden zu aufklingendem Kristall.
„Mon secret c’est un nom.“
Musik hat ihrem Schmerz die Lippen entsiegelt. Jedes flüchtigste Beben ihres Herzens ist Strophe geworden, jeden Überschwang und jedes Verzagen ihres Gefühls hat sie ein Leben lang und immer noch in der feurigen Minute des Erleidens und Wiedererleidens lyrisch bekannt. Nackt und hüllenlos hat sie dem Winde der Welt jeden Schauer ihrer Sinne, jede Schmach ihrer Seele hingegeben, aber ihre Lippen blieben bis über die Todesstunde hinaus abwehrend verschlossen, wenn es den Namen galt, den Namen jenes einen Menschen, der diesen Sturm in ihr erweckte. Alles von sich hat sie verraten. Nur ihn nicht, der sie verriet.
Fünfzig Jahre jappt nun schon vergebens die französische Literaturgeschichte hinter diesem einen Geheimnis Marcelines her, Sainte-Beuve, ihr Freund und Vertrauter, allen voran. Mit Dissertationen und Kommentaren spüren sie auf allen ihren Wegen, ihren Biographien nach, um den Namen dieses „Olivier“ irgendwo aufzudecken, durch Licht und Schatten, durchs tausendfältig blühende Gestrüpp ihrer Verse folgt die ganze Meute jeder Spur, die sie arglos am Wege sinken ließ. Jedem Seufzer schnuppern sie nach, jede versickerte Träne graben sie auf: aber wunderbar und fast unbegreiflicherweise ist ihr schlichter Wille, die tiefe Scham ihres Verschweigens und die Pietät der nächsten Anverwandten bis heute noch immer stärker geblieben als ihre eitle Mühe. Mit keinem andern Namen ist er heute noch zu nennen als „Olivier“, dem Namen, den sie in ihren Versen ihm gibt und mit dem jener einzige erhaltene Liebesbrief zu ihm spricht. Siebzig Jahre, ein biblisches Menschenalter, nach ihrem Tode ist das Geheimnis noch so stark und unentweiht wie in jeder Stunde ihres Lebens.
Das wenige, das von ihm aufzuspüren gelang, weiß man nur durch sie, durch den Verrat ihrer Leidenschaft im Gedicht. Die eine Zeile bezeugt, daß er ein Dichter war und früh schon in engerem Kreise berühmt; jene andere Stelle stellt sein Alter fest, daß er um drei Jahre jünger war als sie selbst; viele Strophen rühmen die wunderbare, zärtliche, eindringliche Stimme, die sie immer und immer berauschte; und Briefe wiederum erzählen, daß er nach Italien ging und dort erkrankte. Der merkwürdigste Hinweis aber, der für die Feststellung immer entscheidend sein muß, geht von einem Gedichte aus. Dort sagt sie, daß in ihren Taufnamen ein gemeinsamer wiederkehrt. Sie sagt:
„Ton nom...
Tu sais, que dans mon nom le ciel daigna l’écrire“,
und späterhin nochmals:
„On ne peut pas m’appeler, sans te jeter vers moi,
Car depuis mon baptême il m’enlace avec toi.“
Man mag denken, wie gierig die ganze Meute nachspürend in der Richtung dieses Fingerzeigs gestürmt ist. Marceline, Felicité, Josephe sind ihre drei Vornamen, und in der Scharade jenes andern Namens mußte also einer von ihnen wiederkehren. Dies und manch anderer flüchtiger Beweis hat die meisten verführt, Henri de Latouche als ihren Erlesenen zu vermuten. In Hyacinthe Joseph Alexandre Thabaud de Latouche ist Joseph die Bindung zu Marceline, auch der Beruf nähert sich dem Beweis, daß er ein Dichter und schon damals von einem gewissen Range war, und selbst die dritte Tatsache ist unbestreitbar, daß er als junger Mann zwei Jahre in Italien verbrachte und daß George Sand seine „sanfte und eindringliche“ Stimme rühmt. Sainte-Beuve als Schnüffler und Indiskreter in Liebesdingen, der er war (durch seinen Vertrauensbruch wurden die Briefe Mussets an George Sand vorzeitig ausgeliefert), wollte auch hier den billigen Ruhm, schon zu Lebzeiten Marcelinens als Erster das Geheimnis aufgespürt zu haben. Er wollte Gewißheit und versuchte eine List, die nicht gerade edel genannt werden kann: eine Mitteilung eines Freundes ihrer besten Freundinnen mißbrauchend, der in manchen Andeutungen auf Latouche als den vermutlichen Liebhaber Marcelines hinwies, nahm er den Tod Latouches eilig zum Anlaß, einen jesuitisch geschickten Brief an Marceline zu richten, in dem er sie (als hätte er ihn nicht selbst vertraut gekannt) um Mitteilungen über seinen Charakter befragte. Seine geheime Hoffnung war, sie würde bei diesem schüchternen Klopfen alle Türen ihres Herzens öffnen und werde, sie, die aufrichtige, heroische und in ihrer Leidenschaft unbedachte Frau, in irgendeine Zeile ein gültiges Bekenntnis ihrer einstmaligen Neigung einfließen lassen.
Und Marceline Desbordes-Valmore, die Wunderbare, ließ sich leicht verleiten, ein Requiem für den Menschen zu sagen, der ihren Versen reger Anwalt gewesen und ihr den ersten Verleger verschaffte. Ein Brief, ein Dokument menschlichen Gefühls und hinreißender Güte, ist heute noch erhalten und hier zu lesen. Er gilt den Psychologen unter den Forschern als entscheidendes und letztes Argument; denn Marceline, schöner und mühsam zurückgehaltener Erregung voll, spricht hier von Latouche zwar mit Härte und Erbitterung, aber immer wieder tadelt sie gewissermaßen ihr eigenes Gefühl und hebt die Hände flehend und beschwörend zu Sainte-Beuve empor, um ihn von einem strengen Urteil zurückzuhalten. Sie schildert alles Gefährliche Latouches, dieses zynischen und in seinem eigenen Schaffen durch ein Übermaß von Geist und Ironie gehemmten Menschen; aber ihre Nachricht findet im Negativen noch ein Verdienst, da sie von ihm rühmt, daß er weitaus nicht alles Unheil verschuldet habe, das in seiner Macht gelegen sei, und daß in seinem innern Büßen schon reichliche Vergeltung wäre für die vielen Tränen, die er verursacht. Dieses Wort von den Tränen, die er verursacht, ist den Gelehrten der Bücher und Dilettanten des Herzens schon Beweis genug. Wie die Folterknechte vermerkten sie jubelnd den erpreßten Schrei, und seit diesem Tage zischelts und tuschelts durch ein Dutzend Bücher: Latouche, Latouche.
Wirklich: die Scheingründe lasten schwer in der Wagschale des Urteils. Aber in die andere Schale senkt sich unendliches Gewicht und hebt den trüben Ballast der Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten wieder empor. Dieses Gewicht ist Marceline Desbordes-Valmores Persönlichkeit, deren menschliche Eigenschaften ganz gebunden und beseelt sind durch eine beispiellose und fast gefährlich übersteigerte Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit. Es ist kaum ausdenkbar, ihr den jämmerlichen Betrug zuzumuten, daß sie jenen Menschen als einen Fremden in das Haus Valmores, ihres Gatten, eingeführt hätte, der ihre Vergangenheit kannte aus Wort, Brief und Gedicht und der das Grab ihres vorehelichen Kindes in Brüssel gesehen. Und es ist mühevoll, ihr zuzumuten, daß sie, die Unkundigste aller Verstellung, in ihren Briefen an Latouche sich plötzlich zu so demütiger und respektvoller Förmlichkeit erniedrigt hätte, sie, die an „Olivier“ die brennendsten und aufgelöstesten Verse und Worte der französischen Lyrik geschrieben. Das Geheimnis ihres klaren Herzens überzeugt da ebenso als alle Beweisgründe der Vernunft.
Sollte aber tatsächlich, wie immer eindringlicher die Forscher auf eine bloß mündliche Nachrede hin behaupten, Latouche jener Olivier gewesen sein, dann bereitet jene erste Tragödie des verführten Mädchens nur noch eine viel grausamere, eine Tragödie der Mutter vor, wie kein Roman sie kühner und grausamer zu entsinnen gewagt hätte. Denn dieser Latouche, der einundzwanzigjährig mit Marceline bekannt war und ihre ersten Verse auf orthographische Fehler korrigierte, er ist ja — verwirrender Gedanke! — derselbe, der unter der Maske des biedern hilfreichen Familienfreundes mehr als fünfundzwanzig Jahre später Ondine, die Tochter Marcelinens, zu verführen sucht und die sie nur mit Mühe (ihre Briefe zittern vor Schrecken) vor ihm schützt. Derselbe Latouche, dem sie heimlich jenen Knaben geboren hatte, der unter geborgtem Vatersnamen auf dem Friedhof begraben liegt, derselbe sollte dann fünfundzwanzig Jahre, ein Vierteljahrhundert später als Verführer ihre Tochter begehren — eine Vorstellung für mich, die das Gefühl kaum zu umfassen vermag. Zwar gellen tatsächlich jene Briefe an ihren Mann, der Latouche damals freundschaftlich besucht, von schrillen Warnungsschreien: kein Gedanke wäre ja wirklich einer Mutter fürchterlicher als jener, ihr eigenes Elend von ebendemselben noch einmal an ihrem Kinde verschuldet zu sehen, und wirklich zwingt sie ihren Gatten, damals von Latouche ein Jugendbildnis zurückzufordern. Aber warum dieser Zorn bei ihr, der Verzeihenden, erst nach zwanzig Jahren, warum so späte Vorsicht bei der immer so Unbedachten? Trotz aller vorgebrachten Wahrscheinlichkeit wehrt sich deshalb mein Gefühl unwillkürlich gegen diesen Latouche und gerade gegen ihn, bis nicht ein Zufall statt Andeutungen endgültigen Beweis erbringt.
Mögen sie weiter spüren: ich weiß nichts Schöneres, als daß dieser Name noch immer nicht gefunden ist, das große Geheimnis ihres Herzens nicht unwidersprechlich entsiegelt. Denn wie wenig wäre dies, das Gewonnene: ein Name, ein Hauch von Worten in der Luft, ein flüchtiges Silbenpaar gegen das tiefsinnige Symbol der Anonymität, gegen dies, daß er nichts blieb für uns als für sie: das Namenlose in ihrem Leben, das Erlebnis. Er war nur der Ruf, die Macht, die ihr entgegentrat, die Form, in die ihre harrende aufgespeicherte Liebe einströmte, der Lehm, der zerbrochen wird, sobald der heiße Guß an ihm sich gegestaltet. Er hat keine selbsttätige Bedeutung für ihr späteres Leben und hat keine Schuld. Denn wenn er mit ihrem Herzen tändelt und unbewußt jenen ungeheuren Brand verschuldet, so ist er ebensowenig verantwortlich wie ein Kind, das mit dem Zündholz spielt und eine Feuersbrunst entfacht. Die ganze Tat dieses „Olivier“ war, daß er nahte, daß er die Stunde war. Er brauchte ihr nur die Tiefe zu weisen, in die ihr durch den Schutt der Sorgen, den Schlamm der Entbehrung zu lange aufgestautes Gefühl selig schäumend hinabstürzen konnte, und schon hatte er sein, hatte er ihr Schicksal erfüllt. Er gab ihr Gelegenheit zu lieben, und damit ist seine Bedeutung erschöpft. Wie er sich menschlich verhielt, bleibt gleichgültig, denn seine Macht über ihr Gefühl ist damit zu Ende. Er konnte sie dann verlassen oder mißhandeln, sie wieder aufnehmen und neuerlich verlassen, aber er konnte ihr Gefühl nicht mehr steigern und nicht mehr dämmen, es war schon jenseits seines eigenen Willens und Gewissens. Er konnte nur mehr Schmerz häufen oder Lust, ihre Stimmung verwandeln, aber nichts mehr ungültig machen, nicht mehr die aufgebrochene Blüte ihrer Leidenschaft zurückdrängen in die Knospe, diese wundervolle purpurne und unverwelkbare Blüte, die er mit flüchtigen Fingern spielend aufgeblättert.
Man kann es nachfühlen, was ihn zu ihr drängte, verstehen, was ihn lockte. Süßer noch als bei einer Halbwüchsigen die frühe Leidenschaft, mochte es ihn reizen, hier in einer Verschlossenen und Verspäteten unter der Asche von Sorge und Trauer noch einmal die Lohe mit einem Atemhauch aufglühen zu lassen. Und noch besser vermag man zu verstehen, was ihn von ihr entfernte. Er wollte ein Spiel, wollte diesem schüchternen, von allen Geistern der Not und Entbehrung aus den Gärten ihrer Kindheit gejagten Mädchen die erste Frucht zärtlicher Worte reichen. Aber die Erweckte ist eine andere. Aus ihrem schmalen Körper brechen Flammen der Exaltation, ihre Sanftheit löst sich plötzlich in einen bacchantischen Taumel der Leidenschaft, sie preßt sich mit einer unvermuteten Trunkenheit an den Erstaunten, mit einem Durst, als wollte sie von ihm allein alle Seligkeit des Himmels und der Erde trinken. Er will eine Geliebte und findet die Liebende, er begehrt in ihr die Frau, die wunderbare, die vielfältige, die neue, und sie ist die glühende, immer die gleiche. Er will die Lust, und sie gibt ihm die Liebe. Er will Stunden, und sie bietet ihm die ganze Unendlichkeit. Man sieht es deutlich aus ihren eigenen Bekenntnissen, daß er zurückschrak vor ihrer maßlosen Hingabe, vor dem vulkanischen Ausbruch ihrer Liebe, denn für sie, die Entbehrende, der niemals etwas zu eigen war von irdischem Besitz, wird das Gefühl zur Welt, und sie dehnt es zur Unendlichkeit. Übermaß ist ihr einziges Maß in der Liebe: immer lodert sie, jedes Wort, jede Regung setzt sie in Brand. Mit Tränen antwortet sie auf kleines Gelüst, mit Tränen des Jubels, mit dem Schluchzen der Verzweiflung. Tränen sind ihre einzige Sprache in der Liebe. Immer sieht er, der kühle Lovelace, in feuchte Blicke, in schauerndes Antlitz: sie hat nur diese eine Antwort, immer nur die eine:
„L’amour n’eut jamais de moi que des larmes.“
Tränen, Tränen sind ihre Welt, „pleurs“ und „larmes“ ihrer Verse häufigster Reim. Ihre Leidenschaft tut weh, sie ist zu heiß, sie versengt, sie verbrennt. Vergebens versucht sie selbst, dieses Übermaßes bewußt, sich zu dämpfen und ersehnt beschaulicheren Genuß. Sie möchte selbst gerne heiter werden durch die Liebe, sie als Spiel erlernen:
„Je voudrais aimer autrement.
Pour moi l’amour est un tourment,
La tendresse m’est douloureuse.“
Und dieser Kontrast zwischen ihm, dem Spielenden, und ihr, der Ekstatischen, wird immer größer im Abstand ihrer Beziehung. Sie vermag sich nicht zu mäßigen, er nicht sich zu steigern. Er, der sie emporlockte, kann ihr nun nicht mehr nach. In dem Äther des Gefühls, zu dem sie ihn aufreißen will, jappt er, der Gleichgültige, nach Luft. Und so wehrt er sich gegen diese Verkettung. Gegen ihre Güte kämpft er mit Grausamkeit, gegen ihre Hitze mit Kälte. Aber sie ist gepanzert mit ihrer Liebe, und ihre Waffe ist Vergebung. Er höhnt sie mit Untreue, und sie vergibt ihm; er quält sie mit Lüge, und sie verzeiht ihm; er flüchtet vor ihr, doch ihre Liebe läßt nicht nach. Immer tiefer treibt ihn das Verlangen, den letzten Grund ihrer Güte zu finden, ihre Hingabe zu versuchen, wie man Gott versucht. Aber er vermag nur ihr Leben zu zerstören, sie unglücklich zu machen, bleibt aber ohnmächtig gegen die dämonische Gewalt dieser Liebe, die er nicht mehr dämmen, nicht mehr zerstören kann. Stanzt er ihr Haß ins Herz, gießt er die Säuren der Selbstverachtung, die Ätzungen der Qual ihr in die Brust, so saugt ihr Gefühl all dies gierig auf und verwandelt es wieder in Liebe: sie kann sich nur steigern und nicht mäßigen. Was immer er tut, es bleibt ohne Gewalt über sie, und selbst sein Entschwinden vermag sie nicht zu berauben. Wir haben in der Weltliteratur kaum ein schöneres Beispiel von der ungeheuren Macht, die der Erste, der Verführer über das ganze Leben einer Frau ausübt, jener Erste, der ihren Körper aufschließt und das aufgesparte Gefühl aus den Adern bis zu den Lippen jagt. Denn dieser Mensch — oder schon der Traum von ihm — zehrt im Leben der Desbordes-Valmore das Edelste an Liebesfähigkeit auf, das Göttliche, das Maßlose, den Überschwang. Was sie später gibt, ist gemessene Güte, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Sinnlichkeit, aber immer nur Einzelnes, nie jener elementare Ausbruch ihres ganzen Wesens, dies Ausstürzen ihrer Weiblichkeit. Ein anderer Mann tritt später an ihre Seite, und sie ist ihm treu als Gattin, aber in seinen Armen noch bekennt sie: „Je ne sais pas comme on oublie.“ Nur durch höchste Aufrichtigkeit vermag sie dies seltene und doch so seelenwahre Wunder der zwiefachen Liebe zu erfüllen, denn noch als alte Frau fühlt sie sich in manchen Stunden nicht dem erwählten Manne, sondern dem erträumten zu eigen. Wie Wetterleuchten zuckt aus jenen Fernen immer wieder Bezauberung in ihr längst beruhigtes Leben hinüber; fünfzigjährig, auf einer entbehrungsreichen Komödiantenreise mit ihrem Gatten in Italien, fühlt sie vor der neuen Landschaft nur den einen Schauer, daß „seine“ Schritte vor dreißig Jahren hier geweilt, und unvermutet bricht aus einem Briefe des Jahres 1836 an die Freundin der bekennende Schrei: „Das einzige Herz, das ich mir von Gott erbeten hätte, hat das meine nicht gewollt.“ Nie kann sie, im Glück und im Elend nicht, jenen Ersten vergessen. Treu dem Gatten, ist sie, die Dankbare, auch treu dem Gefühl, nie verleugnet die Frau in ihr jenen fernen und fast schon mythischen Gott ihrer Kindheit, der sie zum Weibe schuf: in Valmore liebt sie treu den Mann und ihrer Kinder Vater, und in dem Entschwundenen, in „Olivier“, ebenso treu das Phantom ihrer Träume, das Übermaß ihres eigenen Gefühls. In „Olivier“, dem Verführer, liebt sie ein ganzes Leben lang die Liebe.
„Toutes les humiliations tombées sur la terre
à l’adresse de la femme, je les ai reçues.“
An Pauline Duchambge
Am Tage, da ihr Geliebter sie verlassen hat, verläßt sie Paris. Sie hofft, sein Fernsein besser zu ertragen in der Ferne, und flüchtet vor seiner Nähe, der ersehnt-verhaßten, nach Brüssel, wo sie am Théâtre de la Monnaie Anstellung findet, und zwar eine vortreffliche. Anfangs wird sie dort wenig beachtet, denn drei Stunden von der Stadt donnern die Kanonen von Waterloo, und der Zusammenbruch des Kaiserreiches übertönt Gespräch und Gesang. Die Tragödie der Welt ist zu laut und zu nahe, als daß man auf den falschen Donner der Bühne hörte.
Aber bald wird man ihrer mit Bewunderung gewahr. Ihre Kunst ist reif geworden im Erlebnis, aus der schmerzgeweiteten Brust bricht nun voller der dramatische Aufschrei. Jetzt erst wird sie die Heroine. Ihr Wesen, einst nur fähig, kindliche Schüchternheit, Einfalt und Bangen zu verkörpern, vibriert nun von Sinnlichkeit und Leidenschaft, ihr Schmerzruf hat eine wundervolle Resonanz aus tiefstem Empfinden, und die gesprochenen Verse beseelt der melodische Rhythmus ihrer Dichtung.
Erfolg hat aber niemals für Marceline Desbordes-Valmore Glück bedeutet. Nur als Lärm hat sie ihn empfunden, als Schall aus der Ferne, niemals körperlich, nie als Welle, die ihr Leben heben oder senken konnte. Sie weicht allen Versuchungen aus, sie riegelt sich ab gegen die Welt, sie klammert sich an das einzige, was ihr geblieben ist, an ihr Kind:
„Gage adoré de ses tristes amours“,
und sucht in den unschuldigen Zügen das fremde und geliebte Gesicht. Sie will ihr Leben abschließen, beschränken, begrenzen. Aber das Schicksal hat eine seltsame Feindschaft gegen sie. Ein Fluch ist ihr geschworen von einem unbekannten Gott, der ihr Rast versagt. Ihr Schmerz, der fruchtbare, soll ewig feuerflüssig erhalten werden, und so wühlt das Schicksal ihn immer von neuem auf, so wie man die strömende Erzglut beständig bewegt erhält, damit sie nicht Schlacken bilde und zu früh in kalten Formen erstarre. Immer wieder wird ihr Neues gegeben, aber immer nur zur Leihe, immer etwas geschenkt, darin ihre Sehnsucht sich einwurzeln könne, um es dann ihr zu entreißen und das Erdreich ihrer Seele schmerzhaft aufzuwühlen. Kaum läßt das Leben ihr Rast, so mengt sich der Tod in ihr Geschick. Ihre Freundin, die einzige, von der sie Zuspruch und Gespräch in diesen Tagen hat, bald darauf ihr Vater, sterben plötzlich hin, und wenige Wochen später wird auch ihr Letztes durch Krankheit bedroht, der fünfjährige Knabe. Wie eine Rasende kämpft sie gegen das Verhängnis zwei Monate lang, aber es ist vergebens:
„Après soixantes jours de deuil et d’épouvante
Je criais vers le ciel: Encore, encore un jour!
Vainement! J’épuisais mon âme tout entière...
Je criais à la mort: Frappe-moi la première!
Vainement! Et la mort, froide dans son courroux
En moissonnant l’enfant, ne daigna pas atteindre
La mère expirante à genoux.“
Der Knabe stirbt. Innerhalb eines einzigen Jahres hat sie alles verloren, was ihr das Schicksal geschenkt:
„J’ai tout perdu, mon enfant par la mort
Et mon ami par l’absence.“
Ihre Verzweiflung ist unbeschreiblich. Aus ihren Briefen brechen wilde Schreie, die nichts anderes mehr ersehnen als den Tod. Sie ist wieder so arm, so verlassen wie damals, als sie im schwarzen Kleide, eine Waise, am Landungsplatz in Havre stand, aber nun noch viel mehr, weil ihr Leben geschwächt ist von dem früh verlorenen Kind und ihre Seele zerrissen von der Verachtung des Geliebten. Nun erst, da sie Besitz gefühlt, wird die Entbehrung zum Schmerz. Vergebens sucht sie ein Ende. Von dem Tod hält sie die Gläubigkeit zurück, so sucht sie der Welt zu entweichen durch Flucht. Wie eine Nonne in ihre Zelle, gräbt sie sich lebendig ein. Sie will nichts mehr haben, nichts mehr hören, an nichts mehr sich binden, da ihr doch alles genommen wird. Die flüchtigen Stunden der Komödie sind die einzigen, da sie zu Menschen spricht, und da sind es nicht ihre Worte, sondern erlernte. Jedes wirkliche Wesen ist ihr Feind, jeder Blick tut ihr weh, denn alles wird Vergleich und Erinnerung. Der Kelch ist voll. Es gibt aus diesen Jahren ein Gedicht „Les deux mères“, das in einer Szene ergreifend schildert, wie selbst unschuldigster Anlaß in der Gequälten die Narben aufsprengt. Ein Kind naht ihr auf der Straße, freundlich mit in Liebe ausgebreiteten Händen tappt es ihr näher, und sie, fast auf den Knieen fleht sie das Fremde an, ihr nicht zu nahen, denn es ist Erinnerung:
„Vous qui m’attristez, vous n’avez en partage
Sa beauté ni sa grâce où brillait sa candeur.
Oh! mon petit enfant, mais vous avez son âge
C’en est assez pour déchirer mon cœur.“
Und mit dem verlorenen Kinde scheint auch ihre Jugend zu Ende. Ein Flor des Leidens umschleiert ihre Augen; sie, die nie heiter war, ist nun düster geworden und herb. Die vielen Tränen haben den Schmelz der Jugend von ihren Wangen gewaschen, die Stimme ist brüchig und weigert sich dem Gesang. Unendlich ist ihre Einsamkeit. Sie lebt in der Welt wie Ariadne, die Verlassene, auf der wüsten Insel Naxos, nur der Klage und dem Gebet. Bacchus, der glühende, der Gott der Trunkenheit, hat sie verlassen, der Rausch der Liebe ist geschwunden, und nun wartet sie nur auf einen mehr, auf den Tod. Sie hört ihn nahen, schon breitet sie ihm die Arme entgegen, um hinzusinken aus dieser Welt in das ewige Dunkel. Aber sie ahnt nicht, daß, der naht mit beflügelten Schritten, Theseus ist, der Befreier, sie nochmals zurückzuführen ins lebendige Leben.
„Il n’y a rien de si sincère que mon cœur,
Je ne puis le donner qu’en donnant ma vie.“
Im Theater ist damals als Partner heroischer und leidenschaftlicher Konflikte ein junger Schauspieler engagiert, Valmore, vom weiblichen Publikum Brüssels bald der „schöne Valmore“ genannt. Sproß einer adeligen Familie, Neffe eines kaiserlichen Generals, der in der Schlacht an der Moskwa sein Leben gelassen, hatte er sich dem Theater durchaus nur um künstlerischer Neigung willen verschrieben. Zu spät gekommen in der Weltgeschichte, um auf der Lebensbühne unter Napoleon zu kämpfen, will er Held und Konquistador zumindest im Spiele sein. Er ist sieben Jahre jünger als sie, darstellerisch zwar nur mäßig begabt, aber doch gewinnend durch seine ritterliche Erscheinung und die fast herrische Aufrichtigkeit seines Wesens. In den Stücken geben sich die beiden oft das Stichwort der Liebe von Mund zu Mund, er hat die Werbung, sie den Widerstand, und aus dieser regen Gewohnheit des Tausches erborgter Gefühle wächst allmählich eine gewisse menschliche Vertrautheit.
Und dann — in der Biographie Marcelinens ist jede Episode immer dramatisch motiviert —, diese beiden Komödianten, die hier Zufall oder Bestimmung auf den Brettern eines Provinztheaters zusammenführt, diese beiden fremden Existenzen, haben vor vielen Jahren einander gestreift. Vor sechzehn Jahren, als die Halbwüchsige nach Guadeloupe reiste und in Bordeaux um ein paar Franken auf der Schaubühne agierte, hat sie dort in befreundeter Familie einen kleinen Knaben auf den Knieen geschaukelt. Sie hat mit ihm geplaudert, sich an seiner klugen Anmut gefreut und schon damals mit ihm unschuldig schwesterlichen Kuß getauscht. Ihre Lippen kennen einander: dieser Knabe aus Bordeaux, dieser lang vergessene Gespiele einer Stunde, war Valmore gewesen. Das Entsinnen der kindlichen Episode flicht rasche Freundschaft zwischen den Erwachsenen.

David d’Angers: Marceline Desbordes
Medaillon um 1832
Valmore aber erwidert ihr Gefühl der Freundschaft mit lebhafterer Neigung, und allmählich erwächst ihm der Wunsch, sich der verehrten Frau dauernd zu verbinden. Noch wagt er nicht, sich zu erklären, er hat Scheu vor dem Wort. Ein schöner männlicher Stolz verbietet ihm stürmische Werbung, um sich die rasche Abweisung der Erschreckten zu ersparen. Kund ihres Unglücks weiß er vielleicht, daß man die tiefe Resignation ihres Herzens erst Stufe um Stufe mit sachter Hand, wie eine Kranke wieder emporführen müsse ins Vertrauen. So wählt er des Wortes behutsamere Form: den Brief. Obwohl ihr täglich nah, schreibt er ihr einen Brief, in dem er sich gewillt erklärt, die Redlichkeit seiner Gefühle durch eheliche Liebe zu erweisen.
Marceline erhält den Brief, sie erschrickt und will den werbenden Worten nicht glauben. Sie blickt in den Spiegel: das Salz der Tränen hat ihre Wangen aufgelaugt, der Schmerz mit spitzem Stichel den Augen Furchen eingegraben, sie fühlt sich verbraucht, unwertig und verblüht. Einunddreißig ist sie den Jahren nach und innerlich viel älter, er aber, der Jugendfrische, vierundzwanzig, — wie darf sie da ihn binden, sie, die selbst gebunden ist an Erinnerung und, wie ihr dünkt, an untilgbares Leid? Denn selbst in dieser Sekunde des Glücks fühlt sie, daß ihr Herz nichts vergessen kann, daß Olivier, des Unbekannten Bild, ewig in ihrer Seele brennt. Sie ist entschlossen zur Treue, zur Abwehr. Aber doch, es lockt so seltsam, noch einmal das Leben zu beginnen, noch einmal aus diesem unendlichen Abgrund von Trauer und Entbehrung emporzusteigen in das Licht.
Sie antwortet Valmore in einem Brief, der ablehnt und doch zögert zugleich. Er will Absage aussprechen und scheut sich doch, unwiderruflich zu werden. Sie bittet ihn, sie zu schonen. „Versuchen Sie nicht, mein Herz mit Gefühl zu erfüllen, ich habe so viel gelitten, und traurig wie ich bin, tauge ich nicht mehr zur Liebe.“ Sie warnt und warnt, sie verneint die Möglichkeit eines neuen Gefühls und bezeugt es ihm doch durch ihre Furcht vor neuer Prüfung und die Bitte, sie zu schonen. Sie bietet ihm an, Brüssel zu verlassen, wenn das Beisammensein mit ihr ihn quäle, sie warnt und wehrt ab. Aber doch, sie findet kein Wort, das ein hartes Nein sagt. Denn dies ist zu neu, zu selig schön für die Enterbte, dieser ungewohnte Schauer, zum erstenmal nicht nur zu lieben, sondern einmal auch wahrhaft geliebt zu sein.
Valmore mißversteht sie. Er meint, ihr Zögern bedeute, er sei zu gering für sie, die gefeierte Schauspielerin, die Erste des Theaters. Noch kennt er nicht die ganze Tiefe ihrer Glücklosigkeit. Er will sich entfernen, aber schon ruft sie ihn zurück. Sie beeilt sich, ihm zu antworten, ihm zu versichern, wie sehr sie ihn achte, und in dieser Hochschätzung klingt schon ein erster Unterton von Neigung. Valmore wird sicherer, er wirbt nun dringender und heißer. Immer weicher wird der Ton in ihren Briefen, immer nachgiebiger. Sie will es noch nicht glauben, daß man sie wieder zum Leben erlösen will, und glaubt es doch schon. Sie schämt sich ihres eigenen Wankelmuts, nach so großem Gefühl so bald eines zweiten fähig zu sein, und ersehnt es doch schon mit allen Sinnen. So fremd ist ihr das Glück geworden, daß sie sich davor fürchtet und beinahe wieder ihr Leid zurückwünscht:
„Je tremble d’être heureuse et je verse des larmes;
Oui, je sens que mes pleurs avaient pour moi des charmes
Et que mes maux étaient mes biens.“
Sie ist sich bewußt, daß sie nicht vergessen kann, aber sie fühlt sich stark genug, auch mit einer Wunde im Herzen einem andern Manne sich zu vereinen. Sie hat ihn gewarnt, sie warnt ihn bis zum letzten Augenblick. In Aufrichtigkeit bietet sie ihm ihr ganzes Leben dar, aber er begehrt es stark und glühend, und mit einem gewissen Jubel stimmt sie schließlich zu.
Es ist rührend, in diesen ihren Briefen zu lesen, wie fremd sie dem Glück geworden ist. Ein Wunder von Gott ist ihr diese Wendung. Sie kann es gar nicht begreifen, sie faßt es kaum, dieses vergessene Wort, dieses verlorene Gefühl. Gleichsam aus einem Kerker taumelt sie an das Licht, und ihre Augen sind blind, sie wagt nicht zu schauen. „Wie, das Leben ist also doch das Glück?“ stammelt sie in einem Brief, einen Tag nach der Vermählung: „Ich bin glücklich! Wie doch meine ganze Seele sich auftut diesem vergessenen Wort, das für immer ausgelöscht schien.“ „Sag mir, Geliebter, wo ich bin, sag mirs doch, ich weiß es nicht mehr. Laß mich noch einmal einen solchen Brief lesen, der mir das Herz verbrennt.“ Sie stammelt, sie taumelt unter diesen ersten Tagen. Und was das Wundervollste ist, das Unwahrscheinlichste, daß dieses Glück über ein ganzes Leben hin dauert. Denn in ihrem ersten Erlebnis ist sie eine andere geworden. Sie ist nun fähiger, einen Mann zu beglücken, weil sie resignierter ist. Sie will nicht mehr alle Himmel umfassen, sie will nicht mehr glücklich sein, sondern als wahre Frau nur glücklich machen. Nichts begehrt sie für sich fortan, alles nur für ihn. Ein wunderbarer Kampf beginnt nun in diesen beiden für viele Jahre, ein Kampf der Demut gegen Demut. Beide fühlen sie sich minderwertig, einer gegen den andern. Er empfindet ihre Überlegenheit als Schauspielerin, als Dichterin, fühlt den Adel ihrer Menschheit und beugt sich vor ihr. Sie wieder spürt nur das eine, das Wunderbare, in einer immer wieder erneuten Dankbarkeit, daß er jünger ist als sie, sieben Jahre, und er ihr freudig seine strahlende Jugend geschenkt hat, und sie beugt sich vor ihm. Er hat sie ins Leben gehoben und Kinder aus ihrem abgestorbenen Leib erweckt, dafür dankt sie ihm Tag für Tag. In den Briefen der alternden Frau brennt gleich heiß wie in denen am Tage der Vermählung ihre Glut, und er wiederum faßt ungelenk, um einmal in ihrer Sprache zu sprechen, seine Gefühle in Versen zusammen. Keines ihrer Liebesgedichte ist vielleicht so rührend als dies Gedicht, das sie erweckt, dieser ungeschickte Versuch eines nüchtern-redlichen Menschen, Worte in Reime zu pressen, um auch ihr in ihrer Weise zu dienen. Die entsetzliche Angst, er, der Jüngere, könnte sie, die Alternde, betrügen und mißachten, sie möchte nochmals verstoßen werden von der Liebe, schwindet selig dahin. Tag für Tag erstaunt sie immer wieder aufs neue, noch immer geliebt zu sein, und bewundert seine Redlichkeit. Immer bleibt sie die Erstaunte, daß auch ihr Liebe gelte, immer die Dankbare. Und nun endlich darf sie sich hingeben, verschwenden, aufopfern, Tag für Tag, und die furchtbare Mühsal ihres äußeren Lebens macht dies Opfer zu einem unaufhörlichen.
Manchmal fällt noch ein leichter Schatten vergangener Zeiten in ihr Glück. Valmore leidet im geheimen sehr, immer zu spüren, wie unvergessen jener andere ist. Er hatte gehofft, nun werde ihm, der sie nochmals die Liebe gelehrt, mit ihrem Leben auch ihre Dichtung gelten. Das Bild jenes andern, der sie gequält und verachtet, werde verschatten im erneuten Glück. Aber Marceline Desbordes-Valmore ist unfähig zur Lüge. Ihre Dichtung, die aus dem traumgewordenen Erleben der Jugend aufsteigt, scheint geheime Gesetze zu haben, gegen die sie selbst nichts vermag. Inmitten ihrer Ehe schreibt und veröffentlicht sie jene schmerzvollen Elegieen an Oliver, den einst Geliebten, und Valmore, der all ihre lebendige Liebe hat, muß den Druck von Versen überwachen, die einem andern gelten. Seltsamere Qual ward nie einem Gatten ersonnen. Aber Dichtung ist stärker als ihr bewußter Wille. Nicht das Glück inspiriert diese Frau, sondern das Tragische, nur die Träne erlöst ihr das Wort, und darum gelten ihre Verse einzig dem, der ihr Gefühl zur Qual der Liebe aufrief, und fast nie jenem, der sie beglückte. In Valmore liebt sie den Mann, den Gatten, in Olivier die Liebe selbst, die Quelle des Leides, das ihr tiefstes Glück aufwühlt. Sie bezeugt in ihrer unendlichen Aufrichtigkeit, daß im Leben einer Frau doppelter Raum für Liebe ist, für die der Wirklichkeiten und die des Ideals, und daß das Unvergessene, im Leibe längst erstorben, in den tiefsten Schluchten des weiblichen Gefühls unerreichbar verborgen bleibt, daß Erlebnisse nicht absterben mit dem Erlebten. Sie sieht Valmore leiden an ihren Geständnissen, aber sie vermag ihre Dichtung nicht zu beherrschen: ihre Aufrichtigkeit ist stärker als ihr Wille. Sie ist machtlos gegen die eigene poetische Gewalt. Vergeblich müht sie sich, ihm seine Eifersucht auf die Verse auszureden:
„Ces poésies qui pèsent sur ton cœur“;
sie fügt ihrem Mädchennamen als Dichterin immer den seinen bei, nennt sich Marceline Desbordes-Valmore, um öffentlich ihre Verbindung zu bekunden. Alle kleinen Listen des Herzens wendet sie an, sie beschuldigt sich der Übertreibung, und ist zweifellos aufrichtig in der Sekunde der Verzweiflung, da sie ihre Dichtung verflucht, weil sie Mißstimmung aussäe zwischen ihnen. Wie selig ist sie darum, wenn sie auch ihm etwas zu vergeben hat. Spät, mit siebenundvierzig Jahren, gesteht er ihr, der Vierundfünfzigjährigen, daß er sie mehrmals betrogen habe. Und beinahe beglückt antwortet sie ihm in dem wundervollen Brief: „Es wäre ein Wunder, hättest Du den Versuchungen Deines Alters und Deines Berufes entgehen können! Glaube mir, es ist einzig wichtig, daß sie nicht die Unzerreißbarkeit unseres Bundes vernichten konnten. Keiner Frau nehme ich es übel, Dich liebenswert gefunden zu haben, mein teurer Freund. Viel eher hätten sie es mir nicht vergeben dürfen, Deine Frau zu sein und — offen gesagt — ein solches Glück nicht zu verdienen.“ So, mit Güte und Aufrichtigkeit knüpfen sie immer aufs neue das Band, das sie aneinanderhält; selbst die Armut, die ewige und unerträgliche ihrer Tage, kann die Reinheit ihrer Existenz nicht vergiften. Immer findet ihre Hingebung neue Formen des Aufschwungs und schließlich auch die edelste Wendung: sie verzichtet ganz die Geliebte zu sein, um des neuen Glückes willen, ihn neu und anders lieben zu dürfen. Früh blinkt ihr Schnee auf dem Scheitel, und nun umgibt sie Valmore, den Gatten, mit einer wundervollen Mütterlichkeit. Er wird gleichsam ihr ältestes Kind, das Sorgenkind, dem sie sich müht, eine Stellung zu finden, den sie behütet, pflegt und berät. Sie muß ihn, den schlechten Provinzschauspieler, der nirgends ein Engagement findet, in Rouen ausgepfiffen, in Paris nirgends angenommen wird, immer wieder trösten über die schmerzhaften Niederlagen seiner Eitelkeit, sie muß den zweifelhaften Komödianten und doch wackern Mann dreißig Jahre darüber hinwegtäuschen, daß sie es ist, die mit Arbeit und Qual die ganze Familie erhält. Erst wie der künstlerische Wahn ihm zerrinnt und er eine kleine Stellung an der Bibliothek findet und nun nichts mehr ist als Vater und Gatte, kommt eine Art Ruhe in den zerrissenen Haushalt. In den späteren Briefen mischen sich der Leidenschaft des Gefühls immer mehr und mehr hausmütterliche Ratschläge bei, die Ehe wandelt sich in Mutterschaft und Geschwisterlichkeit. Und aus der Ferne ihrer Jahre, dem gefährlichen Unterschied des Alters, wird durch ihre Güte und Resignation immer neue Nähe und ein noch innigerer Verein.
„Depuis l’âge de seize ans j’ai la fièvre
et je voyage.“
Die Not und Entbehrung ist nun aus ihrem Herzen gescheucht. Aber sie läßt ihr liebstes Opfer nicht und umstellt von außen ihr Leben. Vergeblich sucht das Komödiantenpaar nach einem Nest. Die Brüsseler Truppe löst sich bald auf, sie streben nach Paris; aber Valmore, dessen mindere Qualitäten als Schauspieler mit dem Schwinden der Jugendlichkeit immer sichtlicher werden, erweist sich dort als Hemmnis für ein gemeinsames Engagement. Wieder wirft sie die Welle in die Provinz zurück von Strand zu Strand, jahrelang treiben sie dort, von allen Stürmen des Mißgeschicks gejagt und herumgefegt, zwanzig, dreißig Jahre, nirgends heimisch, überall wieder vertrieben. Nächtelang, tagelang, mit kleinen Kindern und dem ganzen Hausrat wandern sie von Ort zu Ort, immer wieder wird ihr ganzer Lebensbestand auf Karren geladen, immer wieder Kontrakte und Kündigungen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Ein paar Jahre ruhen sie in Lyon, aber es ist Rast auf einem Vulkan, denn die Industriestadt ist fiebrig aufgewühlt von Arbeiterrevolten, in den Straßen werden die Menschen niederkartätscht, und dem Volke vergeht bald das Gelüst auf Komödie.
Der Traum der Kunst ist längst erloschen, es ist nur ein hartes Metier, das die beiden um ihrer Kinder willen betreiben, Broterwerb, Handwerk ohne Redlichkeit, dem Mißgunst und Neid bald die letzte Freude nehmen. Selbst zwischen ihnen beiden droht Zwietracht emporzuwuchern, denn immer deutlicher zeichnen sich die Erfolge Marcelinens von den zweifelhaften Triumphen ihres Mannes ab; doch diese Gefahr bietet erwünschte Gelegenheit, die Größe ihrer Hingabe zu beweisen. Rasch entschlossen gibt sie den Beruf auf, läßt die Heroine, um nichts mehr zu sein als Hausfrau und Mutter, Heldin des Tages. Unglück und Kindbett haben ihren Körper matt gemacht, ihre Stimme durchsiebt. Empfindlich für Mißachtung, gleichgültig gegen Ruhm, ist sie längst schon müde, täglich fremden Menschen ihre Tränen zu geben; ein Grauen faßt sie an, wenn sich abends die Lichter entzünden, ein Grauen, die Furchen ihres Gesichts mit Schminke zu füllen, und kaum daß sie resigniert hat, so jubelt sie schon über ihren Entschluß. „Nicht mehr Theater zu spielen, ist eine Art Glück, das ich bis zu Tränen empfinde.“
Nun ist er, Valmore, das Haupt der Familie, Erwerber und Erhalter. Sorge wächst ihm damit zu, aber auch Selbstgefühl. Zuerst kämpft er noch in den großen Städten, aber in Lyon ausgepfiffen, meidet er die besseren Bühnen und schleppt sich von Provinz zu Provinz. Marceline bleibt in den ersten Jahren seine Begleiterin, dann aber fordern die Kinder ihre Gegenwart, und nur von ferne vermag sie ihn mit Briefen aufzumuntern. Sie verschweigt ihm zärtlich die tausend Sorgen, die ihr den Tag zerstücken und die Nacht wegstehlen. Denn sie kämpft einen tagtäglichen heroischen Kampf, um ihre kärgliche Existenz zu sichern; und diese große Dichterin, der Frankreich schönste und unvergeßliche Verse dankt, ist in allen Jahren der Entbehrung gleichzeitig der einzige Dienstbote des ganzen Hausstandes. Sie näht die Kleider der Kinder, sie wäscht, sie schneidert, sie kocht; nachts nach aller Mühe und Sorge schreibt sie sentimentale Novellen und Romane, um ein paar Franken zu verdienen. Sie arbeitet dreißig Jahre wie eine Verzweifelte, sie verkauft ihren letzten Schmuck, den Ring, den er ihr zur Vermählung gab; sie sucht nach Stellungen, sie bettelt beinahe, und an dieser Ärmsten der Armen hängen noch andere Lasten. Der Bruder, in englischer Gefangenschaft, quält unablässig um Geld, sie muß sich von ihrem eigenen Nichts etwas absparen, um ihm einen Notpfennig zu senden; die Familie ist in ewiger Bedrängnis, sie hilft auch ihr; in die Gefängnisse von Lyon bringt sie das letzte Brot von ihrem Tisch. Sie muß Briefe wochenlang liegen lassen, weil ihr das Geld fehlt, sie zu frankieren. Sie bleibt oft zu Hause, weil ihre Kleider und Schuhe zu schlecht sind für die Gasse. Ihr einziger Trost sind die kleinen Gedichte, die sie, über den Stickrahmen gebeugt, bei der Arbeit ersinnt, und die kleinen Lieder, jene wundervollen Kindergedichte, mit denen sie Hippolyte, Ondine und Ines, ihre drei Kinder, einschläfert.
Und dabei: wie klein sind ihre Wünsche! In eine Nußschale lassen sie sich pressen: Ruhe, ein wenig Rast, etwas Sonnenschein und ein bißchen Grün. Sie träumt — wie andere von Kronen und von Karossen — von irgendeinem stillen Haus auf dem Lande, von einem kleinbürgerlichen Glück, von einer ganz einfachen Existenz. Nur den Mann nahe haben, nur wissen, wovon man am nächsten Tage lebt, nicht sehen müssen, wie er beschämt und todesmüde von irgendeinem Mißerfolg in einem lächerlichen Winkel Frankreichs sich heimschleppt, und nicht immer mit übermenschlicher Anstrengung täglich das Lächeln erlügen müssen, um ihn zu begrüßen. Aber sie muß die Nomade bleiben, zwanzig, dreißig Jahre. Sie schreit auf zu Gott:
„Défendez aux chemins de m’amener encore.“
Aber die Wege schleppen sie weiter: durch alle Länder muß sie irren, und ihre Füße sind wund. Im Postwagen nach Italien, wo Valmore einer Truppe verpflichtet ist, schreibt sie mit zitternder Hand:
„Ah, les arbres du moins ont du temps pour fleurir,
Pour répandre leurs fruits à la terre et mourir.
Ah! je crains de souffrir, ma tâche est trop pressée
Ah! laissez-moi finir ma halte commencée
Oh! laissez-moi m’asseoir sur le bord du chemin
Mes enfants à mes pieds et mon front dans ma main
Je ne puis plus marcher.“
Aber Gott erhört sie nicht. Selbst in Paris hat sie, die Fünfzigjährige, noch nicht Rast. Vierzehnmal übersiedelt sie, immer vom Elend von einer Wohnung zur andern gejagt, immer ist da der fünfte oder sechste Stock der einzige, wo sie die Miete erschwingen kann. Und ihre Füße sind wund. Sie zählt die Stufen von Wohnung zu Wohnung, hundert Stufen, hundertzwanzig, hundertdreißig, und ein Jubelschrei bricht aus ihr, wie sie endlich den Freunden berichten kann, daß sie in der Rue St. Honoré um 27 Stufen niedriger wohnt. „Im zweiten und dritten Stockwerk wohnen, das wär mein Traum“, seufzt sie auf. Ein kleiner Balkon mit ein paar Blumen muß ihr das Grün ersetzen, von dem sie träumt, in zwei, in drei Zimmern drängt sich ihre, ihres Mannes und ihrer drei Kinder Existenz zusammen. Ihre ganze Kraft wendet sie an diesen widerlichen, winzigen Kampf, die jeden Monat fehlenden zwanzig und dreißig Franken zu erobern, immer bleibt diese Existenz im Kleinlichen befangen, und so fremd sind ihr wirkliche Summen geworden, daß, wie ihr einmal vierhundert Franken Pension als Geschenk des Königs durch die Güte von Freunden vermittelt werden, sie von einer „inondation d’argent“ jubelt. Dabei müht sie sich, ihre ganze Sorge, ihr Elend dem eigenen Manne zu verbergen. 1842 schreibt sie: „Alles, was ich an weiblichem Genie, an Schweigen und an Worten kenne, wende ich an, um diesen großen und niedrigen Kampf meinem lieben Mann zu verschweigen, der das nicht acht Tage ertragen könnte. Ich rette seinen Stolz um den Preis meiner Erniedrigung, und erst nach meinem Tode wird er erfahren, durch welche unschuldigen Schliche, durch welche Tränen, die einzig Gott und ich kennen, ich bis zum heutigen Tag das traurige Geheimnis des Brotes gerettet habe, das noch nie an unserem und unserer Kinder Tisch fehlte. Auch Frost haben sie noch niemals gelitten.“ Aber dann schreit sie wieder auf: „Die Armut tötet mich, ich ersticke an diesen Geldnöten, die mein Leben aufzehren, wie die Motten das Tuch.“
Das geht zehn, das geht zwanzig und dreißig Jahre. Sie versteht es selber nicht mehr. „Wie ist es denn möglich,“ schreibt sie, „daß man Tag und Nacht arbeitet und doch nicht genug verdient, um zu leben!“ Dazu kommt, daß Valmore, von allen Bühnen refüsiert, selbst nichts mehr verdient. Mit dreiundfünfzig Jahren weiß sie nichts mehr „pour inventer leur existence“. Es ist der ewige Bankrott. Zwar hat der Sohn schon eine kleine Anstellung, aber das kann nicht genügen, und nun muß sie in die letzte Erniedrigung sich ergeben, muß sie, die Stolze, die ein Geldgeschenk von Madame Récamier zurückwies, bei allen Ministerien, bei allen Freunden betteln, in den Vorzimmern der Theater herumschleichen, um Valmore einen Posten zu verschaffen, um seinen Stolz zu retten, der unter allen diesen Enttäuschungen sich selbstmörderisch in Anklagen ergießt und seine ursprüngliche Heiterkeit verdüstert hat. Endlich gelingt es, ihn mit zweihundert Franken monatlich in der Bibliothèque nationale als Hilfsbeamten unterzubringen. Mit einem Jubelschrei begrüßt Marceline seine Ernennung; aber schon ist wieder andere Sorge bereit, ihr die des Geldes und des Erwerbes abzulösen.
Es ist kein einziger heller unbesorgter Tag in ihrer Existenz, und es wäre entsetzlich, ihr Schicksal nachfühlend zu beschreiben, wäre das Leiden nicht die Kraft ihrer Seele und der rauschende Quell ihres Gedichts.
„Peut on être juste et ne pas plaindre tout ce qui respire? De là souvent ces élans d’imprudente piété qui m’ont fait croire à des fausses larmes. J’aime mieux en avoir été victime que sentir mon cœur se briser.“
Die Leidenden allein wissen um das Leiden: überall erkennt darum Marceline Desbordes-Valmore mit schwesterlichem Blick jedes irdische Unglück. Über sie, die von Sorgen fast Erdrückte, schütten noch alle andern ihre Sorgen hin. Kaum weiß sie selbst, wie für den nächsten Tag das Brot für sich und ihre Kinder zu schaffen, und noch drängt der Bruder, der entlassene Soldat, der arbeitslose Oheim, der greise Schwiegervater um Geld an sie heran. Und sie gibt, ehe sie sich selber nimmt. In allen Vorzimmern der Ministerien kennt man sie, die ewige Petentin. Bald bettelt sie für eine arme Witwe, eine entlassene Schauspielerin, bald fordert sie Befreiung eines armen Sträflings, bald rennt sie die Sohlen durch um 500 Franken für die Heimreise eines jungen Italieners — nie aber bittet sie für sich. Man lese ihre Briefe: ununterbrochen ist sie, die selber Notleidende, Fürsprecherin alles irdischen Elends; alle ihre literarischen Verbindungen nutzt sie einzig, fremde Not zu erleichtern.
Denn fremde Not ist ihr härter als die eigene. Als in Lyon der Aufstand ausbricht, schreibt sie die wunderbaren Worte: „Man errötet, daß man zu essen, daß man warm und zwei Kinder zu haben wagt, während die anderen nichts besitzen.“ Alle Härte des Gerichts, jedes Urteil ist für sie, die nur Milde kennt, ein nie zu beschwichtigendes Entsetzen. „Wenn ich ein Schafott sehe, verkrieche ich mich unter die Erde und kann nicht essen, nicht schlafen.“ Und als der Zufall will, daß sie bei ihren hundert Quartieren einmal gegenüber einem Gefängnis wohnt, wagt sie keinen Blick mehr aus dem Fenster. Nie kann sie begreifen, daß man bestraft, statt zu verzeihen. „Um sechs Franken willen, um zehn Franken willen, wegen eines Zornausbruches, für eine fieberhaft geäußerte Meinung schickt man Menschen in die Galeeren!“ Ihr Herz kann das nicht verstehen: ihr sind im russischen Sinn alle Übeltäter nur „Unglückliche“, und allem Unglück fühlt sie sich verwandt. Darum verwendet sie, die Gehetzte, die Gejagte, noch ihre ganze Willenskraft, um zu helfen. Sie dringt einmal in einem Gefängnis bis zum Direktor vor, um Entlassung für einen Sträfling zu verlangen; und als sie das Haus mit den Riegeln und vergitterten Gelassen mit guter Botschaft verläßt, atmet sie auf: „Ich fühlte mich wie im Himmel, als ich das Haus verließ.“ Sie bettelt bei Theatern um Rollen für Zurückgesetzte, bei dem König für eine Witwe; und als Martin, ein Landsmann von ihr, Minister wird, schreibt sie ihm im Patois seiner Heimat, um ihn milde zu stimmen. Sie steht müde und krank von ihrem Bette auf, um einem Freunde einen verfallenen Pfandbrief zu retten: jeder Appell an das Mitleid reißt eine Kraft aus der Hinfälligen unverweigerlich empor, denn hier fühlt sie sich angerufen im wahren Namen und Kern ihres Wesens. Trösten ist ihr ein vitales Bedürfnis: im Wohltun strömt sie die ganze überschwengliche Gefühlsmacht, die einmal der unselig Geliebte verachtet, nun auf alle Verachteten aus.
Dieser Blick für das Leiden ist unvergleichlich bei Marceline Desbordes. Man lese ihre Schilderungen Italiens: zum erstenmal betritt sie Mailand, aber sie sieht nicht die marmorn gepflasterten Straßen mit den Karossen wie Stendhal, nicht die amoureuse wollüstige Luft des Südens: ihr erster Blick sieht die vielen Bettler an den Kirchentüren, die zerlumpten Kinder, die Elendsquartiere, sie durchschaut den Jammer, der unter diesem Luxus sich scheu verbirgt. Und in den Kirchen ergreift sie nur die Darstellung des leidenden Christus und die heilige Demut der Märtyrer. Irgendeine urtümliche Einstellung wendet ihren Blick immer den Geprüften zu: sie hat keine Wahl, denn sie sieht nur durch Ergriffenheit. Bei den Aufständen steht ihr Herz zu dem ewig besiegten Volke, bei dem „herrlichen, dem sublimen Volke“. „Armes Volk,“ schreit sie einmal auf, „so voll Zuversicht und Frömmigkeit, es hat auch diesmal nichts erhalten als das Recht, für seine Kinder zu sterben... Wir gehören zum Volk durch unser Elend und unsere Überzeugung.“ Nur die Zurückgestoßenen liebt sie wahrhaft, die selbst Zurückgestoßene. Und vielleicht weil sie so zärtlich, so wissend das Leiden fühlt, kommt gleichsam angelockt immer wieder von allen Seiten alles Unglück zutraulich zu ihr. Sie ist die Beichtigerin ihrer Freundinnen, die Trösterin ihres Mannes, dem sie über seine theatralischen Niederlagen mit rührender Lüge hinweghilft; immer ist ihre Wohnung überschwemmt von Menschen, die von ihr, der Ärmsten, noch etwas begehren, zumindest die Wohltat ihres Mitgefühls. „Jede Kleinigkeit von dem, was Dich quält, ist mir wichtig“, schreibt sie einmal einer Freundin — wahrhaftig, sie hat geradezu Durst nach tröstender Tat und saugt mit unendlicher Liebeskraft alles Leiden an sich. Trotz der eigenen Fülle und Überfülle hat sie noch immer Raum für andere Not und immer Tränen bereit; fast scheint es, daß sie sich von ihren Sorgen nur rettet durch das Mitgefühl. Vermöchte sie nicht immer in fremde Not zu entfliehen, sie erstickte an der eigenen.

Hilaire Ledru: Marceline Desbordes
Gemälde um 1840
Niemals aber kann der oft erlittene Undank oder ein Unrecht ihre milde und duldende Seele zu Zorn auftreiben. Sie ist unfähig jeder Erbitterung. Man weiß, wie sie Olivier verziehen, der sie ins Elend stieß; und selbst gegen jene, die ihr wahrer Widerpart sind, gegen die Reichen, gegen die Hartherzigen, gegen die Selbstsüchtigen ballt sie niemals die Faust. „Ah, die Reichen, die Mächtigen, die Richter,“ so schreit sie einmal auf, „sie gehen ins Theater, nachdem sie eine Todesstrafe ausgesprochen haben.“ Nur diesen Schreckensruf hat sie, aber keine wirkliche rachgierige Empörung, weil sie nicht hassen kann und weil sie diese Art Menschen einfach nicht versteht. Sie sind ihr fremd, alle die nicht Mitleid kennen, die nicht geben — „nein, die Reichen fühlen nicht mit uns, Pauline,“ schreibt sie an ihre Freundin, „die Reichen von heute kommen und erzählen einem mit so viel Rückhaltlosigkeit ihren eigenen Jammer, daß man gezwungen ist, mit ihnen mehr Mitleid zu haben als mit sich selbst.“
Nein, die Reichen fühlen nicht mit ihr, der ewig Entbehrungsvollen, und sie versteht die Reichen nicht. Sie versteht nie und nie einen Menschen, der sich verwehrt und verhält, der sich nicht ausströmt in der weichen Lust des Helfens und Gebens. Und aus ihrem ewigen Elend staunt sie nur fremd, ohne Haß, ohne Bitterkeit zu diesen Kalten und Versperrten empor wie zu Wesen, die nicht ganz ihresgleichen sind, weil ihnen gerade das fehlt, was sie als ihren einzigen Reichtum empfindet: die strömende Barmherzigkeit, das ewig sich verschenkende Gefühl. Und zutiefst in ihrem innerlichsten immer verzeihenden Herzen bemitleidet sie vielleicht sogar die Mitleidslosen als die Ärmsten unter den Armen.
„Moi seule en mon chemin et pleurante au milieu,
J’ai dit ce que jamais femme ne dit qu’à Dieu.“
Entrechtete des Schicksals, Enterbte des Glücks, „Paria der Liebe“, war Marceline Desbordes-Valmore auch als Dichterin nicht begütert. Die fürstliche Schatzkammer der Sprache blieb ihr ein Leben lang verschlossen. Nie kann sie den heißen Leib ihres Gedichts mit den funkelnden, glitzernden, schillernden Edelsteinen seltener Worte, den kunstvollen Spangen ziselierter Fügungen, dem uralten Kronschatz ererbter und erworbener Kultur schmücken. Sie hat nichts, um ihrem Gefühl Befreiung zu kaufen, als die kleine Münze der täglichen Sprache, das Diktionär eines Bürgers, beinahe eines Kindes. Marceline Desbordes-Valmore ist Autodidaktin und ihre Bildung eher unter dem Mittelmaß der Zeit. In ihrer kurzen Jugend hat sie wenig gelernt, spät ist sie zur Schule gekommen: „A dix ans je ne savais rien que d’être heureuse“, und früh schon von der Kindheit ins Leben gerissen, haben ihr Not und Sorge die Bücher aus der Hand geschlagen. Niemals ließ ihr das Schicksal genügend Ruhe, ihre Bildung zu bessern. Nicht einmal das Geringste, die Rechtschreibung, bemeistert diese große Dichterin. Ein gut Teil ihrer Verse mußte erst für den Druck nachgefeilt werden, und in ihren Briefen wimmeln sprachliche Fehler wie Fische im Bach. Jedes Fremdwort wird ihr zur Klippe. In einem Briefe schreibt sie einmal von den Äquinoktien, die die große Hitze verschuldeten, und fügt in ihrer Demut dem raren Wort voll Besorgnis die Entschuldigung bei: „Ich habe das von andern gehört, denn du weißt ja, ich bin nicht gebildeter als die Bäume, die sich heben und neigen, ohne zu wissen warum.“ Marceline Desbordes-Valmores Kunst ist kunstlos. Ihre Reime sind kärglich, die Bilder kaum andere als diejenigen, die man bei Blaustrümpfen und Dilettanten findet, die süßlich romantischen Vergleiche von der Blume, die sich im Winde wiegt, der Rose, die sich entblättert, der Schwalbe, die sich ihr Nest sucht, dem Blitz, der aus heiterm Himmel zuckt. Sie ist wenig vielfältig in den Versformen, und schon das Sonett ist ihr, der Armen im Reime, zu schwer. Sie ist mittellos in ihrer Kunst, sie hat nichts als die abgegriffenen Kupfermünzen der täglichen Sprache, um sie gegen ihr Gefühl zu tauschen, das kostbare; sie hat nichts als die schlichten Worte, wie Rilke sagt: „die im Alltag darben“, die kleinen, die einfachen, die wundervollen Worte, „les mots, les pauvres mots, les mots divins, qui font pleurer.“ Auch ihren dichterischen Besitz schafft sie sich ganz allein; nicht die Sprache ist es, die sie zur Dichterin macht, die von Fremden übernommene, sondern nur das, was sie der eigenen Brust entäußert, ein unendliches Gefühl und dann, jene höchste Macht ihres Wesens: die Musik.
Marceline Desbordes-Valmore ist ganz Musik, weil sie ganz Seele ist. Jene höchste Gewalt ist ihr geschenkt, jene irdisch-unirdische Gewalt, die aus den sieben Tönen, aus der Oktave, das Weltall des Empfindens aufbaut. Die kältesten, die nüchternsten Worte werden transparent und durchleuchtend von dem feurigen Rhythmus des Gefühls. Nichts ist Bau, Umriß, Bildung, Nachahmung, Problem, Konstruktion in ihren Gedichten, alles fließend, schwebend, aufklingend, schwingend, alles ist Musik, Verklärung. Sie durchseelt den ärmsten Reim, das schlichteste Wort, sie bindet das mit Mühe Gefügte in ein seliges Band.
Musik ist der Sinn, Musik auch der Anlaß ihrer Dichtung. Denn nicht Ambition, nicht Nachahmung hat sie wie die meisten der Poesie zugeführt. Marceline liebt als junges Mädchen die Gitarre. Ihr feines Gehör behält die Melodieen, die sie im Theater, die sie auf der Straße gehört, und zu arm, die Texte, die Bücher zu kaufen, dichtet sie sich selbst zu Hause in den vielen einsamen Stunden melancholische Romanzen und kleine Lieder zu der innen nachklingenden Melodie. Unmerklich, ganz unbewußt wie die Blumen auf den Feldern empor zu Gott blühen, wächst aus diesem arglosen Spiele die ernste Neigung, die Leidenschaft zum poetischen Bekenntnis. Und wie dann ihre Stimme matter wird und sie dem Gesang entsagen muß, flüchtet sie ganz hinüber von dem gesungenen in das geschriebene, in das gesprochene Wort. „Die Musik begann in ihr,“ schreibt Sainte-Beuve, „sich von selbst in Dichtung zu verwandeln, die Tränen sanken nieder in ihre Stimme, und so entblühten die Verse eines Tages von selbst ihren Lippen.“ Sie dichtet jahrelang nicht für die Welt, sie singt bloß ihr eigenes Leid in Schlaf, „pour endormir son pauvre cœur“. Die Mutterlose und Kinderlose, die Fremde in der Liebe ersinnt sich selbst die Tröstung im Lied.
Sie weiß es selbst kaum, daß sie dichtet, und hat es ein Leben lang nie verstanden, daß sie „Dichterin“ war. Es drängt in ihrer Brust, Schmerzen quellen auf und drohen die Brust zu sprengen, sie steigen empor und würgen die Kehle, aber ihren Lippen sind sie schon Melodie. Sie seufzt, sie weint, sie betet, sie klagt in ihren Gedichten, und was andere Frauen in den Kirchen ihrem Beichtiger vertrauen, was in Küssen erlöst wird oder in Klagen und Tränen einsam untergeht, alles das wird hier durch Musik der Seele Schwingung und befreite Melodie. Sie erzählt sich immer nur selbst, sie spricht Monologe aus der tiefen Traumhaftigkeit ihres Wesens und vergißt ganz, daß auch andere diese Stimme je hören könnten. Darum sind ihre Gedichte auch so unerhört aufrichtig, so ganz ohne Scham. Sie sind nur Durchbruch des Gefühls, Zerreißen der von Schmerz gespannten Hülle des Lebens durch innere Gärung. Diese Verse, oft sind sie nur Schreie, manchmal Klage, manchmal Gebet, immer aber beseelte Stimme. Sie sind nicht das Gefundene und Gefügte, sie sind das bloß Ausgeströmte, das Zufällige, denn Marceline Desbordes-Valmores Genie ist das der Unmittelbarkeit. Am Nähtisch hingesummt, zwischen der Arbeit und den Sorgen, oder abgestreift von den farbigen Flügeln des Traums, kommen ihr diese Verse zugeflogen, schmetterlingshaft und leicht. Niemals sind sie durch die Magie des Willens hergezwungen, nirgends ist Schwere von Absicht in ihnen, kaum sind sie anderes als melodisch bewegte Luft. Das Gedicht „Ma demeure“, ist es nicht ein reiner Seufzer, verhauchend in Musik? Man höre es klingen, dies Trostgebet einer armen Seele:
Ma demeure est haute
Donnant sur les cieux,
La lune en est l’hôte
Pâle et sérieux.
En bas que l’on sonne,
Qu’importe, aujourd’hui?
Ce n’est plus personne
Quand ce n’est pas lui!
Vis à vis la mienne
Une chaise attend,
Elle fut la sienne,
La nôtre, un instant.
D’un ruban signée
Cette chaise est là,
Toute résignée
Comme me voilà!
Diese Aufrichtigkeit gibt ihren Gedichten höchsten und einzigen Wert. Eben weil diese Dichtungen nichts der Phantasie danken und alles dem Erlebnis, sind sie so frauenhaft. Es sind die Jahreszeiten der Seele, und nie seit Sappho hat man so tief und schön durch den Schleier der Dichtung in ein Frauenherz, nie so nackt eine Seele im Bade des Gefühls gesehen. Erröten, Zögern, Angst, Scham und Bedacht (sie spricht ja im Traum), all das ist ihr fremd. Wir lauschen wie in ein fremdes Zimmer diebisch hinein in ihr Leben. Aber sie, die Entschleierte, ist so rein, so edel und keusch, daß sie uns alle Beschämung des Lauschers erspart. Wir wissen von ihr tiefstes Erlebnis und wissen damit von allen Frauen durch diese eine, die aufrichtig war, und dem dichterischen Wert fügt sich derart ein unabschätzbarer dokumentarischer bei. Denn beispiellos in der Weltliteratur ist dies selige Wunder restloser Aufrichtigkeit, dem zu Dank man hier aus kleinen Liedern, Zeile um Zeile, ein Frauenschicksal, eine ganze Biographie aus Gedichten aufbauen kann, ohne daß sich irgendwo eine Lüge darin fände, eine Verschönerung oder Heuchelei. In tiefer Unbesorgtheit vermag man hier jenes Wunder der Kristallisierung des Gefühls zu betrachten, das sich sonst dem Tag und der Erkenntnis verschließt, die Mysterien der Schwangerschaft, die Schauer des ersten Liebesempfindens, das Grauen des Alterns, Schauer und Glück vor dem neuen Erlebnis der doppelten Liebesfähigkeit, die Qual der Entfremdung der Kinder durch das Leben, das Verströmen der sinnlichen Liebe in die Gottesliebe, in Religion. Nirgends in einem Dichter ist das Gefühl transparenter und so selbst Dichter gewesen als in den Versen der Desbordes-Valmore, und die Leugnung Sainte-Beuves ist ihr höchstes Lob: „Elle n’est plus poète, elle est la poésie même.“ Sie ist selbst nicht die Dichterin, sondern das Gefühl dichtet gleichsam durch sie hindurch.
Musik hat die Dichtung ihr zugebracht, Musik trägt sie von ihr fort in die Welt. Freundinnen und Fremde vertonen ihre kleinen Lieder; sie staunt, sie will es nicht glauben, daß sie mit einmal beflügelt in die Welt wegstreben. Wie einst in der Liebe, so geht es der Glückentwöhnten auch im Ruhm, sie kann ihn nicht fassen, kanns nicht denken, daß diesen kleinen Versen, die sie zwischen der Arbeit, halb im Spiel, halb im Traum ersonnen, irgendein Wert, eine Bedeutung innewohnen könne. Die Dichtung, das war ihr doch nur ein Opiat, ein kleines Glück gegen die großen Schmerzen, eine Selbsttäuschung, der Liebe in Lust und Qual verwandt:
„Comme une douleur plus tendre il a sa volupté“, und nun kommen Menschen, große berühmte Dichter, und feiern dies als Literatur. Sainte-Beuve begrüßt die Verse mit einem Hymnus; Balzac, der freundliche Koloß, schleppt sich keuchend und dampfend die hundertdreißig Stufen zu ihrer Wohnung hinauf, um ihr seine Bewunderung zu sagen; Victor Hugo jubelt schon als Knabe ihr zu. Mit Tränen und Schauer wehrt sie alle Lobpreisungen als unverdient ab, fast fürchtet sie Hohn in dieser Werbung der Welt wie einst in jener Valmores. Kein Ruhm läßt sie diese tiefinnerliche Bescheidenheit je verlieren. Sie ist „stupide de joie“, wenn man ihr ein paar freundliche Worte sagt; und als Lamartine, der Berühmteste seiner Zeit, mit einem prachtvollen Gedicht sich grüßend an sie wendet, schauert sie zusammen wie unter Engelsruf. In dem Gedichte der Antwort, das die schönen Zeilen mit noch schöneren erwidert, lehnt sie allen Ruhm erschreckt ab:
„Oh n’as tu pas dis le mot gloire
Et ce mot je ne l’entends pas.“
Immer und immer wieder weist sie auf die Nichtigkeit ihrer kleinen Person hin:
„Je suis trop buissonnière, et ce n’est pas aux champs
Qu’il faut apprendre à moduler ses chants,
Il faut, ce qui me manque, une sévère école
Pour livrer sa pensée au vent de la parole.“
Vor dem kleinsten Dichter, dem letzten Dilettanten beugt sie sich und reicht gleichsam knieend Madame Tastu, irgendeiner Goldschnittlyrikerin, schülerhafte Huldigung. Ein ganzes Leben lang begreift sie nicht, was Literatur ist. In den dreihundert Briefen, die man von ihr kennt, mag man vergebens eine Zeile suchen, die diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten gilt, in wundervoll unzerstörbarer Naivität unterschätzt sie ihren eigenen Wert, wie sie den fremden erhöht. Latouche, den Autor der Fragoletta, diesen zweifelhaften Freund, nennt sie einen „homme d’immense génie“ und fühlt sich ihm ein Leben lang verpflichtet, weil er die Silben in ihren Versen nachzählte und ihr einen Verleger fand. Auch hier ist sie immer die Gebeugte, die Hingegebene — „née à genoux“, wie sie einmal sagt. Selbst die Literatur vermag nichts gegen die beseelte Schüchternheit ihres Wesens.
Niemals, niemals kann sie das Wunder erfassen, daß ihr kleines enges armseliges Leben, ihre geknechteten scheuen Gefühle irgendeines andern Menschen Interesse und Neigung finden könnten. Es sind doch nur ihre Tränen, die hier im Verse überfließen, flüchtige Kristalle vom Widerstreit des äußern Lebensfrostes und innerer Glut, wie Eisblumen auf die Spiegelfläche ihres Schicksals hingezaubert. Und wirklich, „larmes et pleurs“ sind die beiden Worte, die wieder und wiederkehren durch ihr ganzes Werk, der ewige Kehrreim aller ihrer Gedichte, Schmerz und Mißgeschick, die wirklichen Sterne ihres Lebens, sind auch die einzigen Inspiratoren ihrer Dichtungen gewesen. Aber allmählich weitet sich das Gefühl, zweigt vom persönlichen Erlebnis ab und strömt über in das große Mitleiden. Ihr eigenes Leben löst sich in ein Weltgefühl. Der romantische selbstgefällige Schmerz, den sie unwillkürlich von schlechten Byronschen Nachbildern ihrer Zeit übernommen, erhebt sich durch eine innere Güte allmählich zum tragischen Glücksgefühl, und gleichzeitig schwindet aus der Sprache aller romantische Bombast. Ihre Stimme, die leise klingende, wird stark im Anruf der andern; Schwesterschaft mit aller irdischen Qual läßt sie in ihren späteren Versen ein erhebendes Pathos finden. In Versen ruft sie alle Erniedrigten an:
„Vous surtout qui souffrez, je vous prends pour mes sœurs,
Pleureuses de ce monde ou je passe inconnue.“
Alle Mütter fühlt sie klagen in ihrer eigenen Stimme, alle Tränen der Welt strömen den ihren zu, tausend Seufzer beschwingen ihr Gedicht. Und in Lyon, der Stadt im Aufstand, wird die Klage zur Anklage, der Ruf zum Schrei. Aus dem schüchternen Kinde, der Leichtverführten, ist durch Liebe die Frau geworden, und durch Mutterschaft und Schmerz wird sie Mensch und Mitmensch. Sie klagt an, sie deutet mit zitternden Fingern auf die Kanonen, die lebende Menschen, Väter, Frauen und Mütter niederkartätschen, und unbewußt ruft eine bewegte Zeit sie zur großen sozialen Dichterin empor. Sie schildert das Elend der Arbeiter, den Hohn der Reichen und die Komödie der Gerichte, sie wendet sich an die ganze Menschheit und hebt ihre Stimme auf zu Gott. Alles Unglück hat in ihr Bruderschaft:
„Je me laisse entraîner où l’on entend des chaînes,
Je juge avec mes pleurs, j’absous avec mes peines,
J’élève mon cœur veuf au Dieu des malheureux,
C’est mon seul droit au ciel et j’y frappe pour eux.“
Ihre Liebe hat sich in Weltliebe verwandelt, alle Sentimentalität ist im Sturm des Schicksals weggeweht, und wenn sie die Stimme jetzt zur Klage erhebt, so gilt es längst nicht eigenem Schicksale mehr, sondern sie, die Demütige für sich selbst, spricht herrisch und kühn für die Menschheit. Laut, voll und drohend orgeln ihre Verse empor zu dem Schöpfer aller Qualen, zu dem Herrn des Schmerzes. Nicht die Frau spricht mehr von Sehnsucht und Entbehrung weiblichen Gefühls, sondern das Namenlose zum Namenlosen, und die letzten, die schönsten Verse der Desbordes-Valmore sind nur mehr Zwiesprache der leidenden Kreatur mit ihrem Schöpfer, mit Gott.
„Tant qu’on peut donner on ne peut pas mourir.“
Sie ist die wahre Frau, weil die Liebe der Sinn und die Tat ihres ganzen Lebens ist. Ihre Leidenschaft nährt sich nicht an der Gegenliebe, der zufälligen und unbegrenzten, sondern vom Liebesbedürfnis, dem in ihr unendlichen und unvergänglichen. Nicht von außen wird das Erlebnis, das einmalige, in sie geschüttet, sondern von innen quillt es empor, aus den unergründlichen Schächten ihres Herzens. Es ist da kein Anfang und kein Ende, alles strömt ineinander, gepreßt von den Zuflüssen der Seele, Kindesliebe, Leidenschaft, Gattentreue, Mutterschaft, um schließlich im Grenzenlosen der Gottesliebe zu münden, der sie unbewußt vom Anbeginn zugestrebt: „Seigneur qui ne cherchait l’amour dans votre amour.“ Von einem Ende ihres Lebens bis zum andern flutet dieser Strom mit unablässiger Welle. Ihr Gefühl wird nie müde, sie läßt nicht ab, sich hinzugeben an ihren Gatten, an die Kinder, an die Freunde, an die Welt und an Gott. Immer bleibt sie die unendlich Ergriffene, die Schenkende, die Duldende, und wenn ihre Liebe wandert vom ersten Mann zum zweiten, von den Kindern zur Kirche, so ist diese Wanderschaft nur höchste Treue an ihrem innern Lebenswillen, der sich entäußern muß. Nie ist es das Geschehen, der Anlaß, immer nur das Gefühl, das ihr Erleben zur Größe spannt. Jener Verführer ist auf den Brettern ihres Lebens nichts als der Bote, der das Stichwort bringt und die Tragödie des Herzens anklingen läßt, dann tritt er ab und verschattet im Dunkel; aber das große Spiel, das die Liebe mit ihr begonnen hat, endet nicht mit ihm, sondern mit ihrem eigenen Leben. Sie, die Erweckte, singt Jubel und Schmerz unablässig aus erregter Brust, die Arie ihrer Seele hat kein Ende bis zum letzten Tag.
Ich weiß keine Dichterin, die so wenig Schauspielerin ihres Gefühls war als Desbordes-Valmore, die Komödiantin des Berufs. Sie ist nicht die Heroine (wie George Sand, wie Charlotte Corday, Jeanne d’Arc und Theroine de Méricourt), sondern nur die Heroische des Alltags, sie ist nicht die große Liebhaberin, die grande amoureuse (wie die Pompadour, wie die Lespinasse, wie Ninon de Lenclos), sondern bloß die Liebende und darum die Entsagende. Ein ganzes Leben opfert sie im Tempel ihres Herzens dem Gotte des Gefühls. Sie gibt klaglos alles, was sie ihrem Leben abringen kann: dem Geliebten ihre Reinheit, dem Gatten ihre tägliche Mühe und Kraft, den Kindern ihre Sorge, dem Gefühle die Verse und dem Himmel ihr Gebet. Sich versagen wäre für sie Sterben: „Tant qu’on peut donner on ne peut pas mourir.“ Nichts behält sie darum für sich, und was ihr etwa zufällt, der Ruhm der Bühne und später jener der Dichtung, diese Geschenke des Schicksals weist sie wie eine Unwürdige ab. Die Ungeschmückte will sie bleiben, die Dienerin, die Magd fremden Lebens, sie will schenken und nicht beschenkt sein, ihr Geben nicht durch Gegengabe geschmälert sehen. Aus allen ihren Stunden, den dunklen und trüben, flicht sie Kränze für andere Stirnen und streut die Blüten ihrer Dichtung verschwenderisch auf den geliebten Namen. Das Glück der Beschenkten war ihr versagt; so sucht sie, wahre Frau, die sie ist von jener verwölkten Kindheit an bis zur Todesstunde, Kraft und Erhebung in einer beispiellosen Hingabe, in einer Hingabe ohne Frage, ohne Verpflichtung, ohne Bedingung, so wie sie einst nur aus Gebenslust sich dem fremden Manne hingab. Sie selbst hat das Glück verlernt und findet es nur in der Verwandlung, andere beglückt zu sehn. Immer tritt sie zurück, und wenn sie bittet, wenn sie zu Gott aufschreit, so ist es für den Gatten und für die Kinder, selbst klaglos bereit, zu verschwinden, zu vergehen, und ihr süßester Wunsch:
„D’être abeille et mourir dans les fleurs.“
Das Schicksal hebt sie nicht auf in seine seligen Arme, so bleibt sie zu seinen Füßen und demütigt sich, und allmählich wird ihr das Leiden nicht mehr der Feind, der sie überfällt, sondern der Freund, der getreue. Und will Freundliches ihr nahen, so fürchtet sie ein Fremdes, ihr nicht Zugeteiltes darin. Sie weicht scheu vor ihm zurück. Immer wenn es naht, wenn Valmore um sie wirbt, wenn ihren Versen ein freundliches Wort gesagt wird, so schauert sie zusammen, sein Nahen bringt ihr Angst:
„Je tremble d’être heureuse.“
Ihr Glück, das weiß sie bald, sind die Tränen, und sie liebt sie wie ein Glück, dem entfremdet zu werden sie sich fürchtet. Allmählich mischt sich Süße in ihr Erleiden, und ohne Zwang, aus innerster Lebensnot, wird sie Meister ihres Schmerzes und selig im Leiden. Ähnlich wie es in Gottfried Kellers Versen heißt, darf sie von sich sagen:
„Ein Meister bin ich worden
zu tragen Schmerz und Leid,
und meine Lust zu leiden
ward meine Seligkeit.“
Dulden ist ihre wahre Welt, und ihre Klage verwandelt sie in Gebet: „Prier ce sont nos armes“, sagt sie von sich und allen Frauen, weil sie erkennt, daß die Frau nur durch Leiden und nicht durch Lust in die große Gemeinsamkeit eingefügt ist, daß Empfangen ihr Erleiden sein muß und in alle Süße des Körpers und der Seele ihr Schmerz unverweigerlich gemengt ist.
Kein neues Unglück kann sie darum irremachen: ihre Liebe ist nicht abzutöten, ihr Gefühl nicht zu zerstören. Bei der ersten Enttäuschung schrie das gequälte Herz noch auf, zu neu war ihr der Schmerz. Aber schon damals war es nur erschreckte Klage, nicht Zorn und nicht Anklage, schon damals suchte sie alle Schuld in Bestimmung, in Selbstschuld zu verwandeln:
„Il me faisait mourir et je disais, j’ai tort.“
Schon damals verzeiht sie ihm, sie verzeiht der Freundin, die ihn verlockt hat, denn sie muß sichs bekennen: „Je ne sais pas haïr.“ Immer ist sie das Opfer, die Ausgenützte, aber darum nicht die Enttäuschte. Ihre Familie klebt parasitisch an ihrem Leben, aber nie hat sie es beklagt mit einem Wort. Latouche, der falsche Freund, sucht ihre Tochter zu verführen; und doch, wie dann Sainte-Beuve an seinem Todestage jenen Brief an sie richtet, schreibt sie in ihrem Briefe eine brennende Apologie. Ihrem Verführer findet sie das wundervollste Wort der Vergebung, das je eine Frau gesprochen:
„J’en parle à Dieu sans son injure
Pour que Dieu l’aime autant que moi.“
Für jeden findet sie eine Entschuldigung, und alle jene, die sie gequält und erniedrigt haben:
„Ceux qui m’ont affligée en leur dédain jaloux,
Ceux qui m’ont fait descendre et marcher dans l’orage,
Ceux qui m’ont pris ma part de soleil et d’ombrage,
Ceux qui sous mes pieds ont jeté des cailloux.“
für sie alle erhebt sie ihre Stimme zu Gott:
„Oh, qui se peut venger? Oh par votre abandon
Seigneur! par votre croix dont j’ai suivie la trace,
Par ceux qui m’ont laissé la voix pour crier grâce,
Pardon pour eux! pour moi! pour tous! pardon! pardon!“
Und auch ihm selbst, Gott, verzeiht sie, daß er ihr von fünf Kindern vier genommen, daß er seinen dunklen Engel gegen alle entboten, die ihr teuer waren. Nicht Klage richtet sie an ihn um diesen herbsten Verlust, sondern nur Bitte für andere Mütter, und es ist eine heroische Güte des Verzichtes in diesem Gebet:
„Oh Sauveur! soyez tendre au moins aux autres mères
Par amour pour la vôtre et par pitié pour nous,
Baptisez leurs enfants de nos larmes amères
Et relevez les miens tombés à vos genoux.“
Er hat seinen ganzen Zorn gegen sie gesandt; aber sie, die Liebesreiche, vermag ihm nicht zu zürnen, und je mehr er sie züchtigt, desto glühender liebt sie ihn.
In dieser scheinbaren Schwäche, dieser grenzenlosen Selbstdemütigung ruht die Kraft, der wunderbare Heroismus der Marceline Desbordes-Valmore. Ihr Leben ist das einer Heldin, einer Heiligen, und Descaves findet ihr den schönsten Namen „Notre Dame des Pleurs“. Glut ist ihr Widerstand. So wie ihr magerer gebrechlicher Körper mehr als fünfzig Jahre sich, allen Krankheiten trotzend, weiterträgt, so überwindet ihr Charakter alles Unglück. Die Kraft anderer wird zu Taten und Worten, ihr Bestes an Kraft aber verzehrt sich im Schweigen, und alle Verse verraten zu wenig, was für Qualen sie litt in den täglichen Kämpfen und Tagwerken, in den Entbehrungen und Erniedrigungen, wie verzweifelt sie das Lächeln erkämpfte, das sie abends dem müden Manne entgegenbringt, und den Heroismus, viermal vom Totenbett ihrer Kinder noch einmal aufzustehen und nochmals in ein so furchtbares Leben hinein. Diese in tausend Stunden gestählte Kraft, gegen die Verzweiflung zu ringen und unentwegt sich der Liebe zu wahren, ist das Mirakel, das sie glühend erhält bis zum letzten Tag, das sie Dichterin sein läßt bis zum letzten Vers. Andern Frauen erlischt meist das Gefühl mit der Liebe, andern Dichterinnen kühlt die Leidenschaft aus mit dem Erlebnis, sie aber verwandelt und steigert grenzenlos ihr Gefühl. Vom Geliebten zum Gatten, vom Manne zu den Kindern und von den Kindern zu Gott trägt sie ihre Hingebung, aber niemals lischt die heilige Flamme aus. Alles, was das Leben in ihre Glut wirft, Ekel, Qual, Bitterkeit, es nährt nur ihr Lodern, und die Sechzigjährige dient ihr noch hingebungsfroher als die Halbwüchsige. Die Flamme, die einst nur reichte bis zu den Lippen des Geliebten, ihre Kinder wärmte und den Gatten umschlang — in den letzten Jahren schlägt sie empor bis zu Gott und wird eins mit seiner ewigen Glut.
Marceline Desbordes-Valmores Leben führt über den Kalvarienberg aller Leiden; und damit sie auch das Höchste an Lust und Tiefste an Qualen kenne, drückt das Leben auf ihr blutendes Haupt die dunkle Dornenkrone der Mutterschaft.
„Enfants priez pour moi, j’ai tant prié pour vous.“
Hingabe war ihres Lebens Sinn und die Mutterschaft darum ihre höchste Berufung. Hier war ihrer Opferfreude, der so oft verschwendeten, Beständigkeit geboten und ihres Empfindens fast religiöser Reinheit unschuldige Antwort. Hier durfte sie dienen ohne Ende und ohne Dank, ihr Blut mühen für eigenes Blut. Einzig in diesem weiblichsten der Gefühle lischt ihres demütigen Lebens Angst, die Unwürdige zu sein und ein Glück nicht zu verdienen. Die Verschüchterung ihrer Seele wird im Anblick ihrer Kinder von einem neuen Gefühl gescheucht: zum ersten Male begreift sie, daß Gott auch ihr, der Enterbten, gütig sein kann:
„Dieu dans ma pauvreté me laissait être mère.“
In dem Sturm ihres Lebens ist hier eine kleine Insel Seligkeit, und man kennt die Stimme, die sonst so sorgenvolle, nicht mehr, wenn Marceline von ihren Kindern spricht. Der Flor von Melancholie ist gesunken, und die Träne, die aufquellende, trübt nicht mehr ihre selige Melodie. Ein Jubel, den Liebe sie niemals lehrte, springt hoch:
„Un enfant! un enfant! ô seule âme de l’âme!
Palme pure attachée au malheur d’être femme!
Éloquent défenseur de notre humilité,
Fruit chaste et glorieux de la maternité,
Qui d’une langue impie assainit la morsure
Et de l’amour trahi ferme enfin la blessure!
Image de Jésus qui se penche vers nous
Pour relever sa mère humble et née à genoux.“
Diese brennende Mütterlichkeit umspannt die kleinen Leben von ihrer frühesten Stunde bis in die Mannheit, sie beginnt schon im Vorgefühl der Erwartung, sie flügelt ihrem Nahen schon voraus, und niemals hat eine Mutter für mein Empfinden ein schöneres Gedicht geschrieben, als sie zur Geburt ihres Sohnes Hippolyte. Das Mysterium der Schwangerschaft verwandelt ein tiefes Blutempfinden in eigenstes seligstes Erlebnis, sie mahnt — noch matt von Schmerzen, die längst verrauscht sind im Glück — das Kind an all die süßen Sorgen der Erwartung, wie sie aus Gebeten Glied um Glied seines Körpers schuf, wie seine Sinne durchwebt sind von ihren Träumen und sein ganzes Leben glühend vorgeahnt aus ihren Wünschen. Die selige Stunde der Geburt beneidet noch die des dunklen Verbundenseins, und im schönsten Worte ergießt sich die ganze Glut ihrer Erwartung:
„J’aurais voulu voir Dieu pour te créer plus beau.“
Körper von Körper gelöst, senkt sie noch ihre Seele in die halbbewußte zurück und durchglüht sie mit Sorgen der Liebe. Und wie die Kinder dann aufwachsen, ist sie ihre einzige Dienerin. Sie wacht über ihren Schlaf und ihre Angst. Sie macht sich kindlich mit ihnen, ihre Verse lernen die Sprache lallender Lippen sprechen, sie erfindet, die Kindliche, ihrem Mädchen ein Gedicht zum Einschlafen, das unsterblich geworden ist in der französischen Literatur und das jedes Kind in der Schule heute mit seiner kleinen Stimme lernen und sprechen muß. Es ist das Gebet „L’oreiller“, das schönste Abendgebet der Welt:
„Cher petit oreiller, doux et chaud sous ma tête,
Plein de plume choisie, et blanc, et fait pour moi!
Quand on a peur du vent, des loups, de la tempête,
Cher petit oreiller, que je dors bien sur toi!
Beaucoup, beaucoup d’enfants pauvres et nus, sans mère,
Sans maison, n’ont jamais d’oreiller pour dormir;
Ils ont toujours sommeil. O destinée amère!
Maman! douce maman! cela me fait gémir.
Et quand j’ai prié Dieu pour tous ces petits anges
Qui n’ont point d’oreiller, moi j’embrasse le mien.
Seule, dans mon doux nid qu’à tes pieds tu m’arranges,
Je te bénis, ma mère, et je touche le tien!
Je ne m’éveillerai qu’à la lueur première
De l’aube; au rideau bleu c’est si gai de la voir!
Je vais dire tout bas ma plus tendre prière:
Donne encore un baiser, douce maman! Bonsoir!“
Noch ehe sie sprechen können, beseelt sie so ihre stummen Lippen in Musik. Und für den Sohn, wie er zum ersten Male zur Schule geht, schreibt sie jene entzückende kleine Erzählung vom „L’écolier“, um ihn zum Fleiße anzufeuern; und die haben seitdem tausend Mütter tausend Kindern vorgesprochen, wenn sie zum erstenmal mit ihrem Ränzel zur Schule trotten. Sie muß sich nicht zwingen zu diesen Versen, sich nicht kindlich machen um der Kinder willen, denn sie selbst wird selig an diesen kleinen Strophen. In diesen Kinderliedern erwacht plötzlich etwas in ihr, das ganz vergessen und verschüttet lag: ihre eigene Kindheit. Von dem Lächeln der Kinder reflektiert eine Heiterkeit in ihr Leben zurück, sie findet in entzückenden melodischen Versen kleine schalkische Wendungen, ihr Herz, das verschattete, blüht wieder auf in Heiterkeit. Zum erstenmal atmet sie unbesorgt. Die Armut um ihr Leben trifft sie stark und gepanzert, denn Mutterschaft, das neue Glück, umgürtet ihren Leib, der Tod kann ihr nichts mehr anhaben, das Schicksal hat keine Macht über sie. Jubelnd ruft sie aus:
„J’ai des enfants! leurs voix, leurs haleines, leurs jeux
Soufflent sur moi l’amour qui m’alimente encore;
J’ai, pour les regarder, tant d’âme dans les yeux!
Mon étoile est si bien nouée à leur aurore!
On m’a blessée en vain, je ne peux pas mourir:
J’ai semé leurs printemps, je dois les voir fleurir.“
Aber dieser großen Dulderin ist aller irdische Besitz nur als Pfand flüchtig gegeben, und sie muß ihn auslösen mit allen ihren Tränen. Der Tod steht zwischen ihr und dem Glück. Das erste Kind, das Kind des Unbekannten, hat ihr der Tod genommen, und auch das erste, das sie Valmore schenken darf, stirbt nach wenigen Wochen. Dann scheint das Unheil beschwichtigt mit diesen ersten beiden Opfern ihrer Liebe, drei werden den Verlorenen nachgeboren und überwachsen die Kindheit: Hippolyte ihr Sohn und die beiden Töchter Ondine und Ines. Zwanzig Jahre lang darf sie sich ihrer freuen. Sie zieht sie heran, und schon bringen sie Gefahr in ihr Leben. Ondine, die ältere, ein kokettes, kluges und ambitiöses Mädchen, wird von der Literatur lebhaft verlockt; Sainte-Beuve wünscht sie zur Frau, sie weist ihn zurück; aber mit einem Male muß Marceline entdecken, daß Latouche, der freundschaftlich in ihrem Hause verkehrt (in dem manche Biographen den Verführer, den „Olivier“ Marcelines und den Vater ihres unehelichen Kindes sehen), sich mit allen Künsten bemüht, und nicht ganz vergeblich, die Nähe und Vertrautheit des Umgangs zu mißbrauchen. Aufgescheucht in ihrer Angst schreibt Marceline innige Briefe an ihre ferne Tochter, die erhalten sind und in rührender Fürsorge sie vor dem eigenen Schicksal warnen. An der Angst wacht noch einmal das Grauen der früh erlebten Leiden auf. Tage der Aufregung und Monate des Entsetzens stürzen jetzt in ihr Leben. Wie sie ihr Kindheitsglück im Betrachten verdoppeln durfte, will nun auch die Tragödie des grausamen Verführtseins im Kinde sich erneuern. Sie muß das Kind schützen, sie, die keine Mutter damals hatte, die sie zurückriß vor ihrem Elend, schützen (der Gedanke ist kaum zu fassen): vor vielleicht ebendemselben „Olivier“, dem gleichen Verführer oder zumindest der gleichen Verführung. Aber es gelingt, Ondine zu warnen und sie bald darauf mit einem einfachen und nüchternen, achtbaren Mann zu vermählen.
Zu retten, um sie zwiefach zu verlieren. Denn jetzt, da sie gesichert scheint, führt das Schicksal seinen ersten Schlag. Ines, die jüngere Tochter, stirbt mählich hin an Schwindsucht, dann folgt ihr im Tode das einzige Enkelkind, das Ondine geboren, und wenige Jahre darauf an der gleichen Krankheit, zur Verzweiflung der Mutter, Ondine selbst. Alle die Lichter, die ihr Leben erhellten, löschen aus mit ihren Augensternen, und ebenso, wie einst in der Liebe, sieht sie nun im Schicksal einen finstern Hohn, eine Ironie des Glückes, die ihr Herz zerschneidet. Ihre Krone rollt in den Staub, mit einmal ist sie „la mère découronnée“; ihr Stolz, ihr Vertrauen sind gebrochen, die sieben Schwerter der Madonna durchbohren jetzt ihre Brust. Und als wären diese teuren Existenzen gleichsam unterirdisch miteinander verwurzelt gewesen, so stürzt jetzt plötzlich der ganze Wall ein, mit dem sie ihr Leben gefestigt glaubte. Ihr Onkel, ihr Bruder, ihre Freundin sterben, fast alle zu gleicher Zeit, in diesen entsetzlichen Jahren: wie Niobe sieht sie, versteinert vor Gram, einen nach dem andern unter den Pfeilen des Schicksals sinken.
Vor der Liebe konnte sie flüchten, doch nicht vor dem Tod. Gegen ihn ist sie machtlos. Nun ist, sie fühlt es, alles endgültig verloren. Die Liebe ihres alternden Gatten vermag ihr, der weißhaarigen Frau, keine neuen Kinder mehr zu erwecken. Ihre Familie ist zersprengt, die Freunde entschwunden, nichts kann sie mehr begnaden auf dieser Welt. Aus dem Trümmerfeld ihres Lebens glüht ihre Sehnsucht jetzt nur den Himmel mehr an. Sie hat nur Gott mehr, um ihn zu lieben, und sie bietet ihm das einzige, das Letzte, was sie besitzt, ihren Schmerz:
„Je vous donnerai tant de larmes
Que vous me rendrez mes enfants.“
Zu ihm sprechen jetzt alle ihre Verse, zu ihm allein heben sich ihre Blicke. Die Erde hat für sie keine Heimstatt übrig, nur zurück will sie in die andere Welt, wo ihre Kinder sind und alles, was sie in diesen dumpfen Jahren geliebt. Verzweifelt pocht sie an die Himmelstür, sie weist ihre Wunden und ihre Armut:
„Ouvrez, je ne suis plus suivie
Que par moi-même et par la vie.“
Sie weist ihre Wunden, sie bietet ihre Tränen, all ihren Schmerz breitet sie ihm hin.
Ihr Leiden ist höchstes Anrecht geworden, und was einst ihre Seligkeit war, das nennt sie jetzt Gott als Sinnbild des äußersten Schmerzes, da sie empor will in sein Herz:
„Laissez-moi passer — je suis mère.“
„Moi je pars, moi je passe
Comme à travers les champs un filet d’eau s’en va;
Comme un oiseau s’enfuit, je m’en vais dans l’espace
Chercher l’immense amour, où mon cœur s’abreuva.“
Sie ist nun eine alte Frau, allein in der Welt. Armut und Trauer umschnüren ihr enges Schicksal mit schwarzem Rand. Das Feld ihres Lebens ist nach sechzig Jahren Mühe brach geblieben. Umsonst hat die Pflugschar des Leidens ihr Leben durchpflügt, Sturm hat alle Saaten verweht. Eine letzte Freundin hat sie noch, und der schreibt sie in diesem Jahr das Geheimnis ihrer Entrücktheit: „Höre mich an, ich bin heute in die Kirche gegangen und habe dort acht Kerzen angezündet, acht Kerzen, arm wie ich selbst. Sie waren für acht Seelen, für meine Seele, für Vater, Mutter, Bruder, Schwestern und Kinder. Ich habe sie brennen gesehen und verbrennen und glaubte sterben zu müssen. Ich sage es nur Dir allein: es war ein Besuch bei Gott.“ Aber bald hat sie niemand mehr für vertrautes Wort, auch diese, die Letzte, Pauline Duchambge, geht ihr voraus. Nur zu Ihm, der nicht antwortet und doch alles hört, geht jetzt ihre Klage. Alle Verse, die Marceline Desbordes-Valmore noch schreibt, die letzten begnadetsten Gedichte sind Zwiesprache mit Gott. Sie hebt ihr tränenüberströmtes Antlitz zum Himmel empor, um die Erde nicht mehr zu sehn, die alles Leben von ihr getrunken hat. Sie hat längst Abschied genommen:
„Tous mes étonnements sont finis sur la terre,
Tous mes adieux sont faits, l’âme est prête à jaillir.“
Jeder Tag ist ihr zur Last, und die sechzig Jahre stillen Leidens drängen sie nun ungestüm weg aus dieser vereinsamten Welt. Niemandem ist nun ihre Liebe, die unendliche, zu Dienst, und so fühlt sie sich ohne Sinn. Aus der Resignation wird Ungeduld, jede Stunde zwischen Menschen und Häusern Qual:
„De chaque jour tombé mon épaule est plus légère.“
Abgekehrt ist ihr Blick von dieser Welt und nur einzig in die Ferne gerichtet, in Zukunft und Vergangenheit.
So sieht sie Michelet „ivre d’amour et de mort“, trunken von Liebe und von Tod. Und aus dieser Trunkenheit entstehen ihre letzten Gedichte, die schon ganz entirdischt und von Gottesgefühl magisch durchleuchtet sind wie das Dunkel einer Kirche von farbig gebrochenem Sonnenlicht. Alles hat ihr das Leben entwenden können, nur nicht die Glut des Gefühls. Aber nicht wie eine Fackel flattert sie mehr in Leidenschaft, sondern brennt fromm und windstill wie ein ewiges Licht. „Mon âme n’est pas éteinte, elle est montée plus haut.“ Durch die immer dünnere Hülle ihrer Körperlichkeit glüht heißer die Seele durch, kaum ist sie selbst es noch, die spricht. Immer ist sie in diesen Versen die schon Aufsteigende, die schon Befreite, immer schon nahe bei Gott und nahe seinem Herzen. Schauernd reicht sie ihm die „Couronne effeuillée“ ihres Geschicks zurück:
„J’irai, j’irai porter ma couronne effeuillée
Au jardin de mon père où revit toute fleur;
J’y répandrai longtemps mon âme agenouillée:
Mon père a des secrets pour vaincre la douleur.
J’irai, j’irai lui dire, au moins avec mes larmes:
«Regardez, j’ai souffert...» Il me regardera,
Et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charmes,
Parce qu’il est mon père il me reconnaîtra.
Il dira: «C’est donc vous, chère âme désolée!
La terre manque-t-elle à vos pas égarés?
Chère âme, je suis Dieu: ne soyez plus troublée;
Voici votre maison, voici mon cœur, entrez!»
O clémence! ô douceur! ô saint refuge! ô Père!
Votre enfant qui pleurait vous l’avez entendu!
Je vous obtiens déjà puisque je vous espère
Et que vous possédez tout ce que j’ai perdu.
Vous ne rejetez pas la fleur qui n’est plus belle;
Ce crime de la terre au ciel est pardonné.
Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle,
Non d’avoir rien vendu, mais d’avoir tout donné.“
Ein Jahr noch weilt sie, nur mit den Sinnen, auf der Welt, der sich ihr Gefühl längst entwand. Und endlich, am 23. Juli 1859, nimmt sie der Tod zu sich. Auf dem hohen Friedhof von Montmartre wird sie begraben, nahe bei Heinrich Heines Ruhestatt, und in Douai, dort in dem kleinen grauen Kirchlein, in dem sie die Taufe empfangen und als Mädchen gespielt, spricht der Priester für ihre Seele das letzte Gebet. Aber in der dunklen und erhabenen Kathedrale des Ruhms lesen alle großen Dichter Frankreichs ihr die Totenmesse. Baudelaire, Samain, Victor Hugo, Anatole France, jeder sagt seine Litanei der Liebe als Dank für die ihre, jeder spricht ihrer großen Seele dichterisches Gebet, und das schönste vielleicht Verlaine:
„Telle autre gloire est, j’ose dire, plus fameuse,
Dont l’éclat éblouit mieux encore qu’il ne luit:
La sienne fait plus de musique que de bruit,
Bien que de pleurs brûlants écumeuse et fumeuse.
Mais la bonté du cœur, mais l’âme haute et pure
Tempèrent ce torrent de douleur et d’amour
Et, se mêlant à la douceur de la nature,
A sa souffrance aussi, de nuit comme de jour
Promènent sous le ciel tout pluie et tout soleil
A chaque instant, avec à peine des nuances,
Un large fleuve harmonieux de confiances
Vives et de désespoirs lents, et, non pareil.
Il chante, l’ample fleuve au capricieux cours,
L’hymne infini de toute la tendresse humaine
Où la fille et l’amante et la mère ont leurs tours,
Où le poète aussi, dans l’horreur qui nous mène,
Vient mêler son sanglot qui finit en prière
Universelle, et la beauté même d’un art
Issu du sang lui-même et de la vie entière,
Rires, larmes, désirs et tout, comme au hasard.“
Jeder hat seine Flamme des Gedichts entzündet an der ihren, und so reicht eine leuchtende Kette von Versen von ihrer Welt herüber bis zu unserer Zeit. Allmählich erst blinkt Ruhm auf ihrem vergessenen Namen. Ihre Briefe entdecken die heroische Tragödie, die ihr unscheinbares, geknechtetes Leben selbst den Nächsten verschwieg, und weisen eine beispiellose Harmonie der Dichtung und des Lebens, einen Zwieklang voll Schmerzenssüße, wie ihn kaum eine Dichterin schöner aus ihrem Schicksal löste. Und wir erst, die Späteren, erkennen ehrfurchtsvoll das höchste Geheimnis ihres Lebens und ihrer Kunst, die edelste Formel des Dichters: das Leiden müde zu machen durch unendliche Liebe und die Klage tönend durch ewige Musik.
ZWEITER TEIL
GEDICHTE
Von den Gedichten der Marceline Desbordes-Valmore ist in dieses Werk nur eine verhältnismäßig enge Auswahl aufgenommen, und zwar aus künstlerischen Gründen. Die besondere Eigenart jener französischen Verse ruht nebst ihrer sehr zarten Melodik in ihrer Einfachheit, in den natürlichen brüsken, fast naiv offenbaren Ausbrüchen und Interjektionen, in dem unerhört Unmittelbaren, mit dem sich hier das Gefühl noch heiß und zitternd an die nachschwingende Strophe weitergibt. Jede Nachdichtung gerät da in Gefahr, entweder an das Banale des Ausdrucks oder an eine Künstlichkeit sich zu verlieren: nichts ist ja schwerer zu übertragen als die spontane Einfachheit. So wurden (im Gegensatz zur früheren Ausgabe) aus größerer Anzahl nur jene Verse gewählt, die auch in deutscher Übertragung das Ungekünstelte ihres Gefühls zu vollem dichterischen Ausdruck bringen, und außerdem die Anordnung so gefügt, daß in den Versen das Lebensschicksal sprechend zutage tritt. Mit Absicht habe ich zudem in der Einleitung zwei Gedichte und einige Strophen im Originaltext französisch belassen, damit der Vergleich mit der Urmelodie sich jedem handlich darbiete.
Die Übertragungen stammen (mit Ausnahme von „Vorahnung“ und „Um das Kind einzuschläfern“, die Friderike Maria Zweig übersetzt hat) von Gisela Etzel-Kühn, der hochbegabten Dichterin, der wir auch eine außerordentliche Nachdichtung von John Keats verdanken. Ihre Absicht, das lyrische Werk der von ihr sehr bewunderten Marceline Desbordes-Valmore vollständig der deutschen Sprache zu gewinnen, machte ihr früher Tod zunichte. Sie ist im vierten Jahre des Krieges in Bern gestorben, mitten im Werke, dem sie viel von ihrer Kunst und ihre ganze Liebe gab.
Mein Zimmer liegt fast
Schon im Wolkenbereich;
Der Mond ist sein Gast,
Immer ernst, immer bleich.
Mag’s drunten nur läuten!
Denn was es auch ist,
Hat nichts zu bedeuten,
Da du es nicht bist!
Ganz still hier verborgen
Führ ich Nadel und Zwirn,
Ohne Zorn, ohne Sorgen,
Doch mit weinender Stirn;
Den blauesten Himmel,
Ihn seh ich recht gut
Und das Sternengewimmel —
Doch auch Stürme in Wut!
Ein Stuhl steht im Zimmer
Zu seinem Empfang;
Der seine war’s immer,
Der unsre nicht lang.
Hier steht er auch eben,
Mit Schleifen geschmückt,
So starr und ergeben,
Wie ich, so bedrückt.
Ich fühl’s gewiß, ich werd’ ihn wiedersehen,
Es brennt die Stirn, und süßer sind die Tränen.
Ich warte, horche auf, es stockt das Wort —
Ein Traum verkündet ihn und schwindet fort,
Erschauern treibt das Blut mir aus den Wangen.
Wie anders klingt der Glockenschlag der Frühe!
Den Tauber grüß ich: Liebe zu empfangen.
Brächt er sie nicht? ich bebe, o ich glühe!
Mit solchem Einsatz zahl ich seine Nähe;
Nur mählich lehrt mich Liebe glücklich sein:
Ich frier nicht mehr, wenn ich ihn nicht mehr sehe,
Denn schon schließt sein Herz meines in sich ein.
Dies Buch! ah, ich vermag nichts drin zu lesen
Als dieses eine nur: bald wird er bei dir sein!
Und kindisch schwank ich zwischen Lust und Schmerz —
Ja dies ist Hoffnung, kenn ich doch ihr Wesen,
Geduld, o Liebe! Gnade! Schon’ mein Herz!
Zu grell ist Licht nach dunkelvoller Nacht —
Laß mich in Träumen noch zu dir mich neigen,
Laß stille stehen die Zeit, mach alles lind und sacht!
Flüsternde Weide, Bächlein, wollt ihr schweigen!
Horcht auf, beruhigt euch, lang wird es nicht dauern:
Er kommt! schon hör die Erde ich erschauern,
Wie damals unversehens, in der ersten Zeit.
Zu eng ward mir der Fenster Blätterschatten,
Ich floh hinaus. Was? Ist noch Sommerzeit!?
Und Menschen sind? In Blüte Feld und Matten?
Doch gestern! ohne ihn war alles trübe,
Ach gestern drang kein Strahl zu mir herein —
Gott! — Sommer, Licht und Himmel: er ist’s ganz allein!
Ja du mein Leben! Alles lacht nun unsrer Liebe —
Du kommst! und Sommer, Himmel, Liebe, sie sind mein!
Ich fühle, wie sich Flügel in mir regen,
Ich schwing mich auf und fliehe dir entgegen!
Ich war wohl dein von allem Anbeginn,
Mein Leben, kaum bewußt, dir schon verkettet!
Dein Name sagte mir’s, der meinen Sinn
Verwirrend überfiel, in den gebettet
Dein Herz sich barg, das meine zu verlocken.
Ich hörte ihn — und er verführte tief;
Ich lauschte lange, bebend und erschrocken:
Da war’s, daß deine Seele nach mir rief!
Hast du’s gewußt, daß du, mir unbekannt,
Schon mein Geliebter warst für alle Zeiten,
Daß ich ein lang Gefundnes wiederfand,
Als du dann kamst, mein Leben zu begleiten?
Du sprachst — und unsre Seelen küßten sich,
Ich wurde bleich und schlug die Augen nieder;
Aus deinen Blicken rief dein Name mich,
Und Antwort gab mein Herz: „Da ist er wieder!“
Von neuem nahm sein Zauber mich gefangen;
Wie süßes Schicksal klang er meinem Ohr,
Ich sprach ihn immer, und ich sah voll Bangen,
Wie Glut und Hoffen sich an ihn verlor.
Ich las ihn überall, las ihn im meinen,
Ich gab ihm Tränen, gab ihm nie genug;
Oft wollt es meinem Blick, geblendet, scheinen,
Als ob er eine Krone trug.
Ich schrieb ihn nieder — doch verlor den Mut
Und wagte mehr nicht, als ihn stumm zu lächeln;
Er trug des Nachts in meinen Schlaf die Glut,
Und morgens weckte mich sein sanftes Fächeln.
Er lebt in mir, mein Seufzer schließt ihn ein,
Ich atme, und sein Hauch durchschwillt mein Herz:
Geliebter Name, meine Welt ist dein,
Wie ewige Inschrift und wie Erz in Erz!
Du gabst mir Leben, und du wirst im Sterben
Mit letztem Kuß mein letztes Sein erwerben.
Heut morgen wollt ich dir Rosen bringen,
Ich füllte mit ihnen den Gürtel zum Springen —
Der allzu bedrängte, er konnt sie nicht fassen.
Er brach auseinander; die Rosen verflogen
Im Wind und sind alle zum Meere gezogen.
Die Wogen, um die sie mich wirbelnd verlassen,
Erschäumen von rötlicher Glut übergossen,
Mein Kleid aber hält noch die Düfte verschlossen...
Komm abends — ich will sie dich atmen lassen!
Gedenkst du noch, mein Herz, mein armes Leben,
Des bleichen Herbsttags, der so traurig schien?
Die Wälder seufzten und beklagten ihn,
Der zögernd nur sein Lebewohl gegeben.
Die Vögel sangen keine Zuversicht —
Ein kalter Reif bedrängte ihre Schwingen —
Und wie sie stumm an kahlen Ästen hingen,
Ersehnte man die Blüten und das Licht.
Ich war allein, dem lauten Fest enteilt
Und deinem Blick, um zur Vernunft zu finden,
Doch Schwermut der Natur ist nichts, das heilt,
Wird nur mit unsrer Schwermut sich verbinden.
Ziellos und hoffnungslos und ganz versunken,
Mit langsam scheuen Schritten ging ich hin:
Nun schien der Herbsttag schwül und feuertrunken,
Denn dein geliebtes Bild trug ich im Sinn.
Mit letzter Kraft entfloh ich deinen Ketten
Und meinte so, mich vor mir selbst zu retten.
Mein Auge aber, das in Tränen glühte,
Empfand ein Wirken, das herübersprühte;
Und durch den Nebel kam es auf mich zu,
Ließ mich in Schreck und Zärtlichkeit erbeben:
Vom neuen Sonnenglanz verklärt, umgeben —
Die Himmel öffnen sich — erschienest du!
Ich wagte nicht zu reden; tief betört,
Vom Zauber der Begegnung heiß benommen,
Vermocht ich nicht zu reden, wie verstört,
Daß deine Seele nun zu mir gekommen.
Doch als du meine Hand mit deinen Händen
Umspanntest und ein Schauer mich durchfloß,
Als Röte meine Stirne übergoß —
Mein Gott! Wie flog mein Blut in heißen Bränden!
Nichts mehr von Flucht und gar nichts mehr von Grauen;
Zum erstenmal gestandest du dein Herz.
Mein eignes Leid verband sich deinem Schmerz,
Und meine Seele gab dir ihr Vertrauen.
Ich weiß es noch! Weißt du es noch, mein Leben?
Die köstlich süße Pein
Der Worte, dir von Schwermut eingegeben:
„Ich leide, doch dies Leiden muß vom Himmel sein!“
Vom Walde brach kein andrer Laut das Schweigen.
Der Tag war unsrer Tage hellstes Glück;
Ob nah am Schwinden, hielt er noch zurück.
Und seine Flucht schien deine anzuzeigen!
Das Licht der Welt beglänzte unsern Frieden,
Doch eine Wolke schlang sein Feuer ein —
In unsern Herzen, ewig jetzt geschieden,
Blieb nichts zurück als nur der Widerschein.
Das Schicksal hatte schon dreimal die Runde
Im Teppich meines Lebens neu geflochten,
Drei Jahre, die ein Dank zu sein vermochten
Für meiner Mutter schmerzensreiche Stunde —
Als deine dich gebar; seitdem bestand
Von dir zu mir ein unsichtbares Band,
Das wies mich durch die Welt, nur dir entgegen,
Den gleichen Pfad, den du zu mir genommen:
Uns hieß das Leben zueinander kommen
Und führte uns auf vorbestimmten Wegen.
Wir fanden uns, und du erkanntest mich,
Dein Auge war mein Himmel, und ich liebte dich!
Es stirbt die Nachtigall am Übermaß der Lieder
Und hinterläßt der Brut doch nur das gleiche Los;
Als meine Mutter starb, da sah sie fassungslos
Auf mich, ihr Kind, das ihre Seele erbte, nieder.
Ihr Blick sprach Zuversicht, doch die besorgte Hand
Hielt innig lange Zeit die meine fest umspannt,
Als suche sie vom Erbe, das sie mir gegeben,
Mein junges Sein befreiend mit empor zu heben.
Und lange, lange Zeit beweint ich ihren Tod,
Trug ihr Geheimnis, das ich nicht zu deuten wußte,
Versiegelt in der Brust und litt gleich ihr und mußte
Gleich ihr, die Stirn gesenkt, bedrängt von bittrer Not,
Die allzu viele Liebe tief in mir bewahren:
Ich hatte noch kein Lied, mein Leid zu offenbaren!
Sein schwaches Schlagen, das der Zeiten Maß
Nur zögernd wiedergab, verriet, wie wenig Leben
In diesem Herzen war; und wie ein Kind, das eben
Halb eingeschlummert über seinen Büchern saß,
Hielt meine Hand mein Schicksalsbuch verschlossen;
Mein schwarzer Gürtel, meine dunkle Trauer band
Mich an der Mutter Grab — was hatte noch Bestand?
Die Welt war groß und leer; es fehlte ihr die Stimme,
Die einzige, die das wüste Lärmen und Gebraus
Zur Heimat machte; nein! die Welt war nicht mein Haus!
Ich scheute ihr Gesetz, ihr Urteil, ihre schlimme
Verlockung und Bedrohung — und von Angst gehetzt
Fand ich das Wort, den Ruf, das laute Lied zuletzt!
Doch als du sprachst: „Ich komme!“ welch Geläute
Verscheuchte da den Schlaf aus meinem Blick?
Mit gleichem Arm umschlang uns das Geschick
Und trug uns hoch empor; mein Herz, das heute
Noch müd gewesen war und ohne Halt,
Es blühte auf und hatte nicht mehr kalt.
Gleich matter Blume, die im Licht von oben,
Ganz ohne Stütze, ohne Halt und Pfahl,
Nur an dem Sonnenkuß, dem rosigen Strahl,
Sich aufwärts reckt, ward ich von Glut erhoben. —
Und daß du aus den Höhen kamst — so tief!
Das war, weil meine Hoffnung dich auf Knieen rief!
Dann, seit dein Wille mich ergriffen hatte,
Warst du mein Himmel, meine Religion,
Und schweigend nenn ich Bruder dich und Sohn
Und meine Seele, mein Gebet, mein Gatte.
Du wirst es niemals wissen, du, wie weit
In dich hinabgreift meine Innigkeit!
Und würdest du vom Tode mir entrissen —
Ich fände dennoch Augen, dich zu sehn,
Und Rufe, Tränen, die ins Dunkel flehn,
Und Helligkeit und Sieg für Hindernisse!
O selige Mutter, die als Kind dich kannte
Und schützend ihren Arm um deine Jugend spannte!
Sei nicht besorgt, siehst du mich schweigend und versonnen
Dich meiden; meine Liebe sinnt — und sehnt sich oft,
Und brächt es mir auch Tod: die Seele träumt und hofft
Und hat schon manche Frage heimlich fortgenommen.
So höre diese: als du damals mich erwählt —
Hast du dich mir auf Tod und Leben anvermählt?
Hast du so Ewiges gefühlt? — O sag mir’s, sage!
Denn sieh, aus allen Tiefen frägt dich meine Frage.
Ich möchte, dir zur Lust, ein ganzes Weltall sein —
Und bin doch nur ein Weib und trage mehr an Jahren
Als du. So bitt ich dich, laß es mich nie erfahren,
Daß du’s empfindest, nein, sei gütig, wehr dem Schein:
Ich weiß dir Dank dafür und will beim Schicksal werben,
Daß es mir gönnt, vor dir — vor deinem Tod — zu
sterben!
Da du es bist, der unser Bündnis neu
Verknüpfen will,
Da du es bist, der fleht: „Sei lieb, sei treu! —“
So höre still:
Der Schwur, der das, was süßer Traum sich malt,
Im Brief verspricht —
Da man den Schwur mit tausend Tränen zahlt,
So schreib ihn nicht!
Gleichwie die Landschaft, ist der Sturm vorbei,
In Sonne ruht,
Sei unser Auge hell, die Stirne frei
Und froh und gut.
Noch scheucht von meinem Weg dein liebes Wort
Die grauen Sorgen,
Doch sage nicht „auf ewig!“ fort und fort,
Sag nur „auf morgen!“
Die hehren Tage, rein und anmutvoll,
Die blumigen Tage, —
Die schweren Tage, wild und dornenvoll,
Durchschrillt von Klage —
Nicht dieses Bild, das schmerzt, lähmt und erstickt!
Komm, sieh nicht hin;
Nein, Zuversicht, die kindhaft vorwärts blickt,
Trägt mehr Gewinn!
Ach, könnt es sein, daß neues Leben sich
Erschließen würde,
Um anders zu verketten dich und mich —
Und ohne Bürde —
Hier, dieses Wort, das wahrste Wort von mir,
Dir fliegt es zu,
Heut abend wacht ein Weib und träumt von dir,
Komm, nimm mich, du!
Das ist nun so! Ich liebte ihn, und er allein,
Nur er gefiel mir; seine Züge, seine Stimme,
Sanft wie die Liebe, fürchterlich im Grimme...
(Erbarmen! Sieh, ich weihe dich in alles ein!)
Was er begehrt, gelobt — Gelöbnis gab ich wieder,
Ich liebte ihn, die Qual — anbetend kniet ich nieder.
Sein eifersüchtiger Vorwurf rührte mich noch mehr.
Ich starb an ihm und sagte nur: „Vergib!“
Ich war so unterjocht, daß mir kein Selbst verblieb.
Und hättest du ihn weinen sehn, du wärest sehr
Mir bös geworden; ja, du hättest nicht
Ihn hören können, ohne selbst zu weinen.
Begreifst du, daß mein Herz sich schuldig spricht
Und gerne stirbt — hinschmelzend in dem seinen? —
Das schwanke Schilf, von Sturm bedroht,
Sieht seinen Mut gebeugt; doch weht ein sanftrer Hauch,
Erhebt es sich, schaut auf aus seiner Not:
So heb an seinen sanftren Blicken ich mich auch.
Wenn dann mein Herz von neuem Leben fand —
Wie trostreich war sein Wort und wagte keine Klage;
Gleich ihm erbebend und entzückt, empfand
Ich nur des Sturmes Lust — vergaß die Niederlage!
Welch süßes Beieinander, Gott, welch irres Glück,
Wenn seine Stirn an meinem Herzen lehnte,
Wenn seine Träne sich nach meinem Lächeln sehnte —
Wenn ich ihn fühlte, mein und ganz zurück!
Mir war kein Leid geschehn, er weinte. — Doch die Zeit
Des Unrechts und der Tränen, Schwester, die ist weit;
Das Unrecht seiner Liebe, das von Reizen sprühte —
Jetzt wird mir nichts, als seine stumme Güte.
Die Güte des Unbeugsamen! Wie straft er hart,
Daß mich ein Tag genarrt,
An dem ich Macht besaß, an dem mein Friede starb,
An dem mein Glück für alle Zeit verdarb.
Für alle Zeit! Glaubst du? Sag, daß es Irrtum ist,
Daß er nur prüfen will, nicht grausam sein,
Mir wiederkehren wird — sag mir’s zum Schein,
Doch sieh, daß er mich täuscht mit gleicher List.
Erbitte das von ihm, beschwöre ihn ... nein, bleib!
Uns trennt ein Stolz — ein Stolz so kalt wie Tod.
Du siehst, er flieht vor mir, du siehst auch meine Not.
Ein Mann ist grausam — daran stirbt ein Weib.
Mir bringt es Sterben — ihm war’s Zeitvertreib!
Klag ihn nicht an; noch bin ich ihm ergeben,
Bin noch am Leben;
Und eh ich ihn verriete — Schwester, nein,
Viel lieber ewig stumm und ewig klaglos sein!
Nichts ist beständig, also auch nicht er.
Woher dies Murren und die herben Tränen?
Was nimmt die Liebe das Verschmähtsein schwer!
Nichts ist beständig — also auch nicht er.
Er flieht ein Glück, das ungerührt ihn ließ —
Ist’s an der Liebe, ihm das vorzuhalten?
Mein Weh soll nur in dir sich neu gestalten,
Und sucht er deinen Blick, so sag ihm dies:
Sprich nur mit deinen Augen meinen Namen,
Stumm sei dein Vorwurf, dein bescheidnes Leid;
Verzeihe ihm wie ich zu jeder Zeit.
Ach, alle Flammen, die zum Sterben kamen,
Entzünden sich an keiner Reue neu!
Mag er ganz unbefangen mich beweinen
Und arglos, daß er schuldig sei,
Sein Trauern still mit deinen Tränen einen.
Sieh, Schwester, lang schon habe ich den Tod erkannt.
Denn plötzlich fiel auf ihn ein heller Strahl,
In jener Nacht, als aus erloschnem Brand
Des Liebsten kalter Blick sich zu mir stahl.
Wie schreckt die Seele auf, wenn ihr ein Wahn zerrinnt!
Der schwanke Halm erbebt nicht so im Wind,
Nicht so der Vogel, den ein Blitz erregte —
Ich fühlte, wie ein Unheil seine Netze legte.
Zum ersten Mal — wie stets voll Überlegenheit —
Schien er mein Sein von eignem Sein zu trennen:
Er sprach von Glück, doch ohne Zärtlichkeit,
Sprach von der Zukunft — ohne mich zu nennen!
Und seine Hand, die sonst wie er so freundlich tat,
Blieb kalt bei meinen Sorgen,
Sein Auge, das so oft ein Wiedersehn erbat,
Sprach nicht: „Auf Morgen!“
Bleich, fast auf Knieen, beschwörend sagte ich —
Ich sagte nichts; kann doch ein Schluchzen sprechen!
Ein stummer Schrei begehrte bitterlich
Den Busen, der ihn niederhielt, zu brechen.
Das dumpfe Schweigen, das viel eifrig spricht —
Ach, alles, alles bat in mir: er hörte nicht!
Es war zu Ende, Schwester. Unter Tränen kam
Ich zur Vernunft, doch nicht zurück zum Leben:
Ich lauschte... bis ich seinen Schritt nicht mehr vernahm;
Ich war allein — ein Kindlein, das soeben
Verlassen von der Mutter, seine Stimme bricht
An zu viel Weinen, und dann reglos steht,
Bleich und erwartungsvoll; dies Kind fühlt nicht
Solch grauenvolle Pein, in der es untergeht,
Nicht solche dunkle Last wie würgend an der Kehle,
Nicht solche Not der Seele,
Nicht solch Gespenst, das drohend zu ihm findet,
Wenn seinem Blick der Tag — die Hoffnung, schwindet.
Was ist’s, das jenen Vogel entsetzt zum Neste treibt?
Der Schatten meiner nahen Todesnacht steigt auf:
Sieh, wie er dort im Nebel schwarze Zeichen schreibt,
An meinen Fensterblumen windet sich’s herauf.
O küß mich, Schwester! Seine dunklen Schwingen
Berühren mich, um mir den ewigen Schlaf zu bringen.
Der Strahl, der flieht, es ist der Tag nicht mehr,
Nicht mehr das Leid und auch die Liebe nicht;
Es ist mein letzter Blick: so kalt wie er
Ist mein Gedächtnis, wie ein Spiegel, der zerbricht.
Nichts ist beständig, Schwester, alles bleicht, vergeht —
Ich weiß, daß Friede oder Tod in meinem Herzen steht.
So ist es nicht für ihn, daß ich durch Tage,
Langheiße Tage, müde Schritte trage?
Nicht sein Erwarten, seine Liebe nicht,
Nicht seine sanfte Stimme voll Gewalt,
Die durch die Dunkelheit beschwörend spricht —
Nichts blieb mir, nichts! Nahm er mir alles fort,
Was ich geliebt? Die Welt ist leer und kalt;
Die Zeit steht still, die Stunde schlägt nicht mehr.
Und immer leben, immer, fort und fort!
So stirbt man nie, und diese Last, die schwer
Auf meine Seele drückt, ist Ewigkeit?
Endlose Nacht, was brütest du für Flammen!
Selbst Vogelseufzer schweigt zur Abendzeit,
Mein Jammer nur bricht nicht in Schlaf zusammen.
Die Glut erlosch — und dennoch fehlt der Schlummer!
Ist’s doch nicht mehr für ihn, wenn meinem Kummer
Die Muse folgt und mit mir ruhlos schweift
Und über Blumen schreitend oder Moos
In meine Verse Duft und Tränen streift.
Er liest mein Lied nicht mehr; gedankenlos
Vermeint er, meine Seele sei erstorben;
Sein kaltes Herz, das einst um mich geworben,
Begreift die Qualen nicht, die in mir ringen.
Erfahr er’s nie! Kann er mir Heilung bringen?
Sein Stolz soll nie die herbe Wollust kennen,
Daß meine Tränen die Gewalten nennen,
Die mich voll Anmaß ihm entgegenzwingen.
Was dankt ich meinem Schrei? Er wird erschrecken,
In Mitleid wiederkehren? Lieber Tod!
Wer kann ein ganz Zerstörtes neu erwecken?
Ist er denn noch das Glück? Er selbst zerbrach
Sein Bild und warf mein Herz in bittre Not.
Kann er die süße Unschuld wiedergeben
Und Unerfahrenheit, statt Schmerz und Schmach?
Die Liebe floh mit aller meiner Habe,
Und was ich gab, das ist verlorne Gabe.
Ich sterbe, von der Pein des Schicksals übermannt;
Willst du des letzten Augenblicks Entsetzen lindern?
Leg wieder auf mein Herz die schuldige Hand —
Laß nichts dich hindern!
Sobald es aufgehört, dich flammend zu erleben,
Macht keine überflüssige Reue dir Beschwer;
Sprich nur: „Dies Herz, so zärtlich mir ergeben,
Es liebt nicht mehr...“
Die Liebe flieht aus meiner wunden Brust; ich sterbe!
Schau an dein grausam Werk, schließ nicht die Augen zu:
Der Tod in mir ist nicht so kalt und herbe,
So Eis wie du!
Nimm hin dein Gut! Dies Herz, das nur für dich gewesen,
Hat keine andre Gabe als sich selbst bereit;
Zerreiß es! Und noch immer wirst du lesen,
Daß es verzeiht.
Dein Schicksalssturm hat mich ins Knie gebogen,
Und deine Tränen weinte ich mit dir;
Wie hoch du flogst, ich bin dir nachgezogen,
Dein Weheschrei fand Widerhall in mir.
Doch was ist Freundschaft dem, der Liebe fühlt?
Ich habe nichts geheilt und nichts erworben.
Verbrannter Boden, den die Woge kühlt,
Er bleibt verbrannt — so bleibt das Herz gestorben.
Ich liebe noch — o nein! Ich bin nicht tot!
Ich gleite vor dir her durch die Gelände;
Wie erster blasser Schein von Morgenrot
Erwärm ich deine Blicke, deine Hände.
Der Kranke fühlt in seinem Schlummer nicht
Den kühlen Hauch, der seine Leiden wendet,
Den sanften Traum, der Schmerz und Fieber bricht:
Ich bin der Traum, den Gott für dich gesendet.
Wie müder Cherubim, der das Gefunkel
Der goldnen Schwingen fest zusammenrafft,
Verhülle deinen Glanz — und durch das Dunkel
Geleite dich mein Licht und meine Kraft.
Laß nicht mich sterben unterm Eis der Jahre,
Gott, der mein Herz aus reinem Feuer schuf.
Mich ängstet Nacht; gib mir in tagesklare
Und sturmdurchjagte Stunde deinen Ruf!
Und vor dem Tod des Einen sei’s vollbracht,
Den ich geliebt; zu schwer ist andres Sterben!
Sein Atem hauche Glut in mein Verderben
Und dulde nicht, daß Frost mich fühllos macht...
Da meiner Kindheit Traum
So rasch entflieht
Wie Vogelflug vom Baum,
Der talwärts zieht —
Da mich des Schöpfers Gnade
In Irre wies,
Nur unbeständige Pfade
Und Hoffnung ließ —
So komm mit goldnem Flug,
Du Jugendzeit,
Die Seele ist zum Zug
Ins All bereit.
Komm, eine mit der andern,
Wie Duft und Licht,
Laß uns zusammen wandern
In Zuversicht.
Du Schöne bist das Kleid,
Der Perlbehang,
Mit dem Verborgenheit
Mich sanft umschlang.
Es schützt die scheue Meise
Der Rosenstrauch,
Du birgst und schützest leise
Mich Scheue auch.
O schmerzgebeugtes Haupt
Durch lange Nacht,
Die noch an Liebe glaubt,
Jugend, hab acht!
In Stürmen lebt die Liebe,
Und wer sie stellt,
Wie mutig er auch bliebe,
Wird leicht zerschellt.
Gott ist die Liebe; nur,
O Jugend, sieh,
Such ihre Flammenspur
Hier drunten nie:
Kein Blühn und keine Gabe
Uns bleiben kann;
Die Kränze ziehn zum Grabe,
Die Liebe himmelan.
Wie lange noch, und ich
Seh dich nicht mehr,
Die Wege trennen sich,
Wir weinen sehr.
Zu andrer Seele wendest
Du dich ohn’ Frist,
Die du dich nie verschwendest
Und ewig bist.
Hin wo die Stunde schlägt,
Dein Flügel zieht,
Der Strom ins Weite trägt,
Der Tag entflieht —
O Jugend, froher Falter,
Dort schwebst du hin,
Da ich vom bleichen Alter
Ummauert bin.
Habt Mitleid! Süß war meine Welle,
Doch mich verschlang das gierige Meer;
Nun trag ich Bitternis einher,
Wohin mich stößt des Windes Schnelle.
Den nicht ich kannte — salziger Sand,
Rollt mit mir durch die grünen Fluren,
Gibt Gras und Blumen herbe Spuren,
Und leise klagt ihr Widerstand.
Ich stürzte wild von Bergen nieder,
Der Nachtduft, den ich droben trank,
Der tief in junge Wasser sank,
Dringt nie herab zu mir — nie wieder!
Froh flog ich hin, voll Übermut,
Und schwang, gleich Schleiern von Topasen,
In buntem Tanz Milliarden Blasen —
Wie anders stürmte meine Flut!
Aus Himmeln schauten Vögel leise
Ihr Bild in mir und liebten mich
Noch mehr als Wolkentrunk, denn ich
Erfrischte ihnen Lied und Weise.
Kein Ton erfreute mehr das Ohr
Mit Gruß und Lockung, hinzulauschen,
Mit melodiösem Sang und Rauschen,
Als meiner Strömung heller Flor:
Mein klangvoll klares Bachgeriesel,
Darüber grüne Kresse kroch;
Mein frohes Lied, es murmelt noch,
Doch winterdumpf, durch Sand und Kiesel.
Kein Jubel klingt auf meinen Pfad:
Der Vogel, dessen Durst betrogen,
Ist Wolkenzügen nachgeflogen;
Die Nachtigall kommt nicht zum Bad.
Des Himmels Glut und lichte Zier
Streut ich als Perlen unters Moos...
Ach, süß war einst mein Wasserschoß —
Jetzt schlepp ich nur noch Salz mit mir!
Du Freundin von Armut und Trauer,
Du ewiges Lächeln im Leid,
Du liebender, glühender Schauer
Der Güte, die sieht und verzeiht!
Deine Flamme hat nie mich betrogen,
Wie heftig der Sturmwind auch blies,
Dein Licht hat mich niemals belogen,
Wenn es Wiedersehen verhieß.
Den Wipfel der jungen Platane
Erhebst du zu Fülle und Glanz,
Meinem Fenster als Vorhang und Fahne,
Meiner Stirn als kühlenden Kranz.
Durch Italiens Pracht und Zypressen
Hinwandl ich, die Blicke gesenkt,
Und ob mich auch jeder vergessen —
Du, du hast Erbarmen geschenkt!
O gieß deine strahlenden Küsse
Vom Himmel herab in die Welt,
Leuchtfeuer durch Finsternisse,
Das Abgrund um Abgrund erhellt.
Hoch über den Bergen und Stegen,
Schau, Flammenseele, uns zu,
Auf fremden verworrenen Wegen
Bewach und beschütze uns, du!
Hüll Frankreich in goldene Ranken
Und die Herzen, die dort mir vertraun,
Und laß meinen Sohn in Gedanken
Das Auge der Mutter erschaun.
Gieß Licht in sein Suchen, sein Sehnen,
Doch weint er um mich, weint vor dir —
O Stern, so sammle die Tränen
Und schütte sie aus über mir!
Ich kam auf Erden, wo ich schreite,
An mehr als eine Schlucht, ich fiel,
Dann rief mein heißer Schrei ins Weite,
Mein Gott, mein Vater war sein Ziel.
Und sanft und liebreich glitt hernieder
Ein Abgesandter deiner Huld
Und half mir aus dem Dunkel wieder —
Mein Gott, zahl du ihm meine Schuld!
Ich sah auf Erden, wo ich weine,
Manch Auge, drin ein Beten stand;
Gott selber sprach aus seinem Scheine —
Ich sah in dieses Himmelsland,
Darin viel heller Stern erstrahlte,
Und lernte Mitleid und Geduld
Und hatte nichts, womit ich zahlte.
Mein Gott, bezahle du die Schuld!
Ich fand auf Erden, wo ich singe,
Oft Herzen voller Harmonie;
Verborgne Muse, deren Schwinge
Gefaltet bleibt, so lauschen sie
In Nachsicht meiner armen Leier,
Und sind voll Sanftmut und Geduld;
Mein Lied ward stolz durch sie und freier —
Mein Gott, bezahle meine Schuld!
Ich traf jedweden Tag auf Erden
Das große Heer des Elends an,
Sah Waisenkinder bresthaft werden
Und todessiech und sterben dann.
Wie vieles Leid mußt ich erschauen!
Mein Blick erschrak und wandte sich,
Mein Herz jedoch spricht voll Vertrauen:
Sieh an, mein Gott, gib du für mich!
Vor allem ihr, nehmt hin mein Mitgefühl,
Ihr Ungeliebten, Schwestern ihr im Leide!
Nehmt sie: den Traum, der Tränen Liederspiel,
Dies bittersüße, traurige Geschmeide.
Im Buch hier, seht, liegt eine Seele fest;
Macht auf und lest und zählt die Leidenstage!
Ihr Weinenden auf Erden, kommt und preßt
Aus dieser Asche Glut, die mit euch klage.
Singt! Frauensang bringt vielen Schmerz zur Ruh.
Liebt! Mehr als Liebe bringt der Haß Verderben.
Gebt! dem Erbarmen fliegt die Hoffnung zu:
Solang man geben kann, will man nicht sterben.
Vermögt ihr eure Tränen nicht wie ich
Zu schreiben — oh, dann schenkt sie diesen Zeilen.
Verzeihn ist Beten! So entschuldigt mich,
Daß diese Blätter eng mein Schicksal teilen.
Ihr meint, wer sein Gefühl in Worten sagt,
Der sei verächtlich, der sei nicht bei Sinnen?
Der Vogel singt — wird er drum angeklagt?
Mehr sanft als rasend scheint mir sein Beginnen.
Weint! Zählt die Namen der Verbannten Frankreichs;
Den großen Herzen, die so hoffend brennen,
Fehlt Luft und Freiheit. Legt die Trauerpalme
Zu Füßen ihrer Leiden hin und kommt!
Der Kerkermeister nur darf sie erblicken.
Kommt weiter! Unsre frommen Arme haben
Nicht Kraft noch Waffen, und wir können nicht
Dem Brudermorde das Gelübde weihn,
Doch wir sind Frauen, unser sind die Tränen
Und das Gebet — und Gott, der Gott des Volkes,
Will dies von uns. Seht hin, zum Kerker gleiten
Die heiligen Seelen; seid gegrüßt, die ihr
Hienieden eure Schwingen still verbergt!
Ihr blassen Fraun in dünnen feuchten Mänteln,
Viel Schmutz und Staub erlahmte euren Schritt.
Gegrüßet seid! Lebendige Tränen röten
Den Blick, der in die dumpfe Welt sich stürzt
Und drin ertrinkt. Ihr irrt umher wie einst
Im Hain Gethsemane; denn Christus leidet
Und Judas triumphiert; ja Christus leidet,
Denn viel Verbrechen fühlt sein Herz voraus.
Er, der die Ketten brach, obgleich sein Arm
Ans Kreuz genagelt war, er sieht von neuem
In seinem Blute viele Opfer bluten.
Er möchte nochmals sterben, um die Hölle
Nochmals zu schließen! Eilt, ihr Waisenkinder,
Steigt in die Wage, betet für die Bösen,
Die ohne Reue leben, und erkauft
Verzeihung aller Missetat mit Tränen,
In bittrer Flut wascht unsre Toten rein!
Und wir, laßt uns nicht mehr mit unsern Fahnen
Die Söhne senden in ruchlosen Kampf.
Soll die Scharpie, die unsre Hand gerichtet,
In unsres Herzens eignes Blut sich tauchen?
Erbarmen! Keine Zeit bleibt uns zum Haß,
Der bös und niedrig ist; es tagt, es tagt!
O Frankreich, sieh, dein Gott kann Liebe brauchen,
So sei in Liebe ohne Unterlaß,
So sei in Liebe, liebend sei’s gewagt,
Geh hin, zerbrich die Ketten, daß es tagt!
Nun bist du da, mein Kind, mein junger Gast!
Seit einer Stunde da! Oh, wie erwartet,
Dein Leben wie erkauft! Kannst du dafür?
Nein, nein! Mein Schrei barg keinen Zorn zu dir.
Du, trugst du nicht schon Weh, bevor zum Tag
Du aufgewacht, und halfst du nicht dazu,
Daß wir uns endlich sehn? Mein Schatten du,
Du Kind aus meinem Sein geboren, das
In diesem Sein mich übermächtig hält,
Auch dir ward Schmerz in deiner engen Welt.
Des Tages trank mein Blick für dich die Sonne,
Ich ging des Nachts in deinen Kerker ein.
Aus meiner armen Seele suchte ich
Dir deinen Himmel aufzubaun und mied
Erinnerung an Böses wie ein Gift;
Ich wollte Gott erschaun, dich schön zu machen,
Dein Herz mit seiner Güte zu durchtränken,
Dem blinden Geist von seinem Licht zu schenken!
Vergiß das nicht: ich sprach zu dir von Gott;
Ich schuf dich aus Gebet, aus süßen Tränen,
Dein Ohr aus Echolaut der heiligen Stätte;
Vor unsrer Unrast barg ich dich lebendig,
Und trug mein Weinen hin zur Abendsonne,
Damit du rein und lieblich würdest, wie
Die Blumen sind, und schritt gedankenvoll
In grünes Schilf, um mit lebendigen Quellen
Dir Trank zu geben, die sich kühl ergossen
Und unser beider Fieberglut umschlossen.
Weißt du, wie oft, allein in hoher Kirche,
Wie lang die hellen Engel uns besahn?
Bedächtig schreitend trug ich dich dahin,
Dich Unsichtbaren, ihre schönen Züge
In deine unbestimmte Form zu meißeln.
Ich habe recht getan! Kein Kind hat je
Vom Himmel so viel Himmel mitgenommen
In seinem tiefen Blick, und keine Stirn
Erstrahlte je so lebensvoll und licht.
Was solch ein kleines Antlitz Bilder birgt!
Von allem, was ich liebte, zeigst du mir
Die lieben Züge, und entschwundne Engel
Wie viele lächeln mir nicht wieder zu
In deinem jungen Lächeln, Engel du!
Du warst das All! Ich hielt den Blick gesenkt,
Bedeckt von meiner Hand, und rief nach keinem,
Nach keinem in der grausam kalten Welt,
Mir Ruh zu geben, meinen Kopf zu stützen
Und meine Frucht vor Sturmeswut zu schützen.
Doch als ich meinen Blick in deinem Namen
Zum Himmel hob, da stahl dein Lächeln sich
In meine Tränen; in der bittern Woge
Erschien mir Gott und ließ in meiner Armut
Mich Mutter sein, und seligen Dank zu Gott
Barg nun des Weibes süßer Weheruf —
Des Weibes, dem Er einen Sohn erschuf.
Die Wiege, leer noch, gab den Stunden Leben;
Ein Engel atmete in mir durch Tag
Und Nacht; ich hegte sein Geschick, ich war
Sein gutes Haus, ich hielt ihn froh geborgen!...
Wer könnte sterben, so voll Stolz und Sorgen?
Auch brach ich arm in meine Kniee nieder,
Als man mich hob — allein und allzu leicht —
Und suchte nach der lieben kleinen Last;
Denn ob du noch so nah mir bist, nun trennt,
Die gestern eins wir waren — doch die Luft,
Und ich muß weinen und — verzeih, mein Leben!
Du, dieser Welt durch mich, für mich, gegeben!
Leb wohl! Ich bin nicht mehr die frohe Larve,
Darin die Seele meiner Seele lag
Neun Monde lang; doch wenn ich deiner Blüte,
Der zarten, Schutz gewesen bin, so kehre
Als Mann zuweilen heim in meine Hut.
Ich bin die Mutter: ein Band hielt uns beide,
Die Liebe wird die Liebe suchen gehn.
Trennt je die Erde, was der Himmel bindet?
Im Leben oder Tod — er hilft, daß eins zum andern findet.
Wär ich das Kind, das liebste mein,
Dann weint ich nicht, bewahre, nein!
Ich wäre lustig und vergnügt
Und jede Träne rasch versiegt,
Ich horcht auf Uhrenschlag und Wind.
(Ich sag das für das liebste Kind.)
Wohnt ich in dieser Schaukelwiege,
So wär ich brav, daß ich was kriege,
Brav und mild
Wie ein Bild,
Und leiser noch als Vöglein — fliege!
(Ich sag’s fürs Kindlein in der Wiege.)
Hört ich die Wölfe heulen im Ort,
Die Großen jagen sie schon fort!
Doch stolz wie ein Mann,
Der schnarcht was er kann,
Sagt ich: ich schlafe, ihr Herren, rasch fort!
(Ich sag das für die Wölfe im Ort.)
Nun hört man gar nichts mehr im Haus,
Das Spinnrad stummt, das Lied ist aus,
Die Mutter, selber voller List,
Tut so, als ob sie schlafen müßt,
Still sitzt sie über die Wiege geneigt,
Und rings nun alles ruht und schweigt.
Du liebes kleines Kissen, angefüllt
Mit zarten Federn, weiß und warm bist du;
Wenn Wind und Wolf und Ungewitter brüllt —
Bei dir ist Schlaf für mich und gute Ruh.
Viel viele Kinder, arm, verwaist und blaß,
Kein Dach, kein Kissen hütet ihren Schlaf,
Und sie sind immer müd; o bittres Los!
Ach, Mutter, welch ein Unglück sie doch traf!
Da bete ich für all die Kleinen, die
Kein Kissen haben, und ich küsse meins;
In meinem Nest zu deinen Füßen, sieh,
Segn’ ich dich, Mutter, und berühre deins.
Ich wache nicht, bevor der Morgen weht
Und fröhlich durch den blauen Vorhang lacht;
Jetzt sag ich leis mein innigstes Gebet,
Noch einen Kuß, Mama, und gute Nacht!
Gebet (als Abgesang)
Du Gott der Kinder, unter meinen Händen
Schlägt voll Gebet ein Mädchenherz; o hör!
Man spricht von Waisen, die kein Obdach fänden,
In Zukunft, Gott, mach keine Waisen mehr!
Laß abends einen Engel niederkommen,
Der Seufzer stillt und jedes Leid bewacht;
Und wem der Tod die Mutter fortgenommen,
Dem gib ein Kissen, das ihn schlafen macht.
Ein Abend war, der Herdschein hellte sacht
Das Haus, von Arbeit und von dir belebt.
Großvater hielt mich träumend auf den Knieen
(Mit uns zu wachen wird er nimmer müde).
Er sprach: begann von Trennung, von der Schule,
Von Arbeit, vom Erfolg, der sie erleichtert —
Und dankbar, daß ihn einst, so jung er war,
Die Mutter hingebracht... er sprach’s für mich...
Auch breitet’ er vor deine Blicke Bilder,
Wies neue, weite Horizonte auf,
Erzählte, wie, so klein er war, er doch
Die Mutter unterwegs gestützt, geführt,
Als diese einsichtsvolle Frau ihn trotz
So inniger Liebe von sich fortgeleitet.
Sein Blick war feucht, der mich von unten streifte.
O ja, das Kind will stets voran, das weite
Gebiet der Welt durchziehn und heiß betrachten;
Sein Sinn ist gleich dem Vogel ohne Rast,
Der überall dem Tag entgegenfliegt.
Nun wußte ich, daß mir ein Traum zerronnen,
Daß alles Abschied nimmt, daß jedes Glück
Versiegt — und meine Pflicht verwirrte mich.
Doch tat ich sie?... Mein Vater konnt es sehn!
Am andern Tag entführt ich eine Seele
Dem trauten Nest der Heimat, und vorbei
An unsrer Buchenhecke und den Tauben,
Die zusahn, wie wir gingen, wußt ich nicht
Die Türe hinter dir zu schließen; nein
Wie eine, dreimal willig umzukehren,
Im Glauben, irgend etwas sei vergessen —
So war ich dreimal zögernd, fortzugehn.
Der Wagenführer rief. Ich hört ihn ja,
Indes ich immer noch nach rückwärts sah!
Und du! Hell lachte deine Seele in die Welt
Und überall, wo unser Wagen hielt,
Du lieber Hüter meiner rauhen Pfade,
Stiegst du herab, mir zart die Hand zu reichen.
Man freute sich des so eilfertigen Pagen,
Des so ergebnen, liebevollen Kindes,
Und in mir sprach ein letzter Traum von Glück:
„Nie machst du ohne ihn den Weg zurück!“
Die wir auf Erden unsre Früchte tragen,
— Der Männer zarte Schwestern, aber stark
In Liebe — ach, wir Mütter, warum geben
Wir ihnen Leben, da man sie uns raubt?
Kaum sind sie unser, nimmt man sie uns wieder.
O Mütter, wißt ihr denn, was man sie lehrt?
Vor Herrenzorn erzittern und aus Pflicht
Im Jahr nur einmal bitten, uns zu sehn,
Und ihr Erinnern von uns abzuwenden.
Was aber wissen sie? Von fremden Sprachen,
Vom unterdrückten Aufstand armer Völker,
Auf die nur stets die Geißel niedersaust;
Und nur die Zeit wird sie das Rechte lehren.
Du Reinheit meines Kindes wirst vernichtet!
Und kehrt mein Sohn mir wieder, o, so ist
Er gar gelehrt und wird Lateinisch reden.
Mein armes Kind! Ich aber wage nicht
Wie früher deinen blonden Kopf zu kämmen.
Du wirst Lateinisch reden! Und du wirst
Mit mir kein lang Gespräch mehr führen können
Und wirst dir sagen, Mutter weiß ja nichts!
Geh doch! die Liebe selber weiß nicht mehr;
Sie leitet alles ohne Wort und Worte.
So viel, als meine Füße mich nur trugen,
Hab ich, um deine Tage zu bereichern,
Herbeigesucht, was deine Phantasie
Antreiben könnte; das ist unser Mühn
Und unsre Poesie. Auch goß ich manche
Recht ernste Lehre in dein weiches Herz,
Das meine sanften Lieder sonst gewiegt.
War’s nicht genug für dein so junges Alter?
Noch hast du nicht zehn Jahre, kleine Seele!
Und schade ist es und gefahrvoll auch,
Schon deiner Jugend all die fremden Schrecken
So vieler Heimlichkeiten aufzudecken...
Du Tag, der jedem Pilger Seligkeit verkündet,
Der jedem Leidensweg ein Morgenrot entzündet,
Du schöner Tag der Kinder, die mit grünen Zweigen
Die Straßen auf und ab sich sehr geschäftig zeigen
Und unterwegs den duftigen Reichtum gerne mehren,
Um Armevoll von frischem Glück nach Haus zu kehren...
An jenem Tage sucht auch ich den jungen Ast,
Als Halt für meines Schicksals wintermüde Last.
Ich ging, ich schritt voran, auf trauervollen Wegen
Durch Sonne bald und bald durch grauen Regen,
Von Kerzenglanz verlockt, der unsre Andacht weiht
Und unserm Gottesdienst so holde Anmut leiht.
Die Chöre waren voll von hellem Kindersingen,
Das durch die Kirche zog auf unschuldsfrohen Schwingen;
Und Gott allein vernahm durch diesen lauten Sang
Ein Beten und ein Lied, das weinend aufwärts rang:
„Von einer Verbannung zur anderen ruhlos vertrieben,
Wahrhaftig, ich weiß keine Heimat, die je mir geblieben!
Die Bäume zumindest, sie haben doch Zeit, um zu blühn,
Um Früchte zu tragen, zu wachsen, zu Tode zu glühn,
Mir, mir ward nicht Zeit! Meine Pflicht will nicht warten und weilen,
Gott! Zwing mich nicht immer, aus Frieden in Fremde zu eilen;
Gott! Gönn mir im Schatten am Wegrand ein wenig Bestand,
Meine Kinder im Arm, meine Stirne gestützt in die Hand!
Ich kann nicht mehr gehn. Ich komme... ich sah... und ich falle,
Ich holte dort droben vom Berg eine Blume; ich walle
An rosenkranztragenden Gräbern vorbei wie gehetzt,
Die Füße vom steinigen Bergpfad erlahmt und verletzt.
Gott! bin ich der Vogel mit ewig gebreiteten Schwingen,
So laß mich noch einmal das Haupt meines Sohnes umschlingen;
Des blondfrohen Knaben, der ohne mich wandert und strebt,
Die ich sein Gemüt doch mit Seele und Sehnsucht durchwebt!
Du Gott der Bedrückten, — Gott! bist du wirklich mein Vater,
So sei du den Meinen ein Retter, sei mir ein Berater,
Laß nicht meine Sorgen die Boten des Kommenden sein,
Nein, zeig uns den Hafen und führ uns in Frieden hinein;
In Nacht, in verfrühte, laß endlich ein Morgenrot dringen,
Verbiete den Wegen, mich weiter und weiter zu zwingen,
Bezeichne für uns einen Ort, eine Heimat, die Ruh,
Und führe den knieenden Kindern den Vater zu!“ —
Die Orgel schwieg; der Glanz erlosch, mein heißes Sinnen
Ward still, um tief im Herzen heimlich fortzuspinnen;
Im Herzen, das nun doch die neue Hoffnung trank,
Die aus dem Lied der vielen in mich niedersank.
Ein Greis beglückte mich mit einem schlanken Zweige,
Weihwasser tropfte durch das Grün in meinen Händen,
Und froh betrat ich meine winterkalten Steige,
Mit festem Schritt den Erdenweg zu enden...
Vergib mir, Herr, mein trauerndes Gesicht,
Dem du zuvor die Anmut eingeschrieben;
Du gabst die heitre Stirn, doch gabst du auch
Die Tränen — sie allein sind mir geblieben.
Man neidet sie mir nicht, und doch sind sie
Vielleicht das beste Teil; mein junges Wähnen
Und meine Blumen, Herr, gab ich zurück.
Es blieb mir nichts, als nur das Salz der Tränen.
Die Blumen sind dem Kind, der Frau das Salz;
O mach daraus der Unschuld klare Fluten!
Und hat das Salz die Seele rein geklärt,
So gib dem Herzen neue Andachtsgluten.
All mein Verwundern hab ich schon durchlebt,
Mein Abschied ist getan, mein Herz bereitet,
Den Früchten nachzugehn, die Tod mir stahl,
Und dreist in unbekannte Nacht geleitet.
O Heiland! sei den andern Müttern gut!
Erbarme dich, aus Liebe zu der Deinen.
O taufe ihre Kinder in der Flut
Von unsern bittren Tränen, und die meinen,
Die stumm und starr zu deinen Füßen liegen —
Erhebe sie und laß sie heimwärts fliegen!
Ich bin das Gebet, das die Breiten
Der Erde besitzlos durchflieht,
Bin die Taube, die hoch in den Weiten
Zur Stätte der Liebe zieht.
Ich durchflog und durchspähte vergebens
An beiden Flanken der Welt,
Die fruchtbaren Wege des Lebens,
Das Gottes Atem erhält.
Der Atem weht meines Sanges
Vielklagende Inbrunst an,
Daß er hell und begeisternden Klanges
Die Armen erheben kann.
Dann preise ich deine Wonnen,
Erinnerung, ewige du,
Und kreise von Sonne zu Sonnen,
Unendlicher Zukunft zu.
Ich suche, die Schwingen zu baden,
Die Wasser der Wildnis auf,
Denn ich weiß, zu andern Gestaden
Steigt endlich ein jeder hinauf,
Die Völker, die drunten auf Erden
Der Hunger verstört und zerbricht,
Wie gefallene Engel werden
Sie heimberufen ins Licht.
Nehmt mich mit; ich bin Mutter, ich habe
Eine einzige Bitte zu tun,
Um die köstlichen Früchte im Grabe,
Um die Kleinen, die drunten ruhn.
Du Herr über Weinen und Wähnen,
Du Schöpfer von Leben und Glück,
Ich gebe dir all meine Tränen,
Gib mir meine Kinder zurück!
Ich gehe und trage hinauf in des Vaters Garten,
Wo jede zertretene Blume lebendig loht,
Meinen entblätterten Kranz; ich will knieen und warten:
Mein Vater hat viele geheime Arznei für den Tod.
Ich gehe und sage — und sei’s nur mit schweigenden Tränen:
„Ich habe gelitten, sieh her!“ Und da sieht er mich an:
Wie hohl auch die Wangen und bläulichen Schläfen gähnen,
Mein Vater schaut lange, und liebend erkennt er mich dann.
„Bist du es, verzweifelte Seele?“ erhebt mich sein Fragen.
„So war deinen irrenden Füßen die Erde zu klein?
Blick auf, ich bin Gott! Wirf ab deinen Gram und dein Klagen,
Hier wartet dein Haus, hier wartet mein Herz — tritt ein!“
O Gnade! O Vater! O heilige Zufluchtsstätte!
Dein weinendes Kind — du hast es in Güte erhört!
Ach, wenn ich auf Erden die himmlische Hoffnung nicht hätte,
Daß du mich errettest, wie wär’ ich vergrämt und verstört.
Du verwirfst nicht die Blume, nur weil ihre Schönheit vergangen,
Diese irdische Schuld — der Himmel sieht sie nicht an;
War treulos dein Kind, es wird dennoch Verzeihung empfangen,
Wenngleich es alles verschenkt und gar nichts gewann.
DRITTER TEIL
AUTOBIOGRAPHISCHE FRAGMENTE
Marceline Desbordes-Valmore hat wenig Autobiographisches hinterlassen (außer ihren Gedichten und Briefen, die ja nichts sind als ein einziger leidenschaftlicher Selbstverrat ihres Lebens und Gefühls). Nie hat sie, die Bescheidene, ihr Dasein, ihr Werk für wichtig genug befunden, um es dokumentarisch zu erörtern oder festzulegen. Die folgenden biographischen Selbstdarstellungen sind darum nur Fragmente, aus Briefen und Werken beinahe zufällig gewählt: ihr ganzes tragisches Leben zu schildern, hat die Dichterin nur in Versen den Mut gefunden.
Ich bin in Douai zur Welt gekommen, der Heimatstadt meines Vaters, am 20. Juni 1786. Ich war sein jüngstes Kind und das einzige, das blond war. Man begrüßte mich mit Begeisterung, entzückt über mein helles Haar, das man an meiner Mutter so bewunderte. Sie war schön wie eine Heilige, man hoffte, ich würde ihr völlig gleichen; aber ich habe ihr nur wenig ähnlich gesehen, und wenn man mich lieb hatte, so war es um anderer Eigenschaften als der Schönheit willen.
Mein Vater war Wappenmaler für Equipagen und Chorstühle. Sein Haus lag neben dem Kirchhof der kleinen Pfarrgemeinde Notre-Dame in Douai. Ich hielt es für groß, dieses liebe Haus, das ich mit sieben Jahren verlassen hatte. Seitdem habe ich es wiedergesehen, es ist eines der ärmsten in der Stadt. Und dennoch liebe ich dieses Wahrzeichen einer schönen, vielbeweinten Zeit über alles in der Welt. Ich habe nur dort den Frieden und das Glück gekannt, aber auch ein großes, abgrundtiefes Leid, als mein Vater keine Wappen mehr zu malen hatte.
Ich war vier Jahre alt, als der große Umsturz in Frankreich erfolgte (die Revolution von 1789). Zwei Großonkel meines Vaters, die bei der Aufhebung des Edikts von Nantes nach Holland geflüchtet waren, boten meiner Familie ihr ungeheures Erbe an, sofern man uns Kinder zum protestantischen Glauben übertreten ließe. Diese beiden Onkel waren hundertjährige Greise. Sie lebten als Junggesellen in Amsterdam, wo sie einen Buchverlag gegründet hatten. Sie haben auch von mir Bücher gedruckt.
Man hielt einen Familienrat. Meine Mutter weinte sehr. Mein Vater war unschlüssig und drückte uns ans Herz. Schließlich lehnte man das Anerbieten ab, um nicht unsere Seelen zu verkaufen, und wir verblieben in einer Not, die von Monat zu Monat grausamer wurde und zu solcher inneren Zerrissenheit führte, daß ich seitdem für alle Zeit schwermütig geblieben bin.
Meine Mutter, voll Mut und Unbedacht, ließ sich von der Hoffnung hinreißen, ihrer Familie das Dasein zu erleichtern, indem sie sich zu einer in Amerika lebenden und reich gewordenen Verwandten aufmachte. Von den vier Kindern, die vor dieser Reise zitterten, nahm sie nur mich mit. Ich tat es gern; aber als ich das Opfer gebracht, hatte ich für immer meinen Frohsinn verloren. Ich verehrte meinen Vater, als wäre er der liebe Gott selber. Die Städte, die Straßen und Hafenplätze, wo er nicht zu finden war, flößten mir Entsetzen ein; ich hing mich an das Kleid meiner Mutter, als wäre dort mein einziger Schutz.
Als wir in Amerika, in Guadeloupe, ankamen, war die Cousine inzwischen verwitwet und durch die Neger von ihrer Besitzung vertrieben; die Kolonie stand in hellem Aufruhr, und das gelbe Fieber herrschte überall. Die Mutter konnte den Schlag nicht ertragen. Sie starb — mit einundvierzig Jahren! Ich selbst an ihrer Seite war dem Tode nahe. Man führte mich fort, fort von dieser durch den Tod fast entvölkerten Insel, und von Schiff zu Schiff wurde ich meinen nun völlig verarmten Verwandten in Frankreich wieder zugeführt.
Damals war das Theater für sie und für mich eine Art Hilfsquelle geworden. Man lehrte mich singen. — Ich versuchte, die Muntere zu spielen, aber ich war besser in schwermütigen und leidenschaftlichen Rollen. Das entspricht auch besser meinem Schicksal. Ich lebte oft allein, weil es mir so gefiel. Man berief mich ans Theater Feydeau. Alles deutete auf eine glänzende Zukunft; mit sechzehn Jahren war ich Sozietärin, ohne es verlangt oder erhofft zu haben. Aber mein bescheidener Anteil beschränkte sich damals auf achtzig Franken im Monat, und ich kämpfte mit einer unsäglichen Armut.
Ich mußte meine Zukunftsaussichten der momentanen Not opfern und kehrte, im Interesse meines Vaters, in die Provinz zurück.
Mit zwanzig Jahren mußte ich dem Gesang entsagen, weil ich Schmerzen dabei hatte und weinen mußte — aber mein kranker Kopf war stets voll Melodieen, und ein immer gleicher Rhythmus gab, mir unbewußt, meinen Gedanken Form.
Ich mußte sie niederschreiben, um den fiebernden Klängen zu entgehen, und man sagte mir, es sei eine Elegie.
Herr Alibert, der meine sehr angegriffene Gesundheit zu heilen suchte, riet mir, da kein anderes Mittel helfen wollte, damit fortzufahren. Das versuchte ich, ohne je etwas gelesen oder gelernt zu haben, so daß es mir qualvolle Mühe schuf, meine Gedanken in Worte zu kleiden. Dies ist gewiß der Grund der Unklarheiten, die man mir zum Vorwurf macht, die ich jedoch selbst nicht beheben konnte. Ich änderte, ohne bessern zu können, und ich hatte nie die Kraft, mich mit diesen Aufzeichnungen von Dingen, die ich vergessen wollte, lange zu beschäftigen, — ich hatte so viel anderes zu tragen! Ich bin, wie jedermann, zum Leiden auf der Welt — und man sollte eher richtig denken, als richtig sprechen lernen. Wenn ich gut sprechen höre, fühle ich mich hingerissen, ohne mehr dabei zu empfinden als eine köstliche Träumerei. Zur Selbsterkenntnis aber hilft es mir gar nichts.
Ich stand an der Tür des Elternhauses; es war nicht mehr Tag und noch nicht Nacht. Ich erblickte ihn durch den zarten Schleier, der zur Abendstunde in den Straßen schwebt. Seine Schritte eilten, wie ein Engelshaupt blickte sein Kopf mit den blonden Locken nach unserm Hause. Er kam aus dem Friedhof hinter unserm alten Wall; er kam herbei. Wir sahen uns ernsthaft an, wir sprachen leise und wenig. Guten Abend, sagte er, und ich empfing aus seinen Händen, die er mir hinstreckte, eine Anzahl großer Blätter; er hatte sie von den Bäumen auf dem Wall geholt, um sie mir zu bringen. Ich nahm sie mit Freuden; ich betrachtete sie lange, und ich weiß nicht, welche Verwirrung meine Blicke schließlich zu Boden zog. Sie blieben auf seinen nackten Füßen haften, und der Gedanke, daß er sich an der Baumrinde verletzt hatte, machte mich traurig. Er erriet es, denn er sagte: „Es ist nichts!“ Wieder blickten wir uns an, und plötzlich grüßte ihn mein Herz: ich sagte mit schwacher Stimme, die nicht beben sollte: „Leb wohl, Henry!“ Er war zehn Jahre alt, ich sieben.
Großer Gott! Welch einen Reiz behalten doch solche kindliche Freundschaften! Sein Bild ist meinem Gedächtnis mit derselben Frische eingegraben, die jene grünen Blätter ausströmten, als Henry sie in meine Hände legte.
Was ist aus Henry geworden? Von welchen Augen mag er das eingefordert haben, was er in meinen erstaunten und vertrauenden Blicken sah? Ich erinnere mich nicht, ob er schön war. Seine Züge, sein Mund sind mir entschwunden; nur seine Augen sprechen noch zu mir. In ihnen spiegelte sich unbewußt seine Seele. Die kurzen Worte, die er mit leiser Stimme hinwarf, — mein Ohr kennt noch ihren Tonfall, und jetzt weiß ich, daß sie mich ergriffen. Damals war mir das nicht bewußt. Ich stand nur und wartete auf Henry, ohne mich von der Stelle zu rühren, ohne den Kopf von jener Richtung abzuwenden, aus der er auftauchen mußte... und er kam. Er kam immer, ohne mir je gesagt zu haben, daß ich ihn erwarten sollte. Das Glück segne ihn dafür!
Das gelbe Fieber, das bei Pointe-à-Pitre seine Verheerungen fortsetzte, fand nichts, was es mir noch nehmen könnte. Ich war allein und wollte mich auf einem Fahrzeug einschiffen, das, ehe es nach Frankreich segelte, zur Vervollständigung seiner Ladung in Basse-Terre vor Anker gehen sollte.
Es war Nacht, solch eine helle Nacht, die eine Gegend völlig verwandelt und aus einer Stadt eine ganz neue andere Stadt zu schaffen weiß. Der Anblick dieser hier war mir so unerträglich, daß ich, in dem Hause, welches mich nach dem Aufruhr und dem Tode meiner Mutter aufgenommen hatte, mich in einem dunklen kleinen Hinterzimmer verkroch. Ich wartete darauf, die alte Uhr an der Wand, die geräuschvoll die Sekunden tickte, die Stunde der Abreise schlagen zu hören. Da kam der Gouverneur und machte mir, zugleich im Namen seiner Frau, das Angebot, mich in seiner Familie aufzunehmen, damit ich zur Rückkehr nach Frankreich eine günstigere und ungefährlichere Gelegenheit abwarten könne.
Er benachrichtigte die Witwe, daß ich mich den Gefahren dieses Schiffes nicht aussetzen möge, das in der Tat recht gebrechlich und kaum mehr war, als ein großes, überdecktes Boot. Seine Ladung für Europa bestand aus Stockfisch und Walfischtran, und an Proviant führte es nur einige Stücke Pökelfleisch und Schiffszwieback mit sich, den man mit dem Hammer zerschlagen mußte. Das Feuer im Kompaßhäuschen und in den Schloten war das einzige, was diese so lange Reise für uns erhellen sollte.
„Sie wird sterben,“ sagte der Gouverneur zu der jungen Witwe, die bereits Tränen vergoß, — „ich sage Ihnen, Madame, sie wird sterben!“
Alle ihre Worte klangen durch die Bretterwand zu mir herüber, keins aber änderte meinen Entschluß, abzureisen. Man kam und holte mich; ich sollte selber Antwort geben. Ich weinte, aber nichts erschien mir so grauenhaft, als hier zurückbleiben zu müssen; so lehnte ich das Anerbieten ab. Ich glaube, ehe ich mich dazu entschlossen, hätte ich lieber dasselbe getan, was ein kleiner Negerjunge vom Hause versuchte, der mir bei der Abfahrt nachschwamm: ich wäre ins Meer gesprungen, im Glauben, in meinen Armen Kraft genug zu besitzen, um bis nach Frankreich zu schwimmen.
Das Entsetzen vertrieb mich von dieser bewegten Insel. Vor wenigen Tagen hatte mich ein Erdbeben, während ich vor dem Spiegel stand und meine Zöpfe flocht, aufs Bett niedergeworfen. Ich halte Angst vor den Mauern, hatte Angst vor dem Rascheln des Laubes, dem Wehen der Luft. Die Vögel schienen mich zur Reise aufzurufen. Hier, inmitten eines ganzen Volkes, das nur den Tod oder die Trauer um Tote kannte, erschienen mir nur die Vögel lebendig, weil sie Schwingen besaßen. Der Gouverneur konnte keinen andern Dank von mir erlangen, als liebenswürdige Worte und einen Abschiedsgruß. Ich sehe noch immer sein bekümmertes Gesicht vor mir, als er ging, mich meinem Schicksal überlassend, das ihm verhängnisvoll zu sein schien. Es war das erstemal, daß ich selbst über mein Los entschied, und ich legte es allein in Gottes Hände, da ich keinen andern Herrn und Führer mehr besaß.
Um Mitternacht fuhr ich ab, und als die Trennungsstunde schlug, schickte die Witwe, die mich mit ihren Leuten begleitet hatte, die Dienerschaft nach Hause zurück und entschloß sich, mir auch für die Überfahrt von fünfunddreißig Meilen, die von der einen zur andern Insel zurückzulegen sind, das Geleit zu geben. Als die Matrosen mich ins Boot trugen, das uns zu dem auf der Reede liegenden Schiff hinführen sollte, hatte ich mir die Augen mit der Hand bedeckt, um die Tränen der herzlich guten Frau nicht sehen zu müssen. Zu meiner großen Überraschung fand ich sie dann neben mir im Boot; ruhig und zufrieden saß sie da, wie nach einem edlen, siegreich bestandenen Kampf.
Sie brachte mich bis nach Basse-Terre, wo sie Bekannte hatte; sie nährte noch immer die Hoffnung, mir eine angenehmere Überfahrt nach Europa beschaffen zu können. Wir mußten Tage lang warten, ehe wir in See gehen konnten, und während all der Zeit nahm sie mich innig in Schutz; wir betrachteten das Schauspiel, das uns auf allen Seiten umgab, und sprachen nichts mehr.
Auf der einen Seite breitete das uferlose Wasser seine ungeheure Fläche, schwarz und glänzend unter einem Mond, der sich in jeder irrenden Woge vervielfältigte. Vor uns entfaltete der Hafen seine stille Belebtheit, die nur am Tanz der Lichter von Schiff zu Schiff erkennbar war, und rückwärtsschreitend verließ ich ihn, um ihn lange vor Augen zu behalten, und er erschien mir ganz anders, als an jenem stürmischen Tag meiner Ankunft hier.
Mitten aus diesen Dingen, deren Bild mir unauslöschlich eingegraben ist, sah ich — mein Gott, ich hatte es mir oft geträumt! — sah ich meine Mutter mit ausgebreiteten Armen zu mir ans Land eilen... Ich weiß keine Erinnerung, die trauriger wäre. Was bedeutet alles Folgende und wie ich heimgelangte, mein Los in Frankreich zu erfüllen, das mir alles, doch dem ich nichts war. Du Liebe zum Lande unserer Wiege, sei gesegnet, du süßes und trauriges Mysterium — gleich jeder anderen Liebe!...
Meine erste Sorge bei der Ankunft in Mailand war, zur Post zu eilen. Die Sonne, der Staub hatten uns durstig gemacht nach einem Brief von meinem Sohn und von Dir, und ich habe noch immer nichts vorgefunden, trotz der sechs Tage Reise-Verzögerung in Lyon und Turin. Ich werde Dir erst in einigen Tagen von jener Stadt berichten. Ein trauriges Herz verfinstert jede Schönheit. Ich wage augenblicklich nicht zu sagen, welchen Eindruck sie mir gemacht hat, sondern will es aufschieben, bis ich Eure ersten Nachrichten erhalten habe. Der Bericht würde heute ganz anders ausfallen.
Nach der langen Fahrt auf völlig schattenloser Straße in glühender Hitze waren wir von der Sonne verbrannt und glichen jeder einem lebendigen Staubhaufen. — Die Direktoren erwarteten uns freundlicherweise am Posthof und luden uns ein, andere Wagen zu besteigen, die uns mit solcher Schnelligkeit mitten durch die Stadt führten, daß es mir war, als würde ich von einem Traum gefächelt.
Alle Straßen sind mit blauen Quadern eingefaßt, die nur für Fußgänger bestimmt sind, so daß man beim Spazierengehen die Häuserwände streift. Die Straßenmitte gehört den Wagen, deren Eleganz bemerkenswert ist. Viele haben vier Pferde, Wagenzier und reiches Zaumzeug. Die Damen sitzen zur Schau wie in den Logen, sehr würdevoll und mit viel Geschmack gekleidet. Vor allem wissen sie sich mit ihrem meist schönen Haar wundervoll zu schmücken: sie lassen es von der Schläfe bis zur Brust in langen Ringeln niederfallen, denen sie, trotz der ungewöhnlichen Hitze, der sie sich aussetzen, Haltbarkeit zu verleihen wissen. Ich habe viele entzückende Frauen gesehen... Ihr Blick ist auf der Promenade kalt und hochmütig, ihre Haltung aufrecht, frei und würdig.
Die Bevölkerung scheint in zwei Gattungen zu zerfallen, die voneinander sehr verschieden sind: die eine gesund, hochgewachsen, vollkommen; die andere verkrüppelt, elend, schleppend. Vor den Türen, auf den Wegen, in den Kirchen — überall mißgestaltete Zwerge, mit Kröpfen behaftet oder verkrüppelten Gliedern, die sie auf Krücken stützen. Es ist für alle, die nicht durch die Gewohnheit abgestumpft sind, ein trauriger Anblick. Unter der ärmeren Klasse sind nur wenige Familien von der Heimsuchung verschont. Zum Glück knüpft sich daran ein frommer Aberglaube; man hütet diese Unglücklichen als den guten Genius der Familie, der die bescheidene Gestalt angenommen hat, um das Haus vor allem Unheil zu bewahren.
... Unser Hausherr führte uns eines Abends zur Kirche San Ambrosio, die so hochberühmt ist, daß wir sehr danach verlangten, sie zu sehen.
... Ich glaubte, wie damals von Santa Maria, gleich beim ersten Anblick ergriffen und geblendet zu werden von dem leichten, aufstrebenden Schwung des Bauwerks — das ist aber nicht so. Alles ist streng und düster; man glaubt in die frühen Mysterien des Christentums einzutreten. Das Kloster, das die Kirche umgibt, die nackten Mauern, die Höfe, in denen das Unkraut wuchert, die kaum noch erkennbaren Freskomalereien, die gotischen massiven Tore — alles zeugt von den Kämpfen, denen die Religion in ihren Anfängen ausgesetzt war. Ich glaubte mich unter der Erde zu befinden, gleichsam erdrückt von den vierzehn Jahrhunderten, die diese Kirche bedrängt haben, die sich dennoch unerschütterlich zu halten weiß. Man berichtet, daß eine eherne Schlange, hoch oben auf einer Marmorsäule, sich aufgerichtet und die Geburt des heiligen Ambrosius verkündet habe. — Zwei eiserne Portale bieten alles, was Menschenarbeit Wundersames leisten kann: Kunst, Ausdauer, glühende Gottesverehrung sprechen aus jeder, mit unbeschreiblicher Feinheit ziselierten Gruppe. Man ist ein Nichts vor solchen Dingen. Ihre Besitzer kennen ihren Wert so gut, daß sie diese Wunder der Kunst hinter doppelten Gittern und zweimal verschlossenen Türen verwahren. Eins der Schlösser ist ein Löwenkopf, und der Schlüssel wird in sein Maul gesteckt...
Alles, was ich an Musik in Mailand höre: abends im Theater, in den Schulen, den Kirchen, bis hinauf zum Klang der Glocken, ist weit entfernt von Träumerei und sanftem Leid: alles hat den Charakter eines a cantate, einer Bravour-Arie, und es ist kein leichtsinniges Urteil, das ich da ausspreche. Die Stimmen der Leute, so ansprechend in Béarn, so feierlich in Deutschland, sind hier fast ebenso roh und kreischend wie in Lyon; das Land der Falschsinger und Schreier — bis auf einige schöne Ausnahmen. Wenn ich Dich hier hätte, so würde ich Dich vor allem in den Dom führen und rund um die Stadtmauern, von wo man allerorten diesen Dom wie eine köstliche Vision erblickt...
Ich beginne stündlich ein paar Aufzeichnungen für Dich, und ich werde durch tausend kleine Pflichten, die mich nicht aufatmen lassen, daran gehindert. In Paris war es die Hausglocke, die mich jeden Augenblick aufscheuchte, um die oft so öden, so anstrengenden Besuche über mich ergehen zu lassen, denen ich mich nicht entziehen konnte, weil mein Dienstmädchen ein zartes Gewissen hatte und ihr Seelenheil nicht mit der Lüge, ich sei nicht zu Hause, aufs Spiel setzen wollte. Hier bin ich davor geborgen, keine Seele sucht mich. Das Läuten der Glocken, das Krähen der Hähne, die Schüsse in den Trauerspielen des Theaters — aus dessen Wandelgängen man in dasselbe Gärtchen hinuntersieht, das unten vor meinem einzigen Fenster liegt —, das ist die ganze Begleitung zu dem immer eiligen Takt meines Herzens, das stets voll Liebe für Dich ist; aber ich muß mich oft bescheiden, an Dich zu denken, ohne zum Schreiben Zeit finden zu können. Wir haben keine Hilfe im Haushalt, und meine Tage erschöpfen sich in dieser Tätigkeit, die mir in ihrer vollen Schwere nicht leicht wird, denn die Hitze ist ungeheuer und der Mangel an Küchengeräten groß. Oft, wenn ich durch die Straßen irre, auf dem Wege zur Post oder sonstwohin, verweilt meine Vorstellung bei der seltsamen Lage, in der ich mich mit meiner Familie befinde. Da vor allem mache ich von der traurigen Freiheit Gebrauch, herumzulaufen, zu reden, zu weinen, während ich durch verlassene Gassen eile, vorbei an fremden Häusern bis zu einer gastlichen Kirche, in die ich mich flüchte, als suchte ich durch eine Hintertür im Hause meines Vaters Zuflucht. Hier bin ich gewiß, daß man mich hört. Ich werfe mich auf die Kniee, schlage das Kreuz und verweile kummervoll auf diesen Marmorfliesen, von denen niemand mich vertreiben darf — das ist eine große Gnade, die ich mit Dir teile, denn Dein Herz ist in mir. —
Würdest Du die Kirche San Popolo sehen, Du würdest sie nie vergessen. Da ist eine Darstellung der Szene, wie Jesus den Aposteln die Füße wäscht, halbkreisförmig im Hintergrund eines Altars; dieser Hintergrund wirkt wie ein wirkliches Zimmer, worin die zwölf in Holz geschnittenen Gestalten in Lebensgröße einen so packenden Eindruck machen, daß man zu sehen meint, wie sie sich bewegen. Die gegenüberliegende Kapelle zeigt Jesus vor den Richtern. Ich begreife die Macht solcher Darstellungen, aus denen die wahre Kunst uns grüßt. Ist nicht eine meiner unauslöschlichsten Erinnerungen die an den gegeißelten Heiland, der hinter der verlassenen Kirche, in der ich sechs Jahre früher die Taufe empfangen hatte, im Grase lag? Und dann im Hofe eines Franziskanerklosters, wo wir Verstecken spielten, eine Mutter Gottes mit den sieben Schmerzen, eine Holzfigur, die hinter einem Gitter stand und mir so voll Leid erschien, daß ich ganze Stunden dort in Betrachtung verbrachte und in mir ihren Schmerz nachzufühlen vermeinte...
Drei Priester singen und tragen drei brennende Kerzen durch den Tag. Ein Priester eröffnet den Zug mit einem goldenen Kruzifix. Ein Mann folgt, mit einer kleinen lackierten Kiste auf dem Rücken; sie ist von grüner Farbe, und ihre Form ist nicht so bedrückend wie jene, die wir in Frankreich unsern Särgen geben. Das war der Leichenzug eines armen Kindes aus dem Volke, dem wir durch die Straße folgten, dem „Borgo di Porta Romana“. Das Volk drängte sich in den Straßen, sang, schrie und rannte durch Staub und Sonne, und die Menge, die Platz machte, um den Priester vorüber zu lassen, hatte kein Auge für den armen kleinen Sarg.
Am andern Tag zog an der nämlichen Stelle eine lange Reihe von Priestern mit Fackeln vorüber, die mit trauriger Ohnmacht gegen die Strahlen der vollen Sonne ankämpften. Frauen, Männer, Kinder, mit brennenden Totenkerzen in den Händen, überfluteten singend die Straße. Inmitten dieses Geleites und unter einem weißen Schleier, dessen Enden von acht kleinen Klagemädchen getragen wurden, schwebte ein leichter Sarg dahin, bedeckt von weißem silberbestickten Atlas und wundervollen Blumenkränzen. Die jungen Mädchen, die Trägerinnen dieser Last, lächelten und lachten; sie waren festlich gekleidet und trugen strahlend weiße, mit Perlen und Bändern verzierte Schleier. Diesmal war es eine reiche Mutter, die weinte. Wir beteten auch für dieses Leid, das für jedes Mutterherz gleichermaßen schmerzlich ist.
Gestern, am 22. August, hat uns Valmore spazieren geführt, und wie stets, begannen wir den Weg mit einer Kirche, diesmal der Passionskirche...
Was in diesem düsteren und geheimnisvollen Bau am meisten fesselt, das ist ein doppelter Sarkophag aus weißem Marmor, auf ungeheuren Löwenfüßen ruhend, der sich unter der dunklen Kuppel vor der Sakristei erhebt. Die ganze Struktur dieser beiden Zwillingssärge, die sich übereinander erheben, ruft den Geist zur Sammlung und schmerzlichen Bewunderung. Wir konnten uns nicht losreißen... Während die Arbeiter auf den Gesimsen und den Sockeln der hohen Statuen standen und die schwarzen, mit gelben Tressen umsäumten Draperieen herunternahmen, die auf den Hallenboden niederrauschten, ließen die Schüler der musikalischen Lehranstalt, die hier gewissermaßen der Kirche zugeteilt scheint, ihren herrlichen Gesang ertönen, andere wieder spielten Geige oder Piano, und die Sonne ließ im Untergehen alle Engel der Hauptfront rosig erstrahlen, und die erzenen Gestalten, deren jede ein Werkzeug des Leidens Christi in Händen hielt, schienen sich schön und traumvoll hinwegschwingen zu wollen, fort von den Qualen Jesu Christi und seiner Mutter, die sie weinend umstanden. Es erfüllt mit beständiger Pein, daß man diese Szene für jene, die sie nicht mit Augen sehen können, mit dem Stift nicht festhalten kann. Und daß man anderseits keine Worte findet, um ihren Eindruck auf uns wiederzugeben, ist ein anderer großer Schmerz, der allzuspät ein trübes Licht wirft auf die Unwissenheit, derer man sich nie so sehr bewußt geworden war wie in diesem Augenblick...
Das Glockenläuten ist hier unerträglich. Es zerreißt die Luft und ist so schrill wie die Stimmen der Frauen in Italien. Wenn sie sich unterhalten, meint man, sie seien zornwütend; ihre Stimme springt mit unglaublicher Leichtigkeit von den höchsten Tönen zum dröhnenden Kontra-Alt hinab, so daß man gar nicht fassen kann, die wegen ihrer Reize und ihres Adels berühmteste aller Sprachen zu vernehmen, es sei denn, daß man sie liest oder singen hört; gesprochen aber ist es, um davonzulaufen. War das der Grund, weshalb die sanfte und reine Stimme, der fließende Vortrag und die gefühlvolle Tongebung von Mademoiselle Mars, ihr perlendes Lachen, ihr ergreifendes Weinen hier ein Erstaunen und eine Begeisterung geweckt haben, die unbeschreiblich ist?...
31. August. Wir haben etwas unendlich Trauriges gesehen — mir wenigstens erschien es so. Wir haben Maria-Louise gesehen, über ihre Jahre hinaus gealtert, trotz ihrer reichen Kleidung und ihrer Jasminhaube — die rätselhafte Maria-Louise, deren Herz undurchdringlich bleibt, deren verschlossenes Antlitz keine Bewegung verrät. Ich aber war ergriffen, als ich in dem schmalen Gang, der ihre und unsere Loge verband, notgedrungen ganz nah an ihr vorüber mußte, so daß ihr Kleid mich streifte. Ich gestehe es, zum erstenmal im Leben suchte ich einem Menschen ins Gesicht zu sehen, der in einer recht bescheidenen und dunklen Loge verborgen sein wollte. Aber der Fürst Metternich — und vor allem seine weiß und goldene Uniform hatten sie verraten. Mademoiselle Mars, der ich eilends mitteilte, daß der Arm, den sie soeben berührte, der Maria-Louisens sei, tat alles, was man nur tun kann, ohne den Anstand zu verletzen, um diese reglose Frau zu veranlassen, sich umzuschauen. Sie kam nicht zum Ziel. Als ich sah, daß sie sich erhob und fortging, fand ich mich wie unwillkürlich neben ihr. Sie schritt vorgebeugt, als suche sie die schlecht erhellten Treppenstufen zu erkennen. Ihr sehr leichtes und sehr weites weißes Gewand berührte mich. Ihr Antlitz erschien mir auffällig schmal und gerötet, doch sanft und ruhig. In diesem ergreifenden Moment hatte ich fast eine Vision, ich sah den Kaiser tot und den König von Rom, gleichfalls wie einen Schatten, die in diesem frostigen Korridor hinter ihr herschritten, und es wurde mir schwer, das Ende von „Jeanne de Naples“ abzuwarten, dessen schrecklichen Schluß sie wahrscheinlich nicht hatte mitansehen wollen...
19. September. Ich denke und schreibe an Dich beim dumpfen Lärm des Rades, das drunten im Hofe gedreht wird, um Sorbett zu bereiten; dies ständig brausende Geräusch macht meine Gedanken, wie mir scheint, zu summenden Fliegen, die sich nicht aufschwingen können. Meine Gedanken kriechen am Boden und summen und beschweren mir das Herz. Drüben in der italienischen Schule singen die Kinder mit absichtlich kreischender Stimme ihre Choräle. Auf den umliegenden Dächern, in gleicher Höhe mit unserem Fenster, klatscht der Regen in Strömen, und das Zimmer ist so feucht, daß die untapezierten Wände Tränen weinen. — Italien! Sage mir, lehre mich, was dein schöner Himmel den Elenden bietet, wenn Wolken ihn verhüllen! Und es gibt viele Elende um uns her, viel Unglück außer unserm Unglück. — Mailand, immer noch Mailand! Ist es nicht in Italien, wo Tasso den Verstand verloren hat?... Diese anscheinend so öde Stadt birgt in einem Hospiz zweitausend Kranke und Sieche.
... In letzter Nacht ward mein Schlummer von einer Vision gewiegt und erschüttert: Ich durcheilte ein einsames riesiges Haus, dessen Türen alle weit offen standen. Der Engel des Todes verfolgte mich, er kam durch die unbewohnten Gemächer, und ich vernahm das Rauschen seiner Schwingen in der Luft, durch die ich selber hinglitt, ohne den Boden zu berühren; ich litt, ich betete, ich war atemlos und fast von ihm ereilt. Das offene Fenster bot mir den einzigen Ausweg, den ich mit den Augen suchte und mit einem Herzen, das meine Brust zu sprengen drohte: ich reckte die Arme, ich gab mich der Luft ganz hin, ich schwebte, zu meiner großen Freude, zu meiner so unendlichen Freude, daß ich erwachte und mich knieend in meinem Bette fand, in einer Finsternis, die der Mond tröstlich erhellte. Es war, als sähe er mich an und spräche: „Hab keine Angst!“ Ich schlief auch wieder ein, bis in den hellen Tag...
|
Aus „L’atelier d’un peintre“, 1833. |
VIERTER TEIL
Marceline Desbordes-Valmore hat viele Briefe geschrieben (obwohl sie in ihrer ewigen Armut oft erschrak vor den zwei Sous Postporto und häufig, wenn ihr ein Brief zu gewichtig geraten schien, den Gatten erschrocken fragte: Du hast wohl dafür viel bezahlen müssen). Aber Mitteilung, Ausströmung des Gefühls, war ihr unüberwindbares Bedürfnis: mit Briefen kann man trösten, sich und den andern. Man kann sich in ihnen ausbluten wie in Tränen.
So schrieb sie viele Briefe, und dank dieser Übermächtigkeit des Gefühls gehören sie zu den schönsten, die wir Frauen verdanken. Sie sind nicht zu vergleichen mit den literarischen der grande épistolaire de France, der Madame de Sévigné, und ebensowenig mit den bezaubernden, aber doch auf Spiegelwirkung und Gelesensein gestimmten etwa der Rahel und der Bettina. Nie hat sie, die Allzubescheidene, geahnt, daß diese Mitteilungen, in denen sich das Alltägliche der Haushaltsorgen, der Geldnot, der kleinen Plackereien des Lebens unmittelbar den elementarsten Ausbrüchen der Empfindung mengt, jemals gedruckt werden könnten: ganz locker, impulsiv, nur dem innern Aufdrang nachgebend sind ihre Briefe geschrieben (meist bis hinab an den Rand, um nicht Papier zu verschwenden, das ihr kostbarer schien als ihr eigenes strömendes Gefühl). Nie bemühen sie sich, tiefsinnig, literarisch oder geistig zu werden, und tatsächlich, ihre gedankliche Fracht ist gering; Marceline Desbordes-Valmore war viel zu sehr echte Frau, um strikt-logisch und metaphysisch-aufbauend zu denken. Aber statt geistvoller Gedanken enthalten ihre Briefe oftmals etwas, das ich Gefühlsgedanken nennen möchte, spontane Erkenntnisse des Herzens, wahrhaftige Gefühlsblitze, die auch sprachlich überraschendste Formen finden. Das ist nicht kokett-geistreich, sondern im seelischen Sinne genial, wenn sie etwa vom Wochenbett ihrer Tochter einer Freundin schreibt: „Un petit berceau me retient au logis d’Ondine, heureusement delivrée (et moi aussi!). Vous saurez quelque jour, combien on est enceinte de l’enfant de ses enfants.“ Solche urdichterische Worte tropften ihr locker und häufig aus der fließenden Feder, ohne daß sie selbstbewundernd absetzte, und fast jeder Brief, selbst der flüchtigste, findet aus einer Zärtlichkeit des Gefühls immer auch den überraschendsten Zartsinn des Ausdrucks. Man kann die einzelnen Herrlichkeiten, die wortgewordenen Schreie, Seufzer, Liebesempfindungen, die spontanen Entdeckungen inmitten ihrer naiven Mitteilungen kaum zählen, so dicht drängen sie ineinander.
Aber das Schönste dieser Briefe: sie sind vollkommen wahr. Es gibt keine einzige Lüge in den vielleicht zweitausend Schreiben, es sei denn die allzu verzeihliche des Mitleids. Nackte Seele enthüllt sich, aber nicht in der bewußten Gebärde einer, die den spätern Spiegel der Öffentlichkeit vor sich weiß (und ihm, wie Rahel, wie Bettina, nicht ungern entgegentritt). Weder schamhaft sich verhaltend noch schamlos zudringlich sich eröffnend, spricht hier eine Frau zu vertrauten Menschen über alle Geheimnisse ihres Lebens und Gefühls. Dank so unbedingter Echtheit werden diese Briefe unentbehrliche Dokumente nicht allein ihrer Biographie: selten ist das Seelenhafte wirklicher Weiblichkeit überhaupt so transparent geworden wie durch die aufrichtige Selbstmitteilung dieser einen Geliebten, Frau und Mutter.
In der vorliegenden Auswahl sind zum überwiegenden Teile die Briefe fragmentarisch mitgeteilt, das alltäglich Familiäre und gleichgültig Private von ihnen abgelöst. Nur insofern sie das äußere und innere Leben der Dichterin im Rückschein auf Zeit und Umgebung sichtbar machen, sollten sie übermittelt sein, und ich hoffe, diese Auswahl genügt, um die in der Einleitung versuchte Skizze mit ihren eigenen Worten zu untermalen.
Von den Briefen Marcelinens an „Olivier“, den unbekannten Geliebten, sind im ganzen nur zwei durch den Zufall der Autographenkataloge aufgefunden worden — kaum als Briefe eigentlich anzusprechen, vielmehr „Zettelgen“, wie Goethe die hitzig raschen Botschaften an und von Frau von Stein nannte. Die wesentlichen sind vernichtet (oder wenn tatsächlich Henri de Latouche der Verführer war, im Jahre 1871 bei der deutschen Invasion mit allen dessen Dokumenten und dem Nachlaß André Chéniers verbrannt). Die vorliegenden beiden bilden nebst den Gedichten das einzige, was wir verbürgt von jener entscheidenden Episode besitzen, unzulänglich, sie zu erhellen, und nur flackernde Blitze in dem geheimnisvollen Dunkel jener tragischen Verstrickung.
| AN OLIVIER | Jänner 1809 oder 1810. |
Komm morgen nicht, Vielgeliebter, ich habe tausenderlei lästige Arbeit, Pflichtbesuche. Gestern erhielt ich den Besuch eines — reichlich gepuderten — Mannes von Geist, der sich, um Gnade zu erlangen, zuerst auf die Kniee niederließ. Ich habe gelacht und die Huldigung seiner Bonbons und seiner Almanachs entgegengenommen. Was sage ich, das kostbarste Buch der Welt, da sich der Name all dessen, was ich liebe, darin befindet! Diesen Namen, der über mein Schicksal entscheiden wird, habe ich geküßt... Adieu, mein Olivier.
Und meine drei Brüder, meine drei Freunde? Bringe sie mir doch bitte mit, daß kein Tag ohne diese Arbeit vergeht. Denke daran, daß Du Dich dabei mit meinem Glück befassest. Ich will es, dieses geliebte Holzbein, diesen armen zerlumpten Dichter und besonders diesen häßlichen, interessanten Barbier.
Wie gut Du daran getan hast, sie nach Spanien zu versetzen, ihnen ist niemals kalt. Komm, komm Du dort hin, kleiner Freund. Komm, uns in reinster Sonne zu wärmen. Indessen werde ich Dich Samstag am Kamin meiner Freundin sehen.
1809 oder 1810.
Besinne Dich Deines Versprechens, teurer Vielgeliebter; vergiß nicht, daß ich eine Seele einzig nur dazu besitze, um Dich zu lieben, Dir zu folgen und an all Deinen Handlungen teilzunehmen.
Bleiben wir niemals mehrere Tage, ohne einander zu sehen; zu sehr habe ich gelitten; morgen um vier Uhr erwarte ich Dich. Liebe mich, mein kleiner Freund, gib meinem Herzen Antwort, o ich flehe Dich an, lieb mich recht! Das ist, als ob ich Dir sagte: Schenk mir das Leben. Deine Liebe ist mehr noch, Olivier, mein Olivier, mein Olivier. Du weißt nicht, bis zu welchem Grade Du mich glücklich oder unglücklich machen kannst.
Sollte, wie die französische Forschung immer eindringlicher behauptet (ohne jedoch vollgültigen Beweis erbringen zu können), tatsächlich Henri de Latouche der Verführer Marcelinens und der Vater ihres unehelichen Kindes gewesen sein, derjenige, dem diese „Zettelgen“ galten, so sind die folgenden Briefe psychologisch von besonderem Reiz. Denn sie sind (die beiden ersten) dreißig Jahre nach jener Episode an ihren Mann gerichtet, als Latouche der Tochter Marcelinens nachstellte, und atmen die äußerste Verachtung und Erbitterung gegen ihn.
Um so großartiger kontrastiert dagegen der Brief nach seinem Tode an Sainte-Beuve. Der in allen Privatverhältnissen unbändig neugierige Kritiker, dieser Voyeur in psychologicis hatte sofort nach Latouches Tod an Marceline einen Brief gerichtet, sie möchte ihm Latouches Charakter schildern (als ob er ihn selbst nicht genug gekannt hätte). Er hoffte, ihr bei diesem Anlaß einen verräterischen Aufschrei zu entreißen. Und tatsächlich ist dieser Brief eine erschütternde Fürbitte um Verzeihung für einen geworden, der sie selbst maßlos gekränkt und gequält: das gütige, großmütige Herz wirft sich schützend über den längst verhaßten Toten, um ihm für den Nachruf etwas Milde zu retten. Ob die darin erwähnte Kränkung durch Latouche jene erste war, die Verführung und das brüske Verlassen, ob die zweite gemeint ist, die Nachstellung gegen die Tochter — dies verhüllt sich in diesem Brief, der ganz nur die Güte des Verzeihens offenbart und eines der wichtigsten Dokumente ihrer Lebenstragödie bildet.
*
| AN IHREN GATTEN | 6. Mai 1839. |
Mit Herrn Latouche bin ich mehr denn je in Verlegenheit, was mir, wie ich glaube, eine Art Kälte gibt, die ich nicht überwinden kann, obwohl ich ihn sehr liebe. Aber zu den Befürchtungen, die mir schon sein Charakter einflößte, mengen sich nun auch die schrecklichen Geständnisse jener unglücklichen Dame, und mein Aufenthalt auf diesem Landsitz versetzt mich in große Unruhe. Ich suche einen Weg zu finden, wie ich weder die eine noch die andere Person beleidige. Er gibt uns Beweise von Anhänglichkeit, die mich zu Dank verpflichten, und wenn ich mich ihrer zu erwehren versuche, so sagt er, Du seiest es, der es ihm für die Zeit Deines Fernseins zur Pflicht gemacht hätte. Ich weiß jetzt, daß es meine Aufgabe ist, mich nicht zwischen zwei Herzen zu stellen, die sich einander nähern wollen, und daß ich um keinen Preis dorthin zurückkehren darf.
23. Juli 1839.
Was, Herr von L... schreibt Dir noch? und er ist nicht im Berry? und beklagt sich über meine Härte! Mein guter Engel, das sähe wirklich wie ein Scherz aus, wenn ich ihn nicht für einen sehr bösen Menschen hielte. Bei Gott, ich habe ihn ganz und gar anständig und mit Sanftmut empfangen, mit dem Vorsatz, all die Verachtung, die er mir einflößt, zu verbergen. Er kam, um uns vor einer Geschäftsreise einen Abschiedsbesuch zu machen... Vorläufig habe ich Dir genug gesagt, um Dir die gerechte Abwehr gegen einen Charakter verständlich zu machen, der mit dem Haß aller Welt beladen ist. Überall, wohin er gekommen ist, hat er nur Unruhe und Verzweiflung gebracht. Glaub an meine instinktive Abscheu und erinnere Dich, daß meine Schuld nur darin bestanden hat, daß ich gegen Böse zu nachsichtig war. Schonen wir ihn durch den Anschein von Achtung, denn es ist ihm besonders darum zu tun, geehrt zu sein. Aber Vertraulichkeit mit diesem Menschen! Gefälligkeiten von ihm annehmen! Lieber Gott, da möchte ich lieber betteln gehen. Branchu ist unschuldig wie ein neugeborenes Kind und Pauline. Ich sage das nur Dir, durch den ich ihn kenne.
| AN SAINTE-BEUVE NACH DEM TODE VON A. M. H. LATOUCHE | 18. März 1851. |
Eine große Erschöpfung hat mich gehindert, Ihnen zu antworten. Verzeihen Sie mir, ich habe es mehrere Male versucht; aber in welchem Schlupfwinkel meines arbeitsreichen Daseins soll ich Ruhe finden, mich zu sammeln?
Bedenken Sie, diesmal muß ich beinahe auf einem Grabe meinem niedergeschlagenen Geiste sich zu ordnen gebieten. Wie könnte ich von da aus wagen, über einen anderen Geist zu urteilen. Was für ein Urteil kann man mit Tränen in den Augen niederschreiben! Ja, Sie haben recht, es könnte, ohne daß ich dessen mir bewußt würde, wie durch einen Blitz[1] geschehen, daß Sie die Eindrücke meines Gedächtnisses erfaßten, die Summe der Erinnerungen an diesen unverständlichen Geist, der Sie beschäftigt. Aber wir begegnen einander nicht. Wie soll man es da beginnen? Ihre Stimme würde mich aufrichten, und ich fände Worte, Ihnen zu antworten. Hier bin ich zu sehr in mich zurückgeflüchtet, und dies ist wahrlich eine traurige Zuflucht, und ich möchte doch nicht ein Wort von persönlicher Traurigkeit diesem Briefe beigeben. Aber ich bin durch so viele unersetzliche Verluste zu Boden geschlagen! Diese dumpfen Schreie erreichen mich von überallher wie eine schreckliche Elektrizität, und ich fühle wohl, daß mir diesen letzten Blitzschlag niemand in Anrechnung bringt als vielleicht Gott, der alles weiß, für alles Mitleid hat! Ich war bereits in Trauer: kaum habe ich den Schleier emporgeschlagen, so muß ich ihn schon wieder auf meine Seele herabsenken, und ich kann nicht mehr weiter.
Außerdem habe ich für dieses glänzende und geheimnisvolle Rätsel mir weder eine Erklärung gesucht, noch es erraten. Es wirkte auf mich blendend und beängstigend, zuweilen war es dunkel wie Schmiedefeuer im Walde, bald leicht, hell wie ein Kinderfest. Aufrichtigkeit, die er liebte, ein unschuldiges Wort, konnten in ihm das Lachen einer wiedergefundenen Freudigkeit, einer wiedergewonnenen Hoffnung zum Ausbruch bringen. So lebhaft malte sich da Dankbarkeit in diesem Blick, daß Ängstliche sich wieder sicher fühlten. Da lebte in seinem gequälten, recht mißtrauischen Herzen, das, wie mir dünkt, sehr nach menschlicher Vollkommenheit, an die er noch glauben wollte, verlangte, der gute Geist wieder auf.
Oft schien es, als wäre es ihm lästig, zu leben; welche Bitterkeit breitete sich da über dies flüchtige Fest, wenn er der schönen Hoffnungen müde wurde! Bewunderung war, glaube ich, leidenschaftlichstes Bedürfnis seiner kranken Natur, denn krank war er sehr oft und sehr unglücklich! Nein, er war kein Böser, sondern ein Kranker, denn wenn an seinen Idolen ein einziger Fehler in Erscheinung trat, so war er schon in tiefe Verzweiflung versetzt, und das ist nicht zu viel gesagt. In einer solchen befand er sich, als wir ihn kennen lernten. Offen sprach er nie davon während unserer Gespräche, die er scheinbar suchte, um die Erinnerung einer sehr stürmischen Vergangenheit zu verscheuchen. Welche innere Verfassung war je geheimnisvoller als die seine? Dennoch hielt ihn mein Onkel, den er ganz und gar liebte, mein Onkel, der einen aufgeschlossenen, romantischen und dabei religiösen Charakter besaß, seines reizvollen Wesens, seiner aufrichtigen Sanftmut willen, für schlicht, kindlich, rein und warmherzig. Er war es auch! Er war es! Und glücklich und getröstet, ermutigt, so sein zu können durch diese ungetrübte Zuneigung.
Man hielt ihn im engen Sinn des Wortes für neidisch. Er ist es niemals gewesen. Aber ungerecht, voreingenommen, dies — ja! Sein Zorn, seine Verachtung waren so groß, wenn ihn ein Talent, etwas Wertvolles, Schönes enttäuschte, dessen Entdeckung ihn mit Freude erfüllt hatte. Wie ironisch war er dann gegen seine eigene Einfältigkeit! Wie schmerzlich berührt war er nach seinem eigenen Wort: durch sich selbst bestohlen worden zu sein! Er litt viel, glauben Sie es und vergessen Sie es nie. Er konnte über eine Blume gerührt sein und grüßte sie mit frommer Ehrfurcht. Dann regte er sich darüber auf, daß er ihre Vergänglichkeit vergessen konnte. Er zuckte die Achseln und warf sie ins Feuer. Dies ist wirklich geschehen?
Hat nicht auch sein heftiger politischer Standpunkt die natürliche Anmut, die sich seiner Tatkraft gesellte, vertrübt? Ich habe mir das oft gedacht. Eine unbeeinflußbare Selbstlosigkeit, die ihn Elend und Klagen hätte ertragen lassen, machte ihn mitleidlos gegen die Schwächen des Ehrgeizes oder die Indolenz, die er im patriotischen Gefühl ein Verbrechen nannte. Hier mag das Geheimnis seiner großen Vereinsamung liegen.
Die sorgfältige Beharrlichkeit bei der Arbeit trieb er bis zum Exzeß, der seine Gesundheit, wie seine Erfolge gefährdete. Er band sich wie ein Märtyrer an sie. Man hätte sagen mögen (ich weiß das von anderen), daß sein Herz und sein Kopf sich langsam mit Rauch erfüllten und dieser manchmal den Schwung, die Hingabe, das Fluidum, die Eingebung erstickte, so daß es sich wie bei einer Lampe verhielt, die keine Luft hat. Wenn ich mich, wie mir scheint, schlecht ausdrücke, so werden Sie den tieferen Sinn dennoch verstehen. Ich schreibe ja da nicht Kritik, mein Gott: ich beklage sein Unglück und seine Qual!
Seine Begeisterung für die deutsche Literatur und für die Wandlung der unseren hat ihn sehr beherrscht. Seither war ich so kühn, Erstaunen zu empfinden, daß seine Dichtung, obwohl elegant, wenn auch feierlich, sich kaum von Abhängigkeit frei gemacht hatte, die er doch verabscheute; ein Beweis dafür waren seine Bewunderungsausbrüche für die ritterlichen Kühnheiten des Herrn von Musset und die neue Art von Ihnen allen, die ihn mit Hoffnung beglückte.
Seitdem weiß ich nichts Genaues mehr, noch vermochte ich dieses Genie, das so bitter geworden war, aus der Nähe zu betrachten. Durch entfernten, seltenen und auch traurigen Widerhall nur, suchte er uns zu begegnen. Sein Buch über Clemens XIV. hat uns die reizendsten Gespräche mit unserem Onkel in Erinnerung gebracht, der ihn dazu angestachelt hatte; Fragoletta hat mich mit Erstaunen und Schrecken erfüllt; seither hat uns Grangeneuve auf unsere Instinkte, für ihn zu hoffen, ihn zu bemitleiden, hingewiesen. Und von jener Zeit ab hat er vielleicht, weil er seine Phantasie und sein geschriebenes Wort im Zaume hielt, deren Freiheit und Glanz um so mehr verraten. Seine letzten Bücher habe ich nicht mehr zu lesen gewagt... Vielleicht wiederhole ich Ihnen etwas da überflüssigerweise: aber sein Geist, wenn er sprach, war unwiderstehlich, wußte er, daß man ihm gut zuhörte und ihn verstand und er von seinem schwarzen Übel aufatmen konnte. Nur, daß er zu viel an das Publikum dachte, das kalt urteilende, diesen mächtigen Richter, gegen den es keinen Einspruch gibt! Die Flamme war dann durch eine zu lang andauernde Träumerei beeinträchtigt. Furcht vor Lächerlichkeit lähmte ihm jene Kühnheit, der er bei anderen Beifall zollte. Er war nicht der Mann, irdische Demütigung zu ertragen, und aus Furcht, zu stürzen, wagte er nicht mehr, sich emporzuschwingen...
Lieber wollte er ohne eine Hand zu rühren untergehen, als Lachen durch seine Tätigkeit hervorzurufen, jenes Lachen, das er anderen nicht immer ersparte und über das er sich oft Vorwürfe machte! Glauben Sie das nicht auch? Sie haben es ja selber sehr fein beobachtet, daß er weit entfernt war, „das Böse getan zu haben, das er tun hätte können“? Was Sie in dieser Hinsicht sagten, ist von tiefer Warmherzigkeit.
Welch großen Sieg muß er doch über seine Zornausbrüche errungen haben! Welche stillschweigende Größe, daß er sich nicht gerächt hatte, er, dessen brennender Stolz sich so oft für tödlich beleidigt hielt, denn ihn fürchten hieß ihn beschimpfen! In diesem, seinem stummen und einsamen Mut, muß man das finden, was die Tränen aufwiegt, die er fließen ließ! Der Meinung sind Sie doch auch? Oh! seien Sie es, sprechen Sie es um der Gerechtigkeit willen aus, wie Sie alles auszudrücken vermögen. Es gibt ja Dinge, die zwischen Himmel und Erde gehört werden, die überallhin Trost bringen können.
Entscheiden Sie, ob diese argwöhnische Seele nicht selber ihren Aufschwung, ob die körperlichen Leiden nicht diesen Ruhm, der sich so hoch ankündigte, verdunkelt haben!
Dies ist alles, was ich für Sie aus meinen Gedanken formen kann..., mögen sie doch den Ihren dienlich sein! Zumindest bin ich bereit, sie Ihnen in dieser Welt und überall immer wieder in dieser Weise zu vermitteln, weil ich an Sie glaube, an Ihre nachsichtige Freundschaft für mich und meinen geringen Verstand.
Marceline Desbordes-Valmore
|
„Und wer kann mir besser von ihm sprechen als Sie und mir eine Idee von ihm geben, blitzartig ihn beleuchten“, hatte Sainte-Beuve ihr geschrieben. |
Die folgenden Briefe schildern (für mein Gefühl in herrlichster Unmittelbarkeit) die Gefühle Marcelinens, als sie, seit sieben Jahren verlassen von ihrem Geliebten und ein Jahr nach dem Verlust ihres unehelichen Kindes, längst jedes Glück in ihrem Leben für eine Unmöglichkeit hielt und plötzlich die Werbung des bedeutend Jüngeren, des „schönen Valmore“, empfing (so nannte man, und das Bildnis billigt das Beiwort, im Brüsseler Theater ihren Partner). Sie war ihm als einem Kinde zu Beginn ihrer Schauspielerlaufbahn in Bordeaux begegnet und fand ihn nach zwanzig Jahren auf der gleichen Bühne als Neuling und jugendlichen Liebhaber. Von ihrer Sanftmut und Schwermut angezogen, versuchte er sich ihr zu nähern und schrieb ihr einen Werbungsbrief, den sie — erschreckt beinahe — mit dem ersten der hier nachfolgenden Schreiben erwiderte, um dann doch nach kurzem und liebendem Widerstand am 4. September 1817 seine Gattin zu werden.
*
| AN VALMORE | Brüssel, 1817. |
Nein, mein Herr, ich habe nicht geantwortet. Ich wollte auf das, was ich für ein Spiel hielt, ganz und gar nicht eingehen. Der Gedanke daran ließ mich vor Angst erstarren.
Welch einen Brief schreiben Sie mir heute! Wie hat er mich verwirrt! Treiben Sie keinen Mißbrauch mit leidenschaftlichen Worten, treiben Sie nur niemals Mißbrauch damit. Mein Herz ist wahrhaftig und aufrichtig. Ich kann es nicht wieder vergeben, ohne daß mein Leben daran hängt, und in Ihren jungen Jahren, von tausend Versuchungen umgeben, verspricht man nicht eine grenzenlose Liebe, eine Liebe bis zum Grab!... Darum versuchen Sie nicht, mir das einzureden, — ich habe so viel gelitten!
Ja, Sie werden gut tun, mich zu meiden. Das ist das einzig Vernünftige in Ihren, im übrigen unbegreiflichen Vorschlägen. Auch ich werde Ihnen aus dem Wege gehen — ich habe mir das schon zur traurigen Gewohnheit gemacht. Was täte ich nicht um meines inneren Friedens willen! Würden Sie es nicht bedauern, mich inniger ans Leben zu fesseln, um mir dann eines Tages einen anderen, tieferen Schmerz zu bereiten? Oh, lassen Sie nach, ich bitte Sie; ich bin traurig und nicht geschaffen, um zu lieben, auch nicht um geliebt zu werden. Ich glaube nicht an das Glück!
Warum sagen Sie, Ihre Schwermut entfremde Ihnen mein Herz? Meinen Sie das wirklich? Schreiben Sie das in aufrichtigem Glauben?
Sie machen unserm unglücklichen Stand den Vorwurf, uns zusammengeführt zu haben. Sie drücken sich da sehr hart aus. Wenn Sie sich darüber beklagen — welches Recht hätte erst ich, ihn zu hassen? Immerhin, verzeihen Sie es ihm, unser Beruf kann ja alles wieder gutmachen, indem er uns bald trennt. Um diese Trennung zur Tatsache werden zu lassen, bleibt mir nur zu wissen, daß Sie es wünschen.
Nein, nicht Ihre Zuneigung kann Ihnen den Rat gegeben haben, mir zu schreiben, — ebensowenig kann Ihre vortreffliche Mutter Sie bestimmt haben, mir meinen Seelenfrieden zu nehmen; ich meinerseits möchte nicht um die Welt Ihrer Seele wehe getan haben, verstehen Sie mich? Was werfen Sie mir denn vor? Welchen anderen Beweis kann ich Ihnen gegenwärtig von meiner Hochachtung geben, deren ich Sie hiermit nochmals für alle Zeiten versichere.
M. Desbordes
Brüssel, 1817.
Mein Herr, Sie sagen, ich hätte Ihre Scheu und Zurückhaltung für Stolz gehalten. Sie haben meine Traurigkeit für Mißachtung angesehen. Wir haben uns alle beide getäuscht. Wie könnte man jemanden mißachten, den man seit langem tief schätzen gelernt hat? Aber wozu Entschuldigungen mir gegenüber? Habe ich irgendeinen Vorwurf gemacht? Hätte ich einen Grund, ein Recht dazu gehabt? Sie haben die Güte, meiner Meinung einen gewissen Wert beizumessen, und Sie möchten diese hören. Nun gut, mein Herr, hier ist sie: Ich glaube, daß Sie alle Vorzüge eines rechtschaffenen Mannes besitzen, verbunden mit den Neigungen Ihrer Jugend.
Nun kennen Sie meine Auffassung. Lassen Sie sich also nicht mehr verletzen durch eine dem leidvollen Menschen ganz selbstverständliche Zurückhaltung. Halten Sie diese niemals für Verachtung — wenn es wahr ist, daß Sie so gedacht haben —, und seien Sie versichert, daß es mir zeit meines Lebens Freude machen wird, Ihnen — mehr als es mein Frohsinn könnte — zu beweisen, welche Hochachtung ich Ihrer Familie und Ihnen, mein Herr, entgegenbringe. Ist das nicht alles, was Sie zu wissen wünschen?
Sie dürfen nun überzeugt sein, daß niemand aufrichtiger ist als Ihre ergebene Dienerin
M. Desbordes
Brüssel, 1817.
Glauben Sie, mein Freund, ich könnte schildern, was in mir vorgeht? Glauben Sie das? Überwältigt von Glück und Überraschung, fürchte ich... vergeben Sie mir, fürchte ich die auf mich einstürmenden Empfindungen; ja, diese Trunkenheit der Seele ist fast Schmerz. — Oh, schonen Sie mein Leben! Es ist noch gebrechlich und unsicher. Seit es Ihnen gehört, fürchte ich alles, was ihm Gefahr bringt, und die Aussicht auf ein ungeahntes, unsagbares Glück scheint meine Kraft zu übersteigen.
Und sagen Sie, mein Geliebter, wissen Sie auch den vertraulichen Beziehungen des Lebens diesen Reiz, diese rührende Zartheit zu geben, die mich so zu Ihnen hinzieht? Welch ein Glück ist es dann, Sie zu lieben, ganz und einzig von Ihnen geliebt zu sein! So würde nichts den Zauber brechen, der uns bei unseren ersten Blicken umfing? Ich dürfte nun wagen, ihn festzuhalten, darin meine Bestimmung zu lesen, ein zärtliches Geschick, die innige und feierliche Verheißung der Bande, die uns ewig aneinander fesseln sollen?
O Gott! wenn ich furchtsam bin, so müssen Sie das mir verzeihen! Es ist die Liebe, die vor der Liebe zittert. Ist sie auch scheu in ihren Geständnissen, ihren Hoffnungen, so wissen Sie, daß sie darum nicht weniger stark und getreu ist. Ein jeder meiner Tage wird in unserer Zukunft Zeugnis dafür ablegen, mein Herzgeliebter! Ja, heut abend werden wir uns sehen. — Welch süßer Gedanke! Meine ganze Schwermut schwindet. — Gott, der uns wohlwill, sucht dieser köstlichen Vereinigung jedes Wölkchen zu nehmen. Ihre Mutter wird also die meine sein! Ihr Vater wird den meinen ersetzen, den ich noch immer beweine!... Können Sie ermessen, wie lieb ich ihn haben werde?... Sagen Sie, daß Sie es wissen. Doch wird man auch mich lieb haben? — Oh, bitten Sie darum ——
Brüssel, 1817.
Weißt Du, Prosper, was ich in Deinem Briefe gefunden habe? — Eine Seele, die die meine erwartet hatte!... Gestern... all die Tage, die für die andern verflossen scheinen, für mich sind sie es nicht; sie umgeben mich — die Zeit hält stille, um mir Muße zu lassen, frei zu atmen — ich stürbe, wenn sie zu rasch entschwänden — Tomy, mein angebeteter Tomy! wenn Dein Herz erregt ist — sieh, wie doch meine Hand bebt!
Ich bin glücklich. — Wie meine Seele sich bei diesem vergessenen, seit jener Zeit... für immer — erloschenen — Worte öffnet! Du hast es für mich in den Himmel, in diese Welt, überall... eingegraben. Ich werde es in Deinen Augen lesen! Wie! ist also doch das Leben das Glück?... Möge Dich Gott mit jener Glückseligkeit überhäufen, in der ich mich befinde: Ich weiß nicht, wo ich bin: sag es mir, mein Lieb! Ach ja, Tomy, gib acht auf mein Leben, man kann vor Freude sterben.
Hast Du gestern, hast Du meine Zärtlichkeit gesehen? im Schmerz, im Rausch, der ihr folgte? Oh, warum einige Stunden so heftiger Qual bereuen! Von welchem Entzücken waren sie aufgewogen. Was für eine Seele hast Du mir gegeben! Oh, ich kann wahrhaftig nicht mehr schreiben. Lebwohl, Prosper, mein Gemahl!
Dein Vater liebt mich sehr. In dem Maße als ich Dich — ein wenig — liebe, bin ich voll Aufmerksamkeit für ihn. Und bin ich denn nicht recht artig? Ihr werdet dann gleich meine graziöse Verbeugung sehen. Oh, laß mich doch wieder einen teuren Brief lesen, der mir das Herz verbrennt!
Von der fünfunddreißigjährigen und erst durch den Tod gelösten Ehe mit Prosper Valmore geben die folgenden Briefe ein Bild. Nie ist ihr Beisammenleben wirklich erschüttert gewesen, es erschien nur flüchtig bedroht durch der beiden gegensätzliches Verhältnis zu ihrer Kunst. Prosper Valmore war (und nicht mit Unrecht) eifersüchtig auf Marcelinens Gedichte, die mit der bei ihr unbedingten Ehrlichkeit des Gefühls immer nur ihre Liebe zu — dem ersten Geliebten, zu dem Verführer schildern, dem ihre Sinne, ihre Seele trotz aller Erniedrigungen unwandelbar treu blieben. Im geheimen hatte Prosper gehofft, nun werde er der Gegenstand ihrer Dichtung sein, und sah den Nebenbuhler, der sie schmählich verlassen, lebendig in ihrem innern Leben, ja, die Qual war ihm auf erlegt, die Verse an jenen andern und Unvergeßbaren korrigieren zu müssen. Diese Eifersucht gegen den Abwesenden und aus ihrem Herzen doch Unverjagbaren hat geradezu einen Haß gegen Marcelinens Dichtung in ihm erweckt, so daß die Gütige oft ganz der Poesie entsagen wollte. Und sie hätte es getan, wäre nicht der Zwang zur Aussage elementar in ihr gewesen.
Ihr wiederum bereitet Prospers Kunst schwere Stunden oder vielmehr seine Nichtkunst. Denn er ist ein schlechter Musikant, Valmore, nirgends gefällt der Pathetische auf der Bühne, ja, er wird sogar ausgepfiffen, und sie hat die anstrengende Aufgabe, gegen ein inneres Wissen, das falsche Selbstbewußtsein des armseligen Provinzkomödianten zu stützen. Erst als er von der Kunst (wie weit war er von ihr!) endlich Abschied nimmt und ein kleiner Staatsbeamter wird, schwindet die Unruhe. Dann bindet das gemeinsam verlebte Elend, das gemeinsam erlittene Unglück sie immer enger zusammen, und die Ehe verdämmert in bescheidenem Glück, obzwar ihre letzten Bekenntnisse immer über ihn hinweg an die Freundin ihrer Seele gehen und das letzte Geheimnis, die Liebe zu Olivier, nie vollkommen in ihrer Seele verlischt.
| AN VALMORE | St. Rémi, den 22. März 1820. |
Nie mehr, mein Liebes, nie mehr will ich mich von Dir trennen; das hieße, sich freiwillig das Herz ausreißen. Du kannst aber unbesorgt sein: meine Reise ist gut verlaufen. Ich bin um sechs Uhr angekommen. Vor dem Hause, das Deinen Sohn beherbergt, erwarteten mich die Amme, die Mutter, der Vater und Drapier. Ich bin nur so gerannt, sage ich Dir, ohne zu spüren, daß ich eine Nacht im Wagen zugebracht hatte. Ich habe den kleinen Liebling eine Stunde lang um mich gehabt. Er ist lebendig wie ein Fisch, alle seine Bewegungen sind so lebhaft, daß man die eifrigen und hübschen kleinen Züge kaum mit Muße betrachten kann. Sein Gesicht ist ein wahres Kaleidoskop, immer anders und immer anmutig. Seine Haut ist blendend weiß, seine Augen sind prachtvoll blau, — aber nicht so groß wie die Deinen. Der Mund steht nur im Schlafe still, aber ich habe den Kleinen nicht schlafen gesehen, und so ist mir der Mund bald groß, bald klein erschienen und von immer anderer Form. — Er hält sich ganz gerade, und wenn man ihn niederlegt, richtet er sich stolz auf seinen kleinen Händen auf, um alle Welt zu betrachten. Er nimmt seine Nahrung mit Hingabe und leert die Brust seiner Amme bis auf den letzten Tropfen. Seine Haare sind viel blonder als bei der Geburt. Er ist entzückt, wenn man ihm den Kopf streichelt; es ist ein wonniges kleines Lämmchen. Ich habe zweimal seiner Toilette beigewohnt; er erscheint mir erstaunlich groß, und er ist von tadelloser Gestalt. Ich könnte Dir stundenlang von ihm erzählen, und es würde uns noch zu wenig sein. Alles um ihn her, das ganze Häuschen, ist von herzerfreuender Sauberkeit.
Lieber Prosper, komm in den Ostertagen, und sieh ihn Dir an.
Paris, den 5. April 1827.
Heut gönne ich mir einen ganzen Ruhetag, und ein großer Teil davon soll Dir gehören, mein Lieb. Ich habe Dir so viel zu sagen, so viel Liebe Dir zu geben! Deinen letzten, so wundervollen Brief habe ich gestern bei meinem Onkel in Empfang genommen; welch ein Trost ist er mir gewesen! Du mußt nicht denken, daß alles glatt geht auf dieser Reise; vor allem — ohne Dich fühle ich immer eine Leere, die ich nicht lange ertragen kann, ohne daran krank zu werden. Doch die Gewißheit, sehr bald wieder bei Dir zu sein, läßt mich diese Abweichung von meinen lieben Gewohnheiten leichter erdulden. Du weißt also nicht, wie sehr Du mein Ich bist, wie ich jetzt nur durch Dich allein lebe, nur lebe im Verlangen, bei Dir zu sein, Deine Hände, Deine Blicke zu fühlen, Deine Liebe, Deine edle und getreue Seele, Beistern meines Lebens, das ohne Dich mir unerträglich wäre! Ja, was Du mir auch gibst, ich habe genug, um es zu erwidern, und wenn Du das Glück hast, Deine Frau zu lieben, so ist es mein Glück, Dich einem ganzen Weltall vorzuziehen! Ich will nur Dich, ich liebe nur Dich. Ich bitte Dich, sprich mir nicht von Ruhmeskränzen, von Talent; sprich mir von nichts. Die Eitelkeit hat keinen Platz in meinem Herzen, das so sehr erfüllt ist von Innigkeit und Tränen, denn Du weißt, daß ich oft weine, heimlich, und nicht immer aus Kummer.
Grenoble, den 18. November 1832.
Hoffnung und Grenoble! Und beides heute früh um sieben Uhr, mein guter Prosper; ich habe Herrn Froussard gesehen! O teile meine Freude darüber, daß er alle unsere Erwartungen übertrifft. Hippolyte wird das glücklichste von allen den Kindern sein, die fern vom Elternhause leben müssen... Wie undankbar bin ich, andere als Freudentränen zu vergießen... Doch was nützt der Vorsatz? Nein, ich fühle keine Freude. Die Sache ist viel bitterer, als ich mir je geträumt hatte... Mir bleibt nichts, als mich zu fügen, wie jene, die den Kopf unters Beil legen...
Dein Brief, den ich kurz vor der Abreise von Lyon erhielt, Dein letzter aus Paris — dieser Brief, mein Freund, hat mich viel weinen machen. Er hat mich in Zeiten von Qual und Elend zurückversetzt, die man nicht heraufbeschwören sollte, da es mir möglich war, sie zu überstehen. — Wie! Ich sollte Dich täuschen? Ich, damals so erdrückt von dem Bewußtsein, Dir Verachtung einzuflößen, bin ich es, von der Du sprichst? Sieh, ich sage es ja, man lebt wie blind dahin, an der Seite des andern, man versteht sich nicht. Sind meine Gedanken denn so undurchsichtig, mein Freund? An mir, die ich so aufrichtig, ich wage zu sagen, so naiv zu allen andern bin, an mir hast Du gezweifelt! Gezweifelt, während mein Herz gemartert war von Deiner Kälte und Deinem Überdruß an mir. Das glaubte ich wenigstens! Warum sagst Du, ich liebte nicht die Einmischung Dritter in unsere Beziehungen? Kannst Du auch nur das geringste Mittel zur Annäherung zweier Wesen, die eins werden, die einander lieben und glücklich machen wollen, darin erblicken, daß man sie gegeneinander aufzubringen sucht, daß eine Mutter, erbittert, ihren kleinlichen Anspruch auf Autorität bedroht zu sehen, in ihrer Eifersucht die beiden gegeneinander hetzt? Ach, Prosper, wie traurig stimmt es, Ursachen nachzugehen, aus denen so viele unserer Tränen geflossen sind. Glaube mir, lieber Freund, es ist die Quelle, aus der Du, ohne Dein Wissen, tausend unklare Vorurteile gegen mich geschöpft hast, Du hast oft genug das recht getrübte Urteil Deiner Mutter über mich auch zu dem Deinigen gemacht. Ich achte die wirklichen Werte, die sie gehabt hat, aber sie ist, gewiß ohne böse Absicht, recht grausam zu uns gewesen. Sei Du selbst! Sieh mich, wie ich bin: Deine Dir ganz ergebene, Dir innig vertraute und, ich wage es zu sagen, Deine gute Marceline! Und Deine einzige wahre Freundin!
Lyon, den 23. November 1832.
Und dann höre! Du sprichst mir von Andeutungen, die Dir weh getan hätten. Ich — Dir weh getan! Ich, die ich mein Blut für Dich hingegeben, die ich Dir bis ans Ende der Welt folgen würde — überallhin und um jeden Preis? Oh! Gut, nimm hier meinen getreuen Eid, daß nie ein Wort Dir wissentlich von der Vergangenheit reden soll, daß sie für mich abgetan ist, und daß ich auch Dich beschwöre, sie zu vergessen. Anderseits: wie kannst Du mich so falsch verstehen? Du bist zu streng gegen Dich selbst und willst nicht daran glauben, daß andere Dich lieben, und Dich lieben, und Dich lieben! Sei gut, sei furchtlos, ich hege gegen keine Seele Groll, und sollte es gegen Dich? Komm, geben wir uns einen Kuß, Prosper, willst Du?
1. Dezember 1832.
Ich lese und lese immer wieder, was Du grausam genug bist mir über meine Zärtlichkeit zu sagen; ich weine, und in meiner Verblüffung darüber klage ich Dich an. Wie! diese qualvolle Ausdauer, Dir meinen Kummer verborgen zu haben, wird mir nicht besser belohnt, teurer undankbarer Freund! Ausbrüche, die Dich unglücklich gemacht hätten und die ich für Deine Ruhe fürchtete... und von denen ich meinte, daß sie mich noch mehr von Dir entfernen müßten, all dies hast Du für Kälte gehalten! Ach! das ist zu schmerzlich, und das wollte man ausnützen, Dich von mir zu reißen! Ich wäre beinahe daran gestorben und vor Schweigen erstickt. Du hast nichts begriffen, Verblendung eines Herzens, aus dem ich so lange ausgelöscht zu sein glaubte. Du wirst es bereuen, nicht wahr? Du wirst mit mir über das weinen, was mich in diesem Augenblick Tränen vergießen läßt! Du siehst nicht klar über Dich und mich. Ich selber war auch sehr argwöhnisch. Was, Du liebtest mich, Prosper, liebtest mich, sag es mir hundertmal: dies hoffen zu dürfen, tut mir so not! All dies hat mich niedergeschlagen.
2. Dezember 1832.
Es kränkt mich heute, diese Gedichte, die Dein Herz bedrücken, geschrieben zu haben. Ich wiederhole Dir in Aufrichtigkeit, daß sie aus unserer Verbindung entstanden sind: es ist Musik, wie sie Dalayrac machte; es sind Eindrücke, die ich bei anderen Frauen beobachtet habe, die vor meinen Augen litten. Ich sagte: „Ich empfand dies oder jenes, in dieser Lage“ und machte daraus, abseits für mich, Musik, Gott weiß es!
10. Dezember 1832.
Ich bin aufgewacht und hielt noch den Kopf des Kindes (Hippolyte) an mein Herz gedrückt. Ich hatte geträumt, daß er (aus dem Institut) davongelaufen war, um mich wiederzusehen, er weinte, und ich überschüttete ihn mit Liebkosungen.
*
| AN IHREN SOHN | Rouen, den 23. April 1833. |
Dein Brief hat uns sehr gefreut, mein kleiner Freund! Warum kann ich Dir hier nicht in Wirklichkeit den Kuß geben, als Dank dafür, daß Du bist, was Du sein sollst, daß Du die Mühen Deines Lehrers belohnst, den ich immer wieder segne! Dein Fleiß und Deine Bravheit trösten mich über die schmerzliche Trennung. Wie lieb habe ich Dich, mein guter Sohn, daß Du Dein Versprechen hältst und versuchst, Dich für alles, was Du Herrn Froussard schuldest, dankbar zu erzeigen. Eines Tages wirst Du verstehen, wie ungeheuer Du ihm verpflichtet bist. Wo könntest Du besser lernen, ein tüchtiger, ehrenhafter Mann zu werden und Dir die Unschuld des Herzens zu bewahren? Und mit wie viel Annehmlichkeiten er Dir die Pflicht versüßt! Wenn Du wüßtest, mein kleiner Liebling, welche Rührung mich bei dem Gedanken erfaßt! Danke ihm in meinem Namen durch Deinen Gehorsam und Deine Liebe zu ihm. Da das Schicksal Dir kein anderes Gut als die Rechtschaffenheit mitgeben kann, so muß dieses eine wenigstens beständig und unerschöpflich sein. Dein Vater und Dein Großvater haben den Keim dazu in Dein Herz gepflanzt; wer könnte ihn zu edlerer Entfaltung bringen als der beste der Menschen, der Dich zu seinem Zögling und „Emile“ erwählt hat? Bevor Du einschläfst, wende Deine Gedanken zu Gott! Danke ihm, mein liebes Kind, für den Mentor, den er Dir gegeben hat. Verliere nie das Grauen vor der Lüge, der Lügner ist niemals ehrenhaft. Hüte Dich, jemals etwas zu versprechen, was Du nicht erfüllen kannst. Sei gern gefällig, hab gut acht auf das wenige, was Dein ist, und vor allem auf das Eigentum der andern; sei nicht zudringlich und rühre nicht daran. Leihe Dir nur, was Du bestimmt und pünktlich wiedergeben kannst, und möge die Reinlichkeit Dein ganzes Leben erhellen. Sie ist die harmlose Freude des Armen. Gott hat überall für Wasser gesorgt, mit dem man sich läutern kann. Ergib Dich niemals dem Spott. Die innigsten Freundschaften müssen darunter leiden. Man glaubt nicht mehr an die Zuneigung dessen, der sich über uns lustig gemacht hat. Es ist eine große Bitternis und ein kleiner Triumph!
*
| AN VALMORE | Paris, 5. Juni 1833. |
Beharre doch nicht bei dem Glauben, es sei Dein Lebensstern, der den meinen vertrübe; damit würdest Du mir Reue einflößen, indem Du mich daran gemahnst, daß das Gegenteil der Fall ist. Haben wir nicht auch ohne solche Einbildungen genug wirklichen Kummer!...
16. Jänner 1834 (abends).
... Wie, Du hast an mein Schuhwerk gedacht, mein guter Prosper! Ich versichere Dich, dieser Gedanke hat mich gerührt, um so mehr, als es sich mit unseren kleinen Arbeitsplänen für unsere so langen Abende begegnet hat. Line[1] hat Dir Trikotärmel gemacht. Ich bin eigens ausgegangen, um dazu die Wolle zu kaufen. Wie wundervoll ist es für uns beide, uns um Dich zu kümmern.
|
Line (Ondine), die Tochter. |
*
| AN IHREN SOHN | (Paris,) 8. Dezember 1833. |
Mein lieber Hippolyte! Wieviel Küsse und Zärtlichkeit liegen in diesen drei Worten: mein lieber Hippolyte! Mein kleiner Freund, ist es nicht, als hätte ich Dir einen ganzen Brief geschrieben, indem ich Dir das schreibe?...
Ich habe keine Augenschmerzen mehr, aber ich bin recht matt. Die Arbeit übersteigt meine Kräfte. Vielleicht werden wir nicht mehr lange in Paris sein, trotz der Schritte, die wir für ein Bleiben unternehmen, im Interesse Deiner Zukunft und der Deiner Schwestern. Ein Hoffnungsfädchen ist uns noch geblieben, und auch Gott ist da. Du kennst mein Vertrauen in ihn und meine Unterwürfigkeit in seinen Willen, der weiser ist als unsere Wünsche.
Unser nächster Brief, mein guter Junge, wird Dir sagen, ob wir Mittel und Wege gefunden haben, uns in Paris festzusetzen. Der Vater möchte gern das Theater verlassen, und ich bitte Gott, daß er zustimmt. Bitte ihn auch, Lieber! Du hast uns so lieb, nicht wahr, daß Du es aus ganzem Herzen tun wirst?
Lausche auf die Schläge der Uhr, die wir Dir hier schicken, und denke an die Schläge meines Herzens für Dich, liebes Kind! Bestätige uns sogleich den Empfang des Kästchens.
*
| AN VALMORE | Paris, 2. Februar 1834. |
... Wenn Du einen festen und letzten Entschluß über das Engagement in Lyon gefaßt hast, unabhängig davon, ob Du eines an das Théâtre-Français angeboten bekommst, werde ich mich sogleich um meine Abreise kümmern: denn ich bekenne Dir, Deine Aversion läßt mich vor dieser Hilfsquelle in Paris zurückscheuen, und ich sehe keinen Vorteil für unsere Zukunft darin, wenn Du ein Opfer bringst, das Dich unglücklich macht; Du weißt, ich habe seinerzeit ebensowohl Dein Grauen vor einer Rückkehr nach Lyon begriffen. Du kennst noch immer nicht genug meine Selbstverleugnung Deinem Willen gegenüber, lieber Prosper. Wie in aller Welt könnte ich zufrieden sein, wenn Deine Position Dir falsch erscheint oder Deinen Neigungen nicht entspricht? Du beunruhigst Dich zu sehr um mich: ein ruhiger Winkel, meine Kinder, Tinte und Papier — und ich fühle mich hier so wohl wie da, vorausgesetzt, daß man mich Atem holen läßt...
Paris, den 25. April 1839.
Ich fühle Deine Ankunft dort. Ich erlebe in meiner tiefen Einsamkeit Dein Erwachen ohne mich. Ich weiß, wie traurig das ist, Du! Ich weiß alles. Du tust mir leid, ich weine, und ich liebe Dich über alles. Und so rufe ich Dir jetzt zu: Mut, Hoffnung!...
Lieber Gott! Wie die armen Kinder Dich bedauern und Sehnsucht nach Dir haben! Kannst Du ihnen nicht ins Herz sehen? Hast Du nicht zum mindesten den unendlichen Trost in dieser schweren Prüfungszeit, geliebt zu sein? Dieses Bewußtsein erhält bei Kräften. Ich habe nur eine Bitte an Dich: schone Dich für uns; sei glücklich, wenn Dir daran liegt, daß ich aufatmen und aushalten kann!
26. morgens.
Ich küsse Dich im Namen Molières, von dem ich soeben geträumt habe. Er hat in einem hübschen kleinen Haus, das Dein war, mit uns diniert. Du warst zufrieden, und ich — das kannst Du Dir denken! Er bat mich um einen meiner Ringe und küßte mich auf die Stirne, ehe er sich an die Arbeit begab — ich ersuchte ihn, sich mit Dumas zusammenzutun und ein Theater zu gründen; ich wußte ja, wie gern Du ihn hast und daß Du Dich darüber freuen würdest. Er lächelte uns zu und hatte nur einzuwenden, daß er zu viel zu arbeiten habe.
Ich wollte Dir diesen friedvollen Traum berichten. Das Wetter bessert sich ein wenig. Ich werde einen Ausflug aufs Land wagen. Im übrigen ist mir alles Äußere gleichgültig. Nein, mein lieber Freund, kein Glück nimmt mir die bittere Last vom Herzen, die Deine Abwesenheit mir bringt.
29. April 1839.
... Seit Deiner Abreise habe ich meine große Verstimmung noch nicht überwinden können. Schlafengehen, Aufstehen, dies ist von einer Traurigkeit, die ich nicht unterdrücken kann. Ach! mein liebes Kind, könnte man, bevor man bestimmte Opfer bringt, die eigene Seele durchschauen, hätte man im Innersten sie zu unterschreiben kaum den Mut? Denkst Du nicht auch so, mein armer Freund? Ich beschwöre Dich, zumindest Deine Gedanken zu zerstreuen. Dein Glück ist mir weit mehr als das meine! Großer Gott, mit welchem Preise wollte ich es doch erkaufen, wenn ich etwas besäße.
Orléans, 8. Mai 1839.
Niemals werde ich Dir die Schönheit der Kathedrale wiedergeben können; man verläßt sie nur, um sie dann von außen zu bewundern. Wie bedaure ich es, daß Du nicht da bist, um mich zu begleiten! Wie schade, daß ich nicht zeichnen kann, um Dir eine Idee von diesem herrlichen Schiff zu geben, dessen Segel durchbrochene Flügel sind, wie ungefähr jene, die den Dom von Mailand in die Höhe erheben. Wie rasch die Zeit vergeht, und sie entflieht mir mit Dir.
Orléans, den 14. Mai 1839.
Bei aller Freude über Dein mir so wohltuendes Lob — es wird der einzige Erfolg meines Buches sein — erweckst Du mir mit der Frage, ob ich es störend empfände, Deine Frau zu sein, tiefen Kummer. Höre, Valmore, ich bin außer mir, daß Du mich für ein so oberflächliches und niedriges Geschöpf hältst. Mir ehrgeizige Absichten, Habgier oder Verlangen nach weltlichen Genüssen zuzuschreiben —, es zerreißt mir das Herz, das nur von Dir erfüllt ist und dem Wunsche, Dich glücklich zu sehen. Ich würde Dir mit Freuden in die Tiefen des Gefängnisses oder in die Fremde folgen. Das weißt Du, und diese Gedanken befallen Dich zu meinem Schmerz immer nur nach der Lektüre des elenden Gestammels, dessen ich mich schäme, wenn ich es mit den schönen Werken vergleiche, die Dein Geschmack mich schätzen gelehrt hat. Nunmehr sage ich Dir aufrichtig und vor Gott, daß es auf Erden keinen Menschen gibt, dem ich durch die Bande verknüpft sein möchte, die uns einen. Der Charakter aller andern flößt mir nur Entsetzen ein. Habe ich es Dir nicht oft genug gesagt, um Dich zu überzeugen? Doch ach! es ist also wahr: man kann dem andern nicht ins Herz sehen.
Paris, den 23. Juni 1839.
Wenn Du in dem bißchen Talent, dessen Ausübung ich verabscheue, nun nach Beweisen suchst, die Deine Vernunft irreführen, wohin kann ich mein Herz dann flüchten? Es ist ausschließlich Dein. Die Dichtkunst ist ein schreckliches Ungeheuer, wenn sie meine einzige Glückseligkeit, unsere Vereinigung zerstört. Ich habe Dir hundertmal gesagt, und ich wiederhole es hier, daß ich viele Elegieen und Romanzen auf Bestellung geschrieben habe, deren Thema gegeben war und von denen manche nicht bestimmt waren, ans Licht gezogen zu werden. Unsere elende Lage erforderte es anders. Wie viele Tränen und Klagen Paulinens haben sich in diese Verse gewandelt, die Du liebst, und deren Urheber eigentlich sie ist. Unser Leben aber war so einsam, so auf sich selbst gestellt und hastend, daß ich, wie ich Dir gestehe, der Zusammenstellung dieser Bücher, die unser Geschick uns zu verkaufen zwingt, keine allzu große Aufmerksamkeit gewidmet habe. All Deine Nachsicht für eine Begabung — die ich völlig geringschätzen würde, ohne den Wert, den Dein Gefallen ihr beimißt, kann mich nicht über eine heimliche und peinliche Erkenntnis trösten, die dadurch in mir entstanden ist. Molière hatte recht, Rousseau sprach die Wahrheit, und Mademoiselle Lenormand war also wirklich hellsehend, als sie mir in orakelhaftem Ton sagte: „Schreiben Sie nie!“ Du siehst nun wohl, daß ich recht habe, mein guter Freund, wenn ich auch nicht den Schatten von Befriedigung verspüre, soviel Papier bekritzelt zu haben, anstatt unsere Hemden zu nähen; obschon ich mich bemüht habe, auch diese in Ordnung zu halten; Du weißt das, Du teurer Gefährte eines Lebens, das niemandem zur Last gefallen ist.
Paris, 10. Juli 1839.
Wie liebe ich Dich, bei der Vorstellung, wie Du Dir Deine Kappe nähst! Welch merkwürdige Biographie würde man von uns machen, wenn man uns in all unserer beherzten Armut erblickte!
28. Juli 1839.
Sag niemandem, wann ich ankommen werde, damit wir allein bleiben, einen Tag wenigstens! Sag mir, mein guter Engel, hast Du ein Kanapee, um Dich während des Tages ausstrecken zu können? Ich denke fortwährend daran, Du mein armer Freund! Herrgott, was ersinne ich nicht alles, Dir zu schenken!...
Paris, 2. August 1839.
Ach, nein! Du nörgelst ja nicht, und ich verstehe, daß Deine Bemerkungen alle und immer aus einer anbetungswürdigen Quelle von Zartgefühl stammen, wie sie sich selten findet...
Ich liebe Dich! und überdies achte ich Dich leidenschaftlich.
2. August 1839.
Du siehst, ich fordere niemals als Erste unsere Kinder auf, Dir zu schreiben, in dieser Hinsicht habe ich denselben Herzensstolz. Ich warte. Nein, nein, ich setze nichts auf Erden neben unser Gefühl füreinander. Ich mache mir keine Illusionen mehr, dennoch glaube ich zutiefst an das Herz Hippolytes; es ist für immer an das unsere angewurzelt.
Paris, den 13. August 1839.
Alle (Menschen), die ich jetzt kenne, flößen mir nur noch mehr Zärtlichkeit für Dich ein! Bedurfte es unserer Trennung, damit wir uns noch mehr lieben? Gute Nacht, lieber Prosper! Ich gehe zur Ruhe, das Herz erfüllt von Dir, schlafe wohl. Liebe mich, die ich Dich einzig liebe.
Paris, 8. November 1839.
Oh! Mein lieber Freund, warum willst Du nicht mehr lachen. Überlaß diesen Ernst den Bösen. Das Leben hat Anmut und Sonne, solange es Liebe hat. Wer hat dies nur gesagt: „Nichts bleibt vom Leben, wenn nicht dies: geliebt zu haben.“ Wird in dem Sinne nicht Deine Hand den Druck der meinen erwidern können?
Paris, 25. November 1839.
Wir vermuten bei unseren Kindern tiefere Wurzeln, als sie jeweils an bestimmten Orten besitzen: Überall ist in diesem Alter das Glück. Inès ist augenblicklich ganz Musik, Schneiderei und Englischstudium und auf diese Weise also geordneter Beschäftigung hingegeben... Die Hauptsache ist, daß sie Dich und mich sehr lieb haben, was wir in diesem stürmischen Alter zu sehr vergessen.
Paris, den 25. November 1839.
... Eines bedenke wohl —, es soll Dir beistehen im Kampfe gegen Dich selbst, wenn Du Dich in Deinen Gram vergräbst —, bedenke, daß meine Gesundheit in Deinen Händen liegt. Wenn die Deinige wankend wird, bekomme ich Fieber, und wenn Deine Seele herabgestimmt ist, so sinkt die meine gleich noch tiefer. Wir haben einer beim andern so viel durchgemacht, daß wir wie Zwillinge geworden sind.
Paris, 3. Dezember 1839.
Ich habe einige schlechte Tage und, wie Du, recht traurige Nächte verbracht. Diese Jahreszeit gibt einem keinerlei Möglichkeit, Mut zu bewahren. Die Kraft, die mir von außen kommt, ist, wie Du weißt, die Sonne. Sehe ich sie nicht mehr, fühle ich sie nicht über Dir, glaube ich mich vom Schicksal, das Dich mißhandelt, noch ärger verlassen, denn ich weiß, wie empfindlich Du gegen die Grausamkeit des Winters bist, mein armer Freund!...
(Paris,) den 12. Januar 1840.
Ich muß wieder bei Dir sein; weißt Du das? Begreifst Du das? Ich bin mir selber unerträglich geworden, und meine Seele ist nirgends mehr dabei, wohin ich meinen Körper hinzugehen zwinge, um der Fülle von Verpflichtungen zu genügen, deren Hohlheit und Anstrengung Du kennst. Es war ein zu aufreibender Monat. Manchmal bleibe ich auf der Straße oder auf einer Treppe stehen und weine, weil ich Dich so fern weiß und so gebunden, wie auch ich es bin. Dieser Kampf muß aufhören... „Geduld, steig wieder auf zum Himmel!“ Wenn ich weiß, daß ich Dich wiederfinde bei der Heimkehr — wie trotze ich dann allen Plagen, aller Müdigkeit, den Widerwärtigkeiten aller Art, denen ich jetzt ohne jeden Trost ausgeliefert bin! Diese tyrannischen Kindereien quälen mich abscheulich, lieber Junge; ich finde, daß sie wie zum Hohn unser Elend begleiten. Ich bin so sehr der Sklave dieser gleichgültigen Leute, daß ich noch dahin kommen werde, sie zu hassen, weil sie in ihrer Belanglosigkeit mit ihren Visitenkarten und ihren Briefen sich zwischen uns drängen, so daß ich mir vorkomme wie ein „bekannter“ Schriftsteller. Die übrige Zeit stehe ich mit gekreuzten Armen vor der Nichtigkeit meiner erlahmten Gedanken. Ich kann keine vernünftige Arbeit beginnen noch fortführen. Da hast Du meinen Seelenzustand: Nähen, Schreiben, Umherlaufen, von Herzen weinen, mir mit Entsetzen vorhalten, daß ich nicht die Hälfte der Anforderungen erfülle, die von allen Seiten an mich herantreten — so verbringe ich meine Tage! Ich werde Dir später erzählen, welche Heuschreckenplage auf meine Wege niedergegangen ist, falls ich mich später noch an alles das erinnern kann. Inzwischen beklage mich, die ich weder morgens noch abends Deine Hände, Deine Augen finde, um mich aufrecht zu halten und mich zu grüßen! Es war eine heroische Tat, daß wir uns trennten, ich erfahre es an meiner allzu schmerzlichen Niedergeschlagenheit!
Paris, 5. März 1840.
Es ist wirklich wahr! es ist wirklich wahr! Wenn Du es in den Zeitungen liest, noch ehe meine Freude hier es Dir kündet, so glaube daran und laß uns gemeinsam für diese Gnade danken, die die Vorsehung über uns ausschüttet. Ich erhalte soeben, Donnerstag mittag, das Dekret des Ministers, Herrn Villemains, der mir, ehe er aus dem Ministerium scheidet, eine unerwartete Wohltat erweist. Er hat meine vorübergehende Pension von dreihundert Franken auf zwölfhundert Franken lebenslänglich erhöht. Ich fühle mich von einer Freude erschüttert, die zu rein ist, als daß sie nicht von jener unsichtbaren Macht herkäme, die mich in allen meinen Kümmernissen aufrecht hält. O mein Freund, glaube mit mir! Teile die Gabe und den Glauben mit der Gefährtin Deines geliebten Lebens und sorge Dich nicht um die Zukunft, die sich so angenehm ankündigt... Oh! wie gern möchte ich Dich küssen! Und Dich zufrieden sehen, mein lieber Prosper! Ich schreibe in Eile.
Paris, den 27. August 1840, 2 Uhr.
Wie weh hat mir Dein letzter Brief getan, Prosper! Warum bist Du dermaßen traurig über die Vergangenheit? Warum Dich über Dinge quälen, die nicht mehr sind, und einem Dich beschämenden Kummer hingeben, dessen Kenntnis Du mir bisher erspart hattest? Wäre es nicht ein Wunder zu nennen, wenn Du den Versuchungen entgangen wärest, die glühende Jugend und die reichliche Gelegenheit unseres Berufes Dir boten. Du bist unbedingt der ehrenhafteste Mensch von der Welt, und ich möchte, daß Du ein für allemal diese Zufälligkeiten, die Du nicht gesucht hast und die der Unverletzlichkeit unseres Bündnisses keinerlei Schaden getan haben, nach ihrem wahren Wert beurteilst. Laß also jene Tage des Leichtsinns ruhen; sie sind durch die Anschauungen, die unsere Zeit uns eingeimpft, wohl unvermeidlich. Laß uns nicht strenger urteilen als Gott selber und seine guten Priester, die ihre reuigen Kinder aufrichten und umarmen. Ich verdenke es niemandem, Dich liebenswert gefunden zu haben, mein teurer Gemahl. Mußte man nicht mir verzeihen, Deine Frau zu sein und — offen gesagt — ein solches Glück gar nicht zu verdienen? Doch diese Verbindung war im Himmel beschlossen, von Deinem Vater und unseren Freunden gerne gesehen; und wie bin ich dankbar, daß sie mich wählten, denn wie liebte ich Dich! Und findest Du, daß ich Dich nicht mehr mit allen Fähigkeiten meiner Seele liebe? Sei meiner gewiß, lieber Freund, im Leben wie im Tode, und nimm meinen tätigen Dank für die Innigkeit hin, mit der Du die meinige erwiderst. Nichts in der Welt kann meine Gefühle ändern, und ich folge Dir mit Freuden überallhin, wo Gott uns gütig gewährt, ein gemeinsames Dasein zu führen. Ich beschwöre Dich, hierin den vollen Ausgleich einer Vergangenheit zu sehen, deren trübe Träume für mich nicht mehr bestehen. Ich bitte Dich, sie Deinerseits mit Nachsicht zu behandeln und nichts von dem zu hassen, was Dir einst Liebe gegeben hat...
*
| AN IHRE TOCHTER ONDINE | Paris, 30. August 1840. |
Komm, mein Kind, damit ich Dir Liebe spenden, Dich in die Arme schließen kann! Wie recht hast Du getan, Dich in dieser Verwirrung, über die ich mich ebenso wundere wie Du, an mich zu wenden! Du hast Dein Herz erleichtert, und ich eile Dir zu Hilfe... Die Zukunft allein — und vor allem eine Trennung — kann Dir deutlich zeigen, wie es um Dich steht. In Deinem Alter durchkreist ein unendliches Bedürfnis nach Liebe unser Blut und unser Herz. Es ist oft unvermeidlich, daß man sich in seiner Wahl irrt, die man stets dem „unabänderlichen“ Schicksal zuschreibt. Mein liebes Herz, in Deinem Alter vor allem ist es wichtig, Dir den Irrtum zu nehmen und Dich aufmerksam zu machen, gegen vorübergehende Gemütsbewegungen auf der Hut zu sein, die so viele reine und ehrbare Herzen täuschen. Man sagt: „Diese neue und seltsame Verwirrung beweist mir, daß er es ist, auf den meine Liebe gewartet hat!“ ... Mein liebes Kind, vertraue meinem innigen Rat, Du würdest Dich täuschen und in aller Unschuld andere täuschen. Gehe den Gelegenheiten, die solche Versuchungen herbeiführen könnten, aus dem Wege. Im übrigen wirst Du sehen, daß ein junger Mann, sei er noch so schüchtern, zurückhaltend, noch so rein, sobald er seinem Instinkt gehorcht, dennoch recht kühn ist. Daher die vielen unüberlegten Bündnisse, die so oft zwei übereilt aneinander gekettete Existenzen unglücklich machen. Solche Träume muß man teuer bezahlen! Und das Leben ist lang für den, der erwacht ist. Glaube mir, die Freude zu gefallen begleitet stets solche Erschütterungen, selbst wenn eine Enttäuschung alle Hoffnungen eines jungen Kindes vernichtet hat.
Die Frauen tun am klügsten, einem derartigen bei den Männern sehr beliebten Ansturm nicht zu viel Wert beizumessen und sich schamhaft davor zu schützen, ohne Schrecken oder Kummer zu empfinden und ohne sich übertriebene Selbstvorwürfe zu machen. Du darfst keinen ermuntern. Bleibe klug und unbefangen. Laß Dich nicht von einem trügerischen Mitleid für jene befallen, die Du anscheinend unglücklich gemacht hast. Ist ein junger Mann von wahrer Liebe ergriffen, von einer Liebe, die Bestand hat, so sei überzeugt, daß er sich an die Eltern wendet, wenn nicht, so ist es ein wenig ehrenvolles Spiel, das er mit unserer Schwachheit treibt, und Gott weiß, was daraus entsteht.
Flüchte Dich zu mir, nur zu mir! Mein Herz gehört Dir: es ist voller Nachsicht mit Dir — mehr als Du selbst —, aber es ist auch voll Klarheit, und Du hast nichts zu fürchten, solange Du Dich an mich hältst, selbst in der Ferne nicht.
| AN VALMORE | Paris, 20. September 1840, morgens. |
Dies ist einmal ein dicker Brief! Sag mir, ob er Dich viel gekostet hat. Bist Du nicht durch so viel Porti ruiniert? Vergiß nicht morgens Schokolade zu nehmen. Oh, wie gerne möchte ich sie Dir zubereiten.
Paris, 25. September 1840.
... Ich kehre von der Hochzeitsmesse heim, während der ich nur Dich sah. Welch süße und schreckliche Gemütsbewegungen harren doch unser im Leben, in der Trennung! Was für Wünsche und was für Erinnerungen habe ich doch Gott in meinem Gebet für diesen guten Charpentier dargebracht; ich habe recht geweint. Und Dich geliebt! Ach Du! Ich bin ganz Dein.
Paris, 4. Oktober 1840.
Sonntag ist es und traurig, mein lieber Freund! Dieser Tag hat für Dich und mich dieses Vorrecht. Die Heilige Schrift sagt: „und die da weinen am Tage des Herrn, werden getröstet sein.“ Die Heilige Schrift sei bedankt, sie verheißt uns viel Glück.
Paris, 4. Oktober 1840.
Ach, ich vergaß einen Augenblick lang, Dich zu trösten, verzeih mir! ich bin ganz niedergeschlagen in der Erinnerung an das, was Du schreibst. Es gibt nichts Ärgeres als unwürdige Richter. Geist vermag ein wenig dafür zu entschädigen, gehaßt oder verfolgt zu werden. Da gibt man sich zumindest über das Ausmaß der zugefügten Kränkung Rechenschaft, aber ein literarisches Hornvieh schreibt mit unserem eigenen Blut und glaubt, es sei Tinte...
*
| AN IHRE KINDER | Brüssel, 1. November 1840, 10 Uhr abends. |
Meine geliebten Seelen, ich schreibe euch, und alle Glocken Brüssels läuten dazu. Es ist ein einiges Geläut für die Heiligen und die Toten. Kein Pariser kann sich eine Vorstellung von diesen Feierlichkeiten machen, die hier Himmel und Erde in Bewegung setzen. Die Kirchen, die wir uns angesehen haben, waren voller Frauen mit flandrischem Kopfputz, jenem Seidentuch, das bis auf die Füße fällt. Die Kirchen wirken so ganz italienisch, daß ich gar zu gerne wünschte, ihr könntet sie sehen. Hippolyte wäre begeistert. Wir haben heute die Mutter Gottes und das Jesuskind schwarz verhüllt gesehen. Diese Gebräuche bestürmen mein Herz mit tausend Erinnerungen. Sie sind ganz kunstlos, aber das Andenken an meinen ersten süßen Glauben macht, daß ich die starren rosenbestickten Schleier und die steifen Blumenkränze, denen selbst der heftigste Sturmwind kein Blättchen entreißen könnte, anbeten muß.
Ich muß euch von einer Gemäldesammlung berichten, die wir gestern beim Herzog von Arenberg gesehen haben. Welch schweigende Pracht! Welch strahlende feierliche Einsamkeit! Eine Fülle von Rubens, seine beiden Frauen, die sein Pinsel lebenswarm gestaltet hat, er selbst, von eigener Hand gemalt; man meint, die Lippen bewegten sich! Wahrhaftig, hier ist das Refugium der Malerei, man spürt, daß sie wie eine tiefe Religion verehrt wird, ohne viele Worte. Doch was werdet ihr sagen, wenn ihr hört, daß wir den wahren Kopf des Laokoon gesehen haben, den der Herzog von Arenberg für hundertsechzigtausend Franken gekauft hat? Wenn ich tausend Jahre lebte, könnte ich dies Wunderwerk nicht vergessen, das mich nicht mehr losläßt. Dieses von Schmerz und bittern Selbstvorwürfen wie überströmte Haupt! Die Venezianer haben es bei ihren Ausgrabungen gefunden, lange nach der Entdeckung der wundervollen Gruppe, deren eigentlicher Kopf nie gefunden worden war. Sein Anblick ist herzzerreißend, und man erwartet, den in Seelenqual weit aufgerissenen Mund aufschreien zu hören. Der Anblick der freiliegenden Zahnreihen, ganz ohne Verzerrung, trägt viel zu dem martervollen Eindruck bei. Es ist kein Greis, wie bei der Gruppe, sondern ein Mann in der Kraft und Schönheit seiner Jahre. Er weint, wie ich nie Marmor weinen sah, wie man fühlt, daß nur ein Vater weinen kann, der seine Kinder rettungslos verloren sieht. Hippolyte hat einmal die Beobachtung gemacht, daß diese recht jung aussehen, als Kinder eines solchen Greises. Er würde hier mit Begeisterung sehen, wie gut ihre Jugend zu seinen Jahren paßt. Sie dürften fünfzehn Jahre alt sein. — Doch was erzähle ich da! Alles, was ich darüber sage, ist so blaß, daß es mehr Sinn hat, zu unserer Wirklichkeit zurückzukehren.
*
| AN VALMORE | Douai, 9. November 1840. |
Es gelang mir nicht, das Fenster der Wagentüre herabzulassen, die uns trennte, um Dir noch einmal die Hand zu drücken. Ich gestehe Dir, daß es mir ein trautes Gefühl war, Dich mit einer Person zu wissen, die ich nicht mehr als Fremden betrachten kann. Es war wenigstens kein kaltes Herz, das neben dem Deinen schlug, mein lieber Mann.
Mit großer Bewegung habe ich die Glocken läuten hören, die einst für meinen Vater und meine Mutter die Stunden geschlagen. Von weitem sehe ich den Eingang zu unserer Gasse... Innige Erinnerung ist der unfehlbarste Garant der Unsterblichkeit. Wie werden doch wir beide Seite an Seite durch sie schreiten! Wir haben so viel in dieser Sparkasse angelegt! Ich umarme Dich, mein guter Engel, und ich trenne mich nicht mehr von Dir, als ob Du im Nebenzimmer wärest.
15. Dezember 1840.
Du glaubst es wohl, daß ich zu jeder Stunde ein zartes und trauriges Entbehren empfinde, Dich nicht zu jeder Zeit um mich zu haben; selbst um mich anzukleiden, was Du oft mit einer Güte tatest, die mich rührt und mir durch und durch geht, o Du!
*
| AN IHRE TOCHTER ONDINE | Paris, 26. August 1841. |
Ich will Dir nicht sagen, was ich empfand, als ich Dich wegfahren sah, und am folgenden Tag, mein guter Engel. Dein Brief hat mir so viel Glück gebracht, daß ich mich nicht beklagen darf, es mir erkauft zu haben... Line, ich hab Dich lieb, ich liebe alles, was Dich glücklich macht... Das Meer bedeutet Dir dasselbe, was es mir gewesen ist. Du hast es wiedererkannt, weil Du es mit meinen Augen gesehen hast, als ich ungefähr in Deinem Alter war. Bist Du denn nicht seit damals in einem Winkel meines Selbst verborgen? Ich habe viele Jahre gebraucht, um Dich in die Welt zu setzen. Wir sind ja nur eins, mein Kind, zwei geworden durch Gottes Willen. Deshalb beklage ich es immer, Dich nicht nahe genug zu fühlen. Wie glücklich aber bin ich, daß Du dies Meer liebst. Es wird Dir die Gesundheit wiedergeben, dessen bin ich gewiß...
*
| AN VALMORE | Orléans, 16. Jänner 1842. |
... Ich habe die Kathedrale wieder gesehen. Überall, wo es etwas Schönes gibt, umschweben mich Deine Gedanken. Du hast meine Bewunderung für all das sehr entwickelt. Italien hat mir einen Schleier vom Auge genommen. Ich erbitte von Gott immer dies: leben zu können, um Dich zu lieben und seine Werke zu bewundern.
16. Mai 1846.
Warum liest Du die Künsteleien, die ich geschrieben habe. Solange dieses Ärgernis währt, von dem ich Dich so gerne heilte, ist das weder klug noch gesund. Nein, ich habe nicht all das gelitten, was diese Seiten erzählen. Ich werde Dir Briefe von unserer armen Pauline zeigen, die mir als Text zu den Elegieen gedient haben, deren Grundempfinden allerdings in meiner Veranlagung vorhanden waren. Die Gemütsbewegungen, von denen sie mir erzählte, formte ich zu Versen; auch ich habe solche erlebt, aber bedaure mich nicht wegen all dieser, die Du mit Rührung liest; und dann, mein Vielgeliebter, diese traurigen Vögel haben sanftem Seelenfrieden den Platz geräumt. Ernsteres Mißgeschick hat aus Dir und mir eine Beute gemacht, die sich weniger harmonisch ausnimmt. Wenn ich aber von dem Schrecken des Elends, das wir seit einem Jahre erleiden, absehe, würde ich mich als die glücklichste aller Frauen fühlen.
Paris, 17. Juni 1846.
Niemals habe ich mehr in Erwartung gelebt — zu leben. Es ist, als ob ich mich in einer Herberge befände, an irgendeiner großen Landstraße, und ausschaute, ob die Pferde kommen. Zumindest erhellt die Sonne das Warten. Du weißt, für mich ist sie die Lampe des Paradieses, und ich sehe Dich durch dieses schöne Licht, das alle Schatten meines Lebens schwinden läßt.
Paris, den 12. September 1846.
Ich erhalte Deinen lieben Brief vom 10. Ich möchte sogleich auf alle Deine Fragen Antwort geben, um Dein Herz zu beruhigen. Die immer wesentliche Frage ist wohl die, von Paris fortzuziehen, dessen ich zehntausendmal müder bin als Du. Du hast mich in dieser Hinsicht nicht richtig beurteilt; ich habe es immer verabscheut. So kann Wahrheit nie den ersten falschen Eindruck auslöschen? Ich habe aus Pflichtbewußtsein, aus Mutterliebe, aus Liebe für Dich diese Stadt den abenteuerlichen Reisen, den Fehlschlägen in der Provinz vorgezogen. Doch ein sicheres Heim — wo immer es sei und fern von Intrigen und Mißverständnissen, dem falschen Schein, dem grauenhaften Antichambrieren — einen Blumentopf am Fenster und Dich zufrieden im bescheidensten Häuschen, — das allein würde mir allzeit zu meinem inneren Glück genügen. — Ich habe nicht fälschlich, noch leichthin, noch um des Reimes willen gesagt: „Ich bin nicht für die laute Welt.“ Ich habe die Wahrheit gesagt. Paris wäre mir nur dann erträglich gewesen, wenn ich euch alle zufrieden gesehen hätte. Das sage ich vor Gott.
Paris, 29. Oktober 1846.
Ich würde mir große Vorwürfe machen, wenn ich Dich wissen ließe, welche Martern mich hier Tag und Nacht zerreißen; doch hast Du nicht alles erraten? Weißt Du es nicht, daß ich wirklich und seit langem nur darum noch Hoffnung habe für dieses geliebte Kind, weil Gott groß ist und sich zuweilen von glühenden Gebeten erweichen läßt? Aber weder die Ärzte, die ich befrage, noch sonst etwas auf Erden könnte mich blind machen gegen die ungeheure Gefahr dieser verhängnisvollen Krankheit. Erwäge nun, welche Schrecken meine einsamen Nächte mir gebracht haben, und Du wirst entsetzt sein oder doch überzeugt von meinem wahren Mut und meiner tiefen Liebe zu euch allen, denen ich meine Verzweiflung fern zu halten suche, wirst überzeugt sein von meinem heiligen Bestreben, meine zugleich geliebte und schreckliche Mission zu erfüllen, ohne von euch zu verlangen, daß ihr allzusehr die Qualen mit mir teilt. Darum habe ich Dein Fernsein mit mehr als Entsagung ertragen, darum Ondine zu Dir gesandt; sie ist zu zart für solche Prüfungen. Du weißt alles. Ich verlange also nichts von unserm prächtigen Doktor Veyne, als was er mir geben kann und gerne gibt: seine Gegenwart. Er tut in jeder Weise seine Pflicht: wenn er ohne Hoffnung ist, so sagt er es mir nicht. Er kommt! Dafür segne ich ihn. Du weißt, daß ich mich über die Wissenschaft der Ärzte keiner tröstlichen Täuschung hingebe. Ich glaube an Gott. Wenn er mich schlägt, so weiß ich dennoch, daß es Gott ist, und ich preise ihn dafür. Ich habe Dich unsagbar lieb! Das Verlangen Deines oft so traurigen Herzens nach der glühenden Zuneigung des meinigen ist mir immer gegenwärtig. Ich gebe um Deinetwillen treulich acht auf meine Gesundheit, und ich küsse Dich! Hundertmal am Tag!
Paris, den 18. November 1846.
Ich küsse Dich von ganzer Seele! Mitten durch die Winterdunkelheit komme ich zu Dir, um Deine Einsamkeit zu trösten und aufzuatmen von dieser harten Trennung, die so entsetzlich ist, daß ich sie ertrage, ohne mir doch vorstellen zu können, daß es möglich sei, sie zu ertragen.
Es wollte heute gar nicht Tag werden. Alle Zimmer waren voll schwerer giftiger Nebel, denn die nachbarlichen Kamine speien ihre Rauchfluten über uns aus. Man hat nicht einmal das Behagen einer warmen Kaminecke, denn man muß Fenster und Türen aufreißen. Ich spreche Dir von all diesen häuslichen Kleinigkeiten, weil ich mich nicht entschließen kann, Dein Herz mit den Einzelheiten einer Krankheit zu betrüben, die uns alle wie angebunden hält und unter dem beständigen Druck der unerwartetsten Ereignisse. Der häufige Schlaf, der oft gewaltige Appetit vermögen nicht die verschiedenen Leiden des lieben Kindes zu lindern. Ihr Widerstreben gegen den so guten Arzt, gegen die Mittel, die er verordnet, zeigt sich von betrübender Heftigkeit. Sie entwickelt dann eine Kraft und Willensstärke, die mich geradezu verwirrt. Wir haben den Vormittag dazu benutzt, ihr Zimmer durch meinen Schreibsekretär zu verschönen, nebst einem Fauteuil, den sie sich schon seit Tagen mit glühender Freude wünschte. Was ihr aber aufs heftigste mißfällt, das ist das Bett Ondinens, darin ich nun bei ihr Nachtwache halte. Armes eifersüchtiges Kind, sie läßt sich ganz hinreißen von ihrer Abneigung gegen die Schwester. Herr Veyne sagte mir gestern, wenn die gegenwärtige Krisis überstanden sei, so werde sie wieder vernünftig werden. Sonderbare Sache! Diese Krankheit ist so eigentümlich veränderlich! Oft spricht sie mit ihrer natürlichen Stimme und ißt, als sei sie ganz wohl; überdies schläft sie besser, als seit drei Jahren. Gott ist so groß, so mächtig, daß ich alle diese Dinge mitansehe, als lebte ich zur Zeit des Lazarus. Doch ich würde mich gern in Deine Arme schmiegen, die mich so oft beschützt haben, mein lieber, mein geliebter Mann! Du herrlicher Vater eines herrlichen Sohnes! Segne mit mir dieses unsägliche Glück, diesen unwiderleglichen Beweis von der Liebe Gottes. Er ist wie ein Freudenfeuer zwischen uns, um die schlimmen Wege zu erhellen.
... Herr Balzac hat gestern einen sehr herzlichen Brief an unsere kleine Kranke geschrieben, hat ihr Früchte, Wein und Blumen gesandt und ihr mitgeteilt, daß er alles daransetzen werde, um Dich ganz ernstlich uns wieder zuzuführen. Möge der Himmel ihm beistehen!
1847.
Meine armen, nach Dir ausgespannten Schwingen müssen sich jeden Augenblick rückwärts wenden. Ich finde nur dann Ruhe und Aufatmen, wenn dies liebe kleine Mädchen mich aufatmen läßt. Gestern ist sie mit unbeschreiblichem Entzücken von ein Uhr bis halb neun Uhr aufgewesen. Herr Veyne ist verblüfft. Sie schläft und ißt gut. Ich sage Dir, für den Zuschauer ist es wie ein Wunder. Herr Blanchet, gesprächiger als unser Arzt, hat mir über die Phänomene dieser Krankheit Dinge gesagt, die den Verstand verwirren können. Was mich betrifft, so wandle ich mit geschlossenen Augen unter einem Willen, der stärker ist als der meine!
Ich habe heute keine Neuigkeiten für Dich. Die schlechten — daran hast Du nur allzu viele! Die guten sind aber selten.
*
| NACH DEM TOD IHRES KINDES | Paris, den 20. Februar 1847. |
Mein Freund! Da von allen auf der Erde Du allein, nur Du allein mich trösten kannst, so bitte ich Dich darum bei allen Kümmernissen der Vergangenheit, bei meinem entschlossenen und unerschütterlichen Willen, aus Liebe zu Dir allem standzuhalten; ich verlange tausendmal mehr als mein Leben, ich fordere, daß Du mich liebst! Du hast nur eine Möglichkeit, mir das zu beweisen, mein lieber Freund, nämlich die, diese kurze Wartezeit beherzt mit mir gemeinsam durchzuhalten und nun für mich zu tun, was ich für Dich getan habe, weil Du für mich alles: Freund, Geliebter, Gatte, Bruder, Vater und Kind bist. Dies gesagt, dies aus tiefstem Innern uns zugeschworen, erbitte ich von Dir die einzige Sicherung, an die ich glaube, die mir genügen und mich wieder aufleben lassen wird, aber gib sie mir! Dein Wort, mir zu gehören, wie ich Dir gehöre, für uns beide und die geliebten Wesen, die Dich lieben und anbeten, weiterzuleben und ihnen statt einer grausigen eine ungetrübte Zukunft zu bereiten. Bei dem Andenken an unser heiliges totes Kind — mußt Du nicht weinen über den Sturm, der mich schüttelt? Wirst Du mich nicht ans Herz schließen und mich glücklich machen durch dieses Ehrenwort, das ich von Dir erbitte und das die wahre Ehre Dich verpflichtet mir zu geben? Zögere nicht! Ich glaube an Gott im Himmel und an Dich auf Erden!
Beim Durchlesen Deines Briefes, mein Guter, sehe ich, daß Du an meinem festen Willen zu zweifeln scheinst, uns gemeinsam einzuschränken, diese Abzahlungen zu erreichen. Du selbst kannst nicht eifriger wünschen, die Schulden zu tilgen, wie ich, und ich arbeite alle Tage daran. Merk nur auf und schenk mir das gleiche Vertrauen, das Du zu Vater und Mutter haben würdest. Ich werde Dir alles aufrichtig mitteilen, und dann werden wir beide einmütig das tun, was Du, zu unserer Herzensruhe für das beste hältst. O wären unsere Herzen doch eins! Verlaß mich nicht! Vergib mir, wenn ich irgendeine Zärtlichkeit unterlassen, wenn ich Dir nicht genug gesagt habe, daß ich überall hingehen würde, aber mit Dir! Wie! Noch fühle ich lebendig Deine letzten Küsse, und Du schreibst mir das? Du, so gut, so edelmütig, so herzergeben? Großer Gott! Was würdest Du sagen, wenn ich oder Dein Sohn Dir so etwas schriebe! Du würdest es nicht glauben. Du hast also nicht bedacht, daß ich Dir überallhin folgen würde!... Und was tat ich sonst, als nur Dich lieben, was ließ Dich glauben, ich würde zurückbleiben... Ach! es ist das erstemal, daß Du mir das Herz zerreißt. Und schließlich, beachte das wohl: ich ertrage alles mit Dir, aber nichts ohne Dich! — Also, lieber Geliebter, komm zurück zu mir, beginn nicht wieder den Brüsseler Leidensweg, oder laß mich neues Leben finden, indem ich Dich dorthin begleite. Ich beschwöre Dich um das eine oder andere! Dein Wille entscheide sich für mein Glück.
Sag! Bedeutet es Dir nichts, mir das Leben zu retten? Es ist in Deiner Hand, und ich glaubte, Du habest gefühlt, welche Anstrengungen es mich nach dem furchtbaren Schlag kostete, mich für Dich zu erhalten. Du, der ehrenhafteste Mann, den ich kenne, Du bedenkst also nicht, daß Du durch eine falsche Art zu sehen aufhören würdest, ein Ehrenmann zu sein, denn eine grauenhafte Tat von uns beiden würde nichts gutmachen und würde unsere Kinder ins tiefste Elend stürzen, von ihrer Verzweiflung ganz zu schweigen. In welch sonderbarer grausamen Stimmung hast Du mir geschrieben? Du, der Du sonst schon zitterst, wenn ich nur in eine Diligence stieg, Du willst mich nun durch diese Preisgabe zerschmettern... Ach, ich bin Dein Weib, Dein armes Weib, und Du schuldest mir meinen Gatten, den ich auf den Knieen von Dir erbitte!
Ich sende Dir diesen Brief, ohne den Sonntag abzuwarten; ich möchte mit ihm forteilen, ich bin an Leib und Seele in solcher Verwirrung, daß ich mich nicht mehr zurechtfinde. Mein einziges Leben! Du, der Du um meinetwillen alles entbehrst, Du bist besorgt, mir zu wenig zu schicken! Du darfst in dieser Hinsicht beruhigt sein, ich habe alles, was wir brauchen, selbst für den Fall eines Umzugs. — Schreibe mir also hierher; was mich nicht mehr erreicht, wird nachgesandt. Frankiere nicht, ich kann das bezahlen.
Mit wie viel Sehnsucht erwarte ich Deine Antwort! Möge der Himmel und die Liebe Dir beistehen, Deiner Frau und innigen Gefährtin nicht das Leben zu nehmen.
Marceline Valmore
Ich habe manches zu sagen vergessen: hoffnungsvolle Schritte, Zukunftsaussichten. Ich sende Dir nur meine Seele! Stoße sie nicht zurück, Du tätest ein Verbrechen!
Paris, 25. Februar 1847.
Deinen letzten Brief trage ich auf meinem Herzen, wie Balsam für meine Wunden... Ein Wort und das Deine wiegt alle falschen Schwüre auf, die uns betrogen haben. Ah, es fällt mir leicht, allen zu verzeihen, wenn mein Leben auf Deine Zuverlässigkeit sich stützen kann.
13. September 1851.
Die Gewohnheit, zu Dir zu sprechen, wenn ich allein bin, macht, daß ich glaube, Du hättest mich gehört... so verlasse ich mich oft Dir gegenüber auf ein Wort und halte tausend zurück, die sich alsbald in Seufzer und Tränen verwandeln. Ja, oft weine ich das, was ich Dir nicht sage. Es ist nicht immer aus Trauer, mein Geliebter; die Liebe ist ja so reich an Gemütsbewegungen! Nimm alles von der Quelle, die Dein eigen ist; und wenn Du mir in Deiner Wahrhaftigkeit, an die ich glaube wie an Gott, sagst, daß Du Dein Leben von neuem mit mir wieder beginnen wolltest, so antworte ich Dir vor Gott, daß dies auch mein innigster Gedanke ist.
Die unaufhörliche Heimsuchung, der mit hinreißender Kraft des Herzens ertragene Jammer ihres Lebens wird aus den folgenden Briefen offenbar. Sie zeigen die Verzweiflung der ewig vom Schicksal Gehetzten und gleichzeitig das Wunderbare, wie inmitten ihres eigenen Leidens Marceline Desbordes-Valmore allem fremden Leiden hilfreich zur Seite stand. Es wäre leicht gewesen, solche Beispiele sowohl ihrer Not als ihrer Nothilfe noch zu vermehren, doch schildert sich in diesen wohl schon sichtbar die groß erduldete und zu reinster Humanität erhobene Tragik ihres heroischen Daseins.
*
| AN IHREN BRUDER | 5. September 1816. |
Ich müßte Dich täuschen, mein teurer Freund, wenn ich Dir sagte, daß dieses arme gebrochene Herz imstande sei, sich wieder an diese, nun für mich so traurige Welt zu binden. Nein nichts, nichts wird diese Leere ausfüllen, für die es gar keinen Ausdruck gibt, so groß ist die Niedergeschlagenheit, die sie mir bereitet. Nur dünkt mir, als ob meine Vernunft nicht mehr in Gefahr sei, sich gänzlich zu verwirren, wie man und ich selbst es fürchtete. Das Leben erscheint mir jetzt so lang, war es doch so grausam für mich! ... Nein, ich kann in Worten nicht wiedergeben, was mich schmerzt oder vielmehr den einzigen Schmerz, der Tag und Nacht auf meiner Brust und meinem zerrissenen Herzen lastet...
Papa befindet sich wohler... Wie wahr ist es doch, daß ich nur für ihn mich entschließen konnte, weiter beim Theater zu bleiben! Es ist das größte Opfer, das ich um der Vernunft willen jemals gebracht habe.
2. Jänner (lies 1817).
Ist es zu spät, mein teurer Felix, Dich mit aller Zärtlichkeit einer Schwester, einer Freundin zu umarmen? Alle Tage, alle Monate sind gleich für diejenigen, die einander lieben, und Du weißt, daß ich Dich von ganzem Herzen liebe. Gedulde Dich noch wegen meines Porträts, mein Freund, Du wirst es nunmehr bald besitzen. Wenn das Bildnis einer Schwester, eines unglücklichen Wesens, Deine Freundschaft befriedigen kann, wirst Du zufrieden sein. Dein Brief hat mich entzückt, Du scheinst über Dein Schicksal unbesorgt, und dies beruhigt ein wenig mein trauriges Herz, und ich hätte Dich dafür umarmen mögen, daß Du mir ein Gefühl vermittelt hast, das der Freude gleicht. Wenn das Gebet einer Seele, die nichts mehr für sich selbst zu verlangen hat, von Gott erhört wird, werden alle meine Verwandten, die ich mit so viel Innigkeit liebe, von den schmerzlichen und tiefen Leiden, die ich empfinde, frei sein. Es scheint mir, mein lieber Bruder, daß ich genug für mehrere leide... Welch ein Jahr ist eben für Deine arme Marceline hingegangen! — Und das, was es mir geraubt hat, wird mir niemals wiedergegeben sein, nein, niemals in dieser Welt. Ich muß das Ende einer für mich recht langen Reise abwarten! Mein armer Sohn, mein liebreizendes Kind hat mir allen Kummer leichter gemacht. Kein Kind hat es mehr verdient, von seiner unglücklichen Mutter zu jeder Stunde beweint zu werden. Erinnerst Du Dich seiner? Wie schön war er doch! Wie gut!
*
| AN DUTHILLOEUL[1] | Bordeaux, den 24. Mai 1826. |
Sie kennen jetzt einen meiner tiefsten Schmerzen. Das Los meines Bruders ist seit fünfzehn Jahren eine geheime und unheilbare Wunde für mich. Alle meine Anstrengungen, alle meine Tränen haben die verderblichen Folgen seines entscheidenden Schrittes ins Leben nicht abwenden können. Er hat sich mit vierzehn Jahren, um seinen bedürftigen Vater zu unterstützen, anwerben lassen und hat seine ganze Jugend im Kriege und in der Gefangenschaft auf den schottischen Pontons verbracht, und alle diese Dinge haben seine geistige und leibliche Gesundheit erschüttert. Wenngleich er mir einer der liebsten Menschen auf Erden ist, nicht nur weil ich ihn als Kind geliebt habe, sondern weil er gut und unglücklich ist, so wage ich doch nur mit Zagen, ihn dem Erbarmen braver Leute zu empfehlen. Er ist von langem Leiden geschwächt und unbeständig, die Erinnerung an so viel verlorene Hoffnungen, an die Demütigungen, denen er unterworfen gewesen, ergreifen ihn zuweilen mit solcher Heftigkeit, daß er in Verzweiflung erstickt und ziellos und schutzlos umherirrt. Monate lang weiß ich nicht, was aus ihm geworden ist, schreibe überallhin, verzehre mich in Unruhe, und schließlich erhalte ich einen Brief von ihm, in welchem er mich als seine einzige Freundin um Hilfe angeht. Das bin ich in Wahrheit, mein Herr, solange ich denken kann; aber ich bin machtlos, ihm das verlorene Glück zu ersetzen, das Glück, das oft gar nicht von uns selbst abhängt, sondern von einer völlig gegebenen Lage, die den Kindern von ihren Eltern vorbereitet wird.
... Ich, die ich selbst heimatlos bin und als Mutter von drei kleinen Kindern meinen Unterhalt der Arbeit meines Gatten verdanke, der wiederum für einen alten Vater, unseren ständigen Begleiter auf unsern Wanderreisen, zu sorgen hat, — Sie werden begreifen, mein Herr, daß mir nicht das Glück zuteil geworden ist, meinen armen Verwandten viel zukommen zu lassen. Ich sende meinem Bruder zwanzig Franken im Monat, was ihm, wie ich wenigstens hoffe, den Aufenthalt in einem Krankenhaus oder militärischen Hospiz ermöglichen könnte, bis meine Bemühungen, ihn im Hôtel des Invalides in Paris unterzubringen, einigen Erfolg haben. Nun scheint er das Hospiz verlassen zu haben, ohne weiteres abzuwarten, und ich bin von neuem in lebhafter Unruhe...
Man sagt, ich hätte eine Pension. Ich erhielt vom Minister einen Brief, der mir das anzeigte, man hat es sogar in den Zeitungen angezeigt; doch bis jetzt ist es nichts damit. Ich verdiene sie so wenig, habe sie weder erwünscht noch erbeten, so daß ich ihr Ausbleiben kaum beklagen kann. Ich erzähle Ihnen davon, mein Herr, damit Sie meine traurige Vermögenslage genau überblicken können. Vor vier Jahren bereits bin ich von jener Liste Pensionsberechtigter (in die das heimliche Wohlwollen irgendeines Mächtigen mich eingetragen) gestrichen worden, weil niemand vom Theater einer solchen Gunst teilhaftig werden kann.
Kurz und gut, mein Herr, wenn Sie durch Ihre gütige Unterstützung meinem unglücklichen Bruder einen kleinen Posten verschaffen könnten, den er in seinem fast gebrechlichen Zustand auszufüllen imstande wäre, so würden Sie mir einen unsagbaren Dienst erweisen, der mir eine große, dauernde Beruhigung wäre.
|
Zuerst Friedensrichter, dann Bibliothekar der Stadt Douai, hat sich, sovielmal er konnte, der unglücklichen Lage des Felix Desbordes angenommen. |
| AN CAROLINE BRANCHU | Lyon, 4. März 1830. |
Wie albern und martervoll ist doch die Politik! Er brauchte nur seine prinzliche Nase[1] zu zeigen, und alles wäre gut gegangen. Nein! Die Diplomatie und der Geist des Mißverstehens haben das Wort und machen Winkelzüge — natürlich falsche! Jetzt werden sich auch noch die Parteien erheben und sich in diesen Brotstreit mischen. Gott weiß, in welchem Ofen das Brot der Hungernden gebacken wird.
Paris, 30. Oktober 1831.
Das Fieber verläßt mich nicht. Dennoch habe ich es heute durch Schnee und Regen geschleppt, des armen Sträflings willen, dessen Traurigkeit allerdings nicht unerträglicher sein kann als die meine.
Châlons, 14. November 1832.
In meinem Zimmer habe ich eine junge Taubstumme, die vom Taubstummeninstitut mit einem Herrn zu ihrer Familie nach Hause fährt. Dieser hat mir sie für diese Nacht anvertraut, denn er hat bemerkt, mit welcher Sorge ich mich ihrer während der Fahrt angenommen habe. Morgen werden wir wieder zusammen wegfahren.
|
Der Herzog von Orleans. |
*
| AN A. GERGERÈS[1] | Lyon, den 29. November 1831. |
Ihre Blicke, lieber Gergerès, sind jetzt auf Lyon gerichtet. Das Interesse, das Sie an der ganzen Menschheit nehmen, wird Ihr Herz mitfühlend und ergriffen gestimmt haben. Ich würde vergeblich versuchen, die furchtbaren Einzelheiten zu schildern; ich hätte nicht die Kraft zu vollenden. Sie werden auch aus wenigen Worten alles begreifen. Wir haben eine Wiederholung des blutigen Panoramas vom Juli erlebt, ein schreckliches Gegenbeispiel der drei Seiten im Buche der Geschichte, die von Kugeln geschrieben worden sind. Wie viel unschuldige Tote! Meine ganze Familie ist gerettet. Doch, lieber Gott! man kauft gegenwärtig so viel Trauerkleider, daß wir in die Kniee sinken vor Überraschung, nicht selbst auch welche tragen zu müssen! An diesem ungeheuren Aufstand hatte die Politik keinen Anteil. Es war Empörung des Herzens... Die Weiber warfen sich dem Feuer entgegen und schrieen: „Tötet uns, dann haben wir keinen Hunger mehr!“ Zwei-, dreimal vernahm man den Ruf: „Es lebe die Republik!“ Doch die Arbeiter erwiderten — und das ganze Volk mit ihnen —: „Nein, nein! Wir wollen Brot und Arbeit!“
Seit fünf Tagen sind die Aufständischen die Herren von Lyon, und es herrscht eine musterhafte Ordnung. Inmitten von Sturmgeläut, Trommelwirbel und Kugelregen, den Jammerrufen der Sterbenden und der Frauen machten wir uns auf Plünderung und Brandstiftung gefaßt, falls jene Sieger werden sollten. Nichts derartiges! Nicht ein kaltblütiges Verbrechen nach dem Kampf! Ihr Zorn hat sich daran erschöpft, in zwei, drei Häusern reicher Fabrikanten — man hatte dort unklugerweise aus den Fenstern in die Menge gefeuert —, Möbel und Uhren zu zerschlagen und Vorhänge und Teppiche zu verbrennen. Den Soldaten ist auf ihrem Rückzuge, bei dem sie trotz allem das Gewehr übergehängt hatten, grausam mitgespielt worden. Die Bevölkerung der Vorstädte hielt diese schöne Menschlichkeit für eine Falle, und man metzelte die Soldaten nieder; dreihundert sind gefallen. Die Rhone war rot! Diese arme Garde hatte sich zuerst geweigert, auf die Arbeiter, die nur mit stürmischen Rufen Brot verlangten, zu schießen. Dann aber begannen zehn oder zwanzig Hitzköpfe doch zu feuern... Da gab es ein großes Kampfgemenge, ein Durcheinander von Weibern, Kindern und schließlich der ganzen Bevölkerung, die sich auf Seite der Arbeiter stellte. — Der Mut dieser Armen ist um so erstaunlicher, als sie von Hunger erschöpft und nur mit Lumpen bedeckt waren.
Welch ein Anblick! auch beim Schreiben muß ich die Zähne aufeinander pressen. Vor einem Monat, am nämlichen Tage, hatte dieselbe aufrührerische Unruhe ohne Waffen, ohne Schreie in friedlichem Strom die ganze Stadt durchflutet. Man empfängt sie, hört sie an; man gewährt ihr die kleine Lohnerhöhung, die sie erbittet. Freudenrufe ertönen. Am Abend veranstalten diese armen Leute aus Dankbarkeit eine Illumination. Den Beamten und Kaufmannsvorständen werden Ständchen gebracht. Acht Tage später verweigert man ihnen den bewilligten Tarif. Man verhöhnt sie. Ein Geschäftsmann begeht die Dummheit, einem Beschwerdeführer die Pistole vorzuhalten, mit den Worten: „Hier unser Tarif!“ Da ist den bedauernswerten Armen von Lyon der Zorn zu Herz und Kopf gestiegen, und die Folge war der Aufstand.
Das Theater hat gestern wieder begonnen. Ich wage nicht, Ihnen angesichts all des Elends von unserer eigenen Not zu sprechen. Man erwartet den Herzog von Orleans, doch seit gestern ist er in der Nähe von Lyon, ohne hereinzukommen. Was hat man nur vor? Worauf wartet man, da ja alles still und friedlich ist?... Es heißt, man will mit starkem Aufgebot einziehen; doch ist das nicht überflüssig, wenn man alles verzeihen will?... Und wenn man strafen will — mein Gott! Ich möchte lieber sterben, als neue Opfer fallen sehen!...
|
Advokat im königlichen Gericht in Bordeaux und vertrauter Freund der Familie Valmore. |
*
| AN FRÉDÉRIC LEPEYTRE[1] | Lyon, 15. Februar (1832). |
Sie möchten wissen, ob ich von Natur schwermütig bin, oder warum sonst ich es bin? Es ist nicht leicht, so viel Dunkles, Rätselhaftes in wenigen Worten zu entwirren. Ein jeder von uns trägt sein Geheimbuch in sich, voller Widersprüche. Tag um Tag findet sich darin ein neuer, anderer Satz, der uns selbst erstaunlich ist. Ich spreche im Bilde, denn Ihre Frage anders zu beantworten, würde mich zu traurig stimmen. Wenn meine Gedanken sich nach innen neigen, so weinen sie. In Gesprächen bin ich anders. Da gehöre ich dem momentanen Eindruck, ich sympathisiere mit dem, der zu mir redet, und ich lasse sein Wesen auf mich einwirken. Sie würden mich sehr heiter sehen, wenn Sie es selber auch wären. Bin ich allein, so gehöre ich der Vergangenheit; je mehr Kummer sie mir zugefügt hat, um so mehr hält sie mich fest. Und dann wieder habe ich leichte, strahlende, unschuldig frohe Tage, wie eine glücklich wiedergefundene Kindheit, froh über ein Nichts, von nichts betrübt. Doch selbst im Glück konnte ich mich fremdem Leid nicht verschließen — und werde es niemals können. Ich löse mich dann unwillkürlich vom eigenen Schicksal los, um das des Unglücklichen mit ihm zu teilen, seine Not mit ihm zu tragen. Mein Herz ist wie durchbohrt von stechendem Mitleid. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was ich mit anderen gelitten habe, mein üppiges Haar ist lange vor der Zeit daran ergraut.
|
Oberstadtsekretär von Marseille, verheiratet mit einer jungen Bekannten der Marceline, korrespondierte er jahrelang mit der Dichterin, ohne sie zu kennen. Später entwickelte sich eine tiefe und treue Freundschaft zwischen den beiden. |
*
| AN A. M. DUTHILLOEUL | Lyon, 29. März 1832. |
Ist es möglich, mein Herr! Diese Stiege, die ich, als ich klein war, so oft mit Schauer von Furcht und Neugier herabgestiegen bin, diese Stiege der Rue du Cuve d’Or hat einem zu Tode Verurteilten das Leben gerettet! Mein Gott, wie glücklich war ich, als ich das las!... Es ist unmöglich, daß die Todesstrafe nicht etwas im höchsten Maße und schrecklich Gottloses ist, da man so sehr von Freude erfüllt ist, wenn man von einem Opfer vernimmt, das sich zu retten vermochte. Wie gerne würde man sich auf die Kniee werfen, um ihm (Gott) zu danken, und man küßt tränenden Auges die herrlichen Seiten in „Der letzte Tag eines Gerichteten“! Wird der König das niemals lesen? Wird jemals nur ein einziger Kopf fallen, wenn er das gelesen haben wird? Denken Sie nicht so? Ich glaube, daß ich vergehen werde, aus Dankbarkeit für Gott, wenn man eines Tages ausrufen wird: „Keine Todesstrafe mehr!“ Das ist der heiße Wunsch meines ganzen Lebens. Bedenken Sie doch, mein Herr, einen Menschen lebendig in seinen Sarg schleudern!... Sich zum Gott aufzuwerfen!... Bringen Sie es oft zur Sprache, ich bitte Sie darum! Es ist ausgeschlossen, daß die Stimmen ehrlicher Menschen nicht schließlich gehört werden. Es ist das ein großes Verbrechen, das auf uns lastet und nicht ein einziges verhütet. Im übrigen stimmen die ehrenwertesten Männer in dieser Hinsicht nicht überein, ihre Unbestechlichkeit hat nicht dieselben Gesichtspunkte, und ich verstoße vielleicht gegen Ihre Grundsätze. Gleichfalls finde ich Ihre Tribunale von betrübender Strenge, und ich habe mehr als einmal aufgeweint: „Fünf Jahre Zuchthaus, öffentlich kundgegeben!“... Und für was für Delikte! Es gibt so große Übeltäter, die auf Daunen schlafen! Ich bin krank an dem Leben, so wie es nun ist. Und Sie, mein Herr?
*
| AN VALMORE | Paris, 2. Februar 1834. |
... Wohin jetzt fliehen, um sich zu sammeln und dieser Sucht, uns zu besuchen, zu entgehen. Mein Gott, ändern wir unseren Namen, denn Du siehst wohl, daß wir selbst in Lyon weder Ruhe noch Einsamkeit haben werden... Die Leute und die Verpflichtung, sie zu sprechen, gehen mir auf die Nerven. Deine krankhafte Scheu hat sich so sehr auf mich übertragen, daß das Schellen der Türglocke in mir schon nervösen Aufruhr verursacht.
... Wann werde ich eine Gelegenheit finden, Dir die Rolle des Faliero zu senden? Mit der Post — das würde ungeheuer viel kosten.
Paris, 25. Februar 1834.
Was die Aufstände betrifft, sei unbesorgt. Du weißt, daß ich vorsichtig bin und so leicht zu beunruhigen, daß ich alles schließe, nur um die Schreie nicht zu hören... Wo werden wir nur ein wenig friedlich leben können? Aber fürchte für mich nichts anderes, als den Schmerz mitansehen zu müssen, wie die Menschen einander Leides tun.
*
| AN FRÄULEIN MARS | Lyon, den 6. Mai 1834. |
Daß Sie während dieser blutigen Woche mit zärtlicher Sorge meiner gedachten, will ich nie vergessen. Ihr Brief hat mich tief ergriffen. Ich habe Sie immer lieb gehabt, und wenn ich, wie eigentlich anzunehmen war, umgekommen wäre, so hätten Sie ein Herz verloren, das wie kein zweites erfüllt war von Ihnen und Ihrem Zauber. Auch weiß ich besser als jeder andere, daß Sie gut und aufrichtig sind, und Ihre Besorgnis überrascht mich nicht. Hier war es entsetzlich. Über sechs Tage lang tobten Sturmglocke, Feuersbrunst, sinnlose Metzeleien (Frauen, Greise und Kinder wurden erwürgt); und sechs noch grauenhaftere Nächte lang, in denen wir alles mitansahen, was man ohne zu sterben ertragen kann, erwarteten wir, mit unserem Haus in die Luft zu fliegen. Aber schließlich fanden wir uns am Leben und fast bekümmert darüber, der großen Todesgeißel entronnen zu sein; es wäre so schnell zu Ende gewesen: das Stürmen der Glocken, der Flintenkugeln und Kanonen warf ohnedies alles Leben in tiefe Ohnmacht. Ich habe wohl dreimal das unbezwingliche Verlangen nach einem Schuß ins Herz gehabt, um diese Schlächterei nicht länger miterleben zu müssen... Es wird noch lange nachbluten, meine liebe Hippolyte! Ich habe so etwas nur in Büchern gefunden. Doch ich glaube, ich bin dazu bestimmt, viel Trauriges mitanzusehen; denn ich muß Ihnen sagen, daß der Tod mich mehrmals an der Hand hielt, aber wieder laufen ließ. Ich sah Gott vor mir, wie ich Ihr liebes Antlitz vor mir sehe, aber ich danke ihm noch immer, daß er mich fast gewaltsam nach Lyon getrieben hat. Ich tat meine Pflicht, meinem Gatten zur Seite, umgeben von meinen Kindern: man hätte sich kein besseres Ende wünschen können. Es muß also noch einmal durchgemacht werden, und ich bedaure das; aber wir haben alle eine Aufgabe zu erfüllen, Sie wissen, daß ich versuche, sie mit Ergebung zu tragen.
*
| AN A. GERGERÈS | [Lyon,] 17. Februar 1835. |
... Nun hören Sie mein äußeres Leben: ich werde krank, ich sinne und liebe und hetze mich innerlich ab mit dem Gedanken an alles das, was ich tun möchte, um mein Haus instand zu halten, und ich bitte Gott, daß er mich am Leben läßt. Dann verbringe ich acht Tage der Rekonvaleszenz und versuche, mich ruhig zu zeigen; dann weitere acht Tage völliger Gesundheit, tätig wie ein munteres Vögelchen. Tage, in denen ich den Schaden wieder gutzumachen suche, daß ich so lange wie abwesend war von dieser Welt. Endlich ist alles in Ordnung, alles wieder aufgerichtet und hergerichtet, die Kleider der Kinder, des Gatten, der Frau! Morgen, morgen kann ich ausgehen: Bewegung im Freien ist mir so nötig! Ich werde in dem Nebel nach einer Unze Luft suchen. Da plötzlich ergreift mich eine unsägliche Ermattung, mein Herz schlägt, daß es mir den Atem raubt, und ich falle wehrlos wieder in die Hände eines Feindes, dessen Allmacht sich nur in Lyon so recht dartut, dieser Stadt, die edle Leiden birgt, ein ungangbarer Sumpf für schwache Füße. Da haben Sie mein Schicksal, Gergerès!...
Meine Kinder gehen zur Schule. Ich bin immer allein, es sei denn, daß eins krank ist. Meine kleine Inès hat die Masern gehabt, und es war mir eine unsägliche Wohltat, sie zu pflegen, bei ihr zu wachen. Eine verzweifelte Schlaflosigkeit ist diesen tätigen Nachtwachen gefolgt. Mir wäre ein Leben gemäß wie das der ersten Christen: Wallfahrten, Nachtwachen, Wüste und vielleicht der Märtyrertod. — Was hat er verbrochen, jener Mann, den man dort hinter Eisenstäbe sperrt?... Was für ein Grauen habe ich vor den Gefängnissen! Ist nicht schon die Erde selbst ein solches? Wenn ich an den Schildwachen unserer Kerker vorbeikomme, so blinzle ich ihnen zu, damit sie auch mich niederschießen; doch man erlaubt ihnen jetzt nur noch nachts zu töten.
Saint-Jean-le Vieux, 25. Juli 1835.
Nie in meinem Reiseleben habe ich eine solche Nacht verlebt wie diejenige, die mich hierher gebracht hat. Ich glaubte umzukommen. Wir waren acht Personen im geschlossenen Wagen, Inès und meine beiden Körbe auf meinen Knieen, eine Frau aus dem Volk schlief an meiner Schulter, Gießkannen, Seifenballen... Beine von Riesen, 15 Personen auf dem Dach. Schließlich war ich genötigt auszusteigen, um nicht zu ersticken... Auf dem Rückwege werde ich die Sparsamkeit beiseite lassen, für Inès einen halben Platz zu nehmen; das Kind hat mich durch seinen schweren und friedlichen Schlaf fast erdrückt.
*
| AN ANTOINE DE LATOUR[1] | Lyon, 15. Februar 1836. |
... Der Einzelheiten, die Sie über ein so rastloses und doch so verborgenes Leben zu hören wünschen, sind nicht gar viele zu berichten. Ich habe immer Fieber, und ich reise immer. Mein Leben siecht hin, wie und wo es Gott gefällig ist. Ich wandere dem andern Leben zu, indem ich mich bemühe, meine Kinder auf dem rechten Weg dorthin zu führen. Ich würde mich mit Begeisterung dem Studium der Dichter und der Dichtung hingegeben haben: ich mußte mich begnügen, davon zu träumen, wie von allen den Gütern dieser Welt. In einigen Monaten werde ich mit meiner ganzen Familie Lyon verlassen, ohne noch zu wissen, wohin ich ihr Dasein und das meine flüchten werde — das meine, das so viel Stürmen gar nicht gewachsen schien, und dennoch standhält. Dieses gebrechliche Dasein, mein Herr, ist nur mit Widerstreben ins Leben getreten, beim Sturmläuten einer Revolution, die es in ihren Wirbel ziehen sollte. Ich bin an den Toren eines Kirchhofs geboren zu Füßen einer Kirche, deren Heiligenfiguren man zerschmettert hatte; jene zwischen den Gräbern lagernden Steingestalten wurden meine ersten stillen Gefährten. Um nicht zu lange bei Erinnerungen zu verweilen, die mir süß und wertvoll, für Sie aber sicher belanglos sind, erwähne ich hier nur mein Elternhaus, das mein Herz mit all dem schwermütigen Zauber der leidenschaftlichen Heimatliebe umgeben hat — einer Heimat, die ich mit zehn Jahren ganz unerwartet verlassen mußte, um sie nie wiederzusehen... Nun fürchtete ich mich davor.
Sie könnten also, so wohlwollend Sie auch gesinnt sein mögen, mein Herr, von mir kaum berichten, ohne darzutun, welch unwissendes und unnützes Geschöpf ich bin. Sind meine Gedichte es wert, daß man sich mit mir beschäftigt und mich in die Literaturgeschichte aufnimmt? Mein Herr, ich bin unwissend. Ich habe nichts gelernt. Seit meinem sechzehnten Jahr habe ich das Fieber, und Menschen, die mir nahestehen, haben mich schon mehr als einmal für tot beweint, so wenig lebensfähig bin ich ihnen erschienen. Lange Zeit war ich überrascht und bekümmert, so leiden zu müssen, denn da ich, trotz eines anscheinend frivolen Berufs, sehr einsam lebte, hielt ich alle anderen für glücklich und konnte mich nicht bescheiden, es selber nicht zu sein. Jetzt weiß ich, daß die andern auch leiden. Das hat mich noch trauriger gemacht, aber es hat mich entsagen gelehrt. Mein Mitleid hat den Gegenstand, mein Wunsch sein Ziel gewechselt. Dieses ist ein höheres geworden; ich versuche, es zu erreichen.
|
Der Dichter und Übersetzer Silvio Pellicos, beabsichtigte eine Studie über die von ihm verehrte Dichterin herauszugeben. |
*
| AN FRÉDÉRIC LEPEYTRE | Lyon, 14. Juli 1836. |
... Eine Hoffnung war es, die meine in Demut und Verlassensein verbrachten Tage durchzog: die Abschaffung der Todesstrafe. Ich hatte Gott mit solcher Inbrunst darum gefleht und so willigen Herzens mein Leben zur Erlangung dieser Gunst geboten, daß es mir immer schien, ich müsse eines Tages die Erfüllung dieses jahrelang gehegten Wunsches erfahren. Aber dies ist nicht zur Wahrheit geworden, wird nicht Wahrheit werden. Es gibt keine Barmherzigkeit, kein aufrichtiges Mitgefühl, es gibt nur Köpfe, die fallen, Mütter, die vergeblich ihre Verzweiflung ausschreien. Ich wollte, ich wäre tot, um sie nicht mehr zu hören. Wenn ich einen Galgen sehe, vergrabe ich mich und kann weder essen, noch schlafen. Die Galeeren, mein Gott! Um sechs Franken, um zehn Franken, für einen Zornausbruch, für eine hitzige, eine eigensinnige Meinungsäußerung... Und sie! die Reichen, die Mächtigen, die Richter! Sie gehen ins Theater, nachdem sie eben: „Zu Tode verurteilt!“ haben. Mein Herr, ich bin unglücklich. So ist es mit meinem Herzen bestellt, und dabei wohne ich einem Gefängnis gegenüber, auf einem Platz, auf dem man Menschen an einen Pfahl hängt, der trauriger ist als ein Sarg!
*
| AN CAROLINE BRANCHU | Lyon, 6. September 1836. |
Es gibt Empfindungen, die man nicht niederschreibt, Caroline!
Einen Brief wie den Deinigen mit einem Briefe zu beantworten, ist etwas so Unvollkommenes, daß Du nie so ganz wissen kannst, wie er mich ergriffen hat, was er mir an Freude und Traurigkeit gegeben. Um dem Antrieb meines Herzens zu genügen, müßte ich zu Dir eilen, Deine Hände nehmen und Dich ansehen! Das allein hätte unsern beiden Herzen wohlgetan, dem meinen in seiner tiefen Dankbarkeit, dem Deinen in seinem unerschöpflichen Mitgefühl.
Caroline! Eine Frau wie Du ist nur zufrieden, wenn sie die, der sie Trost geben will, sich nahe weiß... Sieh! Ich verstehe Dich, weil ich mich verstehe, und niemand kann Dich besser kennen als ich, die Dich so geliebt hat! Ein Wort wird Dir alles sagen, warum ich nicht abreise und warum ich in einer qualvollen Lage verharre. Ich bin nicht frei.
Mein Mann, den Dein Brief zu Tränen gerührt hat, ist ein Mann im vollen Sinne, starr in seinen Abneigungen. Er verabscheut Paris; nichts könnte ihn umstimmen. Und denke Dir, ich bin es, die ihm Trost sprechen muß in seiner Manie, die uns zugrunde richtet. Denn im geheimen gesteht er sich, daß er sich und uns die ganze Zukunft zerstört —, aber seine Scheu reißt ihn fort, und er soll mir nicht anmerken, daß ich darunter leide. Jeder Mann ist im Grunde unerklärlich, Caroline. Fügen wir uns für dieses Leben, und klammern wir uns an die Aussicht auf eine Zukunft, wo nichts uns im Wege steht.
*
| AN PAULINE DUCHAMBGE | Lyon, den 24. Dezember 1836. |
Du bist traurig! Sei nicht traurig, mein Gutes, oder wenigstens erhebe Dich wieder unter dieser Leidenslast, die ich verstehe, die ich teile. Alle Demütigungen, die der Frau auf Erden zugedacht sind, ich habe sie erduldet. Meine Kniee wanken noch immer, und mein Haupt ist oft gebeugt wie das Deine unter der Last noch immer bitterer Tränen! Doch Pauline, höre! Wir haben dennoch etwas, was von allen diesen Wunden unabhängig ist. Zunächst das Verzeihen. Es ist eine ungeheure Erleichterung für ein Herz voller Bitternis — und dann die ewige Hoffnung, die ununterbrochen vom Himmel zu uns und von uns zum Himmel fliegt...
Was aus uns werden wird, ist gar nicht vorauszusehen. Ich wage manchmal nicht mehr, schlafen zu gehen, denn ich fürchte die Gedanken, wenn ich unbeschäftigt bin. Bei Tage ersticke ich sie in Haushaltungssorgen, in der Beschäftigung mit den Kindern oder meiner Schreiberei. Des Nachts — du weißt es, da entflieht man ihnen nicht. Dann versinke ich in Leid und erliege meinem wilden Herzklopfen. Ich erhalte nichts, ich weiß nichts. Ich setze mehr Furcht als Hoffnung auf dieses gefährliche Datum des 1. Januar. Das ist ein Abgrund, der alle meine Erfindungsgabe, uns über unser Elend hinwegzuhelfen, zunichte macht. Und dann, stelle Dir Lyon vor in Schnee und Regen! Lyon ohne Arbeit, und dreißigtausend Arbeiter, die kein Brot und kein Feuer haben, denen man mit vielem Geschrei 50000 Franken Almosen sendet, vom Thron herab sendet — also von der Vorsehung dieser Armen! — Ach! das sind keine zwei Franken, die auf die Not des einzelnen entfallen. So steigen die Bettler bis unter unser finsteres Dach. Und man muß geben, Pauline, geben, oder an Mitleid zugrunde gehen...
Ist es wahr, was Du mir von Herrn de Vigny sagst und wie er über diese „so flandrischen“ Verse denkt? Ich weiß nicht, wie ich beschaffen bin, aber solche Überraschungen machen mich weinen und erinnern mich an Dinge, die ich vergessen möchte. Das einzige Herz, das ich mir von Gott erbeten hätte, hat das meine nicht gewollt. Welch furchtbares Herzweh bis zum Tode! — Du weißt das, Du!
*
| AN ANTOINE DE LATOUR | Lyon, 7. Februar 1837. |
O mein Gott! Wie voll Güte und Mitleid sind Sie! Wie verstehen Sie es, die Fehler zu begütigen, zu entschuldigen, und ich habe vor Dank geweint, denn alles, was ich schreibe, muß wirklich furchtbar unzusammenhängend sein, die Worte unvollkommen und falsch gesetzt. Ich würde mich schämen, wenn ich sie wichtig nehmen wollte. Aber, mein Herr, hätte ich Zeit dazu? Ich sehe keine Seele aus jener literarischen Welt, die den Geschmack bildet und die Sprache läutert. Ich bin mein eigener Kritiker, und da ich nichts gelernt habe, wie soll ich mir helfen? Einmal in meinem Leben, aber nicht für lange, hat ein Mann von ungeheurer Begabung mich ein wenig lieb gehabt, so daß er mir in meinen Strophen die Unkorrektheiten und Waghalsigkeiten, von denen ich keine Ahnung hatte, aufwies. Doch diese scharfsichtige und kühne Zuneigung hat mein Leben nur kurz gestreift. Ich habe nichts hinzugelernt und — soll ich es Ihnen sagen, mein Herr? — nichts hinzulernen wollen. Ich klimme weiter und suche so gut ich kann ein Dasein zu Ende zu führen, das weit mehr zu Gott als zu den Menschen spricht...
*
| AN MELANIE WALDOR | Lyon, den 9. März 1837. |
Ganz Lyon krümmt sich unter schwerer Düsternis. ... Welch ein Jahr! Dreißigtausend Arbeiter ohne Brot, die abends durch Frost und Straßenschlamm daherziehen, den Kopf in Lumpen gehüllt, und ihrem Hunger Lieder singen!... Ich kann Ihnen nicht schildern, wie das mein Herz zerreißt — urteilen Sie selbst! Nein, nein, Paris kennt keinen solchen Anblick, solche Szenen, solche anhaltende nackte Verzweiflung. — Nein! die Machthaber sollten es nicht wagen, so viele Arbeiterfamilien am Hunger zugrunde gehen zu lassen. — Ach! die Leute von Lyon, die man als schlecht und gewalttätig hinstellt, sind von erhabenem Glauben! Es hat sich tatsächlich hier zugetragen — und kann sich nur hier zutragen —, daß eine armselige Madonna auf einer Felsenhöhe dreißigtausend Löwen bändigt, die Hunger und Kälte leiden und den Haß im Herzen tragen... und sie singen wie unterwürfige Kinder! Das ist das Wunderbare. Ich muß in dieser Stadt irrsinnig oder heilig gut werden... Melanie, wenn man dieses Elend mitansieht, wagt man weder zu essen noch sich zu wärmen.
*
| AN VALMORE | Paris, 3. Juli 1837. |
Willst Du, daß ich Dir Geld sende? Wenn nicht, wie wirst Du es anstellen, um zurückzukommen, es sei denn, ich bringe Dir welches zur Endstation der Diligence, wo ich Dich am Tage Deiner Ankunft erwarten werde?
*
| AN ANTOINE DE LATOUR | [Paris,] 23. Dezember 1837. |
Zuweilen, wenn ich im Fieber und voll tiefer Trauer bin, kann ich die Verse nicht singen, wie ich es sonst fast immer tue; ich bilde sie dann nach einer Melodie, die mir besonders lieb ist, was mich unwillkürlich zwingt, die Form streng beizubehalten und nicht abzuschweifen. Ich gebe mir, indem ich hier zu Ihnen von meiner armen Arbeit rede, zum erstenmal selber Rechenschaft über diese Einzelheiten, die ich niemals recht beachtet habe. Mein Leben, meine Stunden, meine Träume und meine Wirklichkeit, alles das eilt so dahin, ist so voller Sorgen und Aufregungen, daß ich alles vor Gottes Füße werfe, der jedem Ding seine Ordnung gibt, und für dieses Mal in Ihre Hände lege, mein Herr; denn Sie sind mir ein uneigennütziger Belehrer, zu dem ich Vertrauen habe, so sehr, daß ich Ihnen für einen so wertvollen Brief erst spät meinen Dank sage — lange nachdem ich meinen Nutzen daraus gezogen...
*
| AN CAROLINE BRANCHU | Mailand, den 6. August 1838. |
Du wirst es nicht begriffen haben, meine liebe Caroline, und ich — begreife es noch immer nicht. Es war eine so herzzerreißende Sache, die Unterzeichnung dieses Vertrags, der uns von Paris fort- und nach Italien in die Verbannung führt, daß Valmore fast einen Blutsturz davon gehabt hätte. Es war, als fehlten uns die Worte, und in fünfzig Stunden haben wir unsere Koffer gepackt, Abschiedsbesuche gemacht, die Möbel untergebracht, die Dinge für unsern lieben Sohn geordnet — die Trennung von ihm war das Schmerzlichste —, und dann, Caroline, sind wir in die Postkutsche gesunken, mein armer Valmore, ich und meine beiden Töchter, abgehetzt, ermattet und noch immer verblüfft. Ja, wir sind erstaunt und fast entsetzt. Aber jenes andere Entsetzen, uns wiederum stellungslos zu sehen, hat uns die Gefahren einer solchen Reise mißachten lassen und uns der Vorsehung in die Arme geworfen, da Herr Vedel es so bestimmt hat, kraft seiner kaltblütigen Gewalt. Ich sage Dir vor Gottes Angesicht, dieser Mann hat keine Seele und keine Redlichkeit. Er hat sein Ehrenwort gebrochen, von dem er sagte, es gelte mehr als eine Zusicherung. Doch nicht von ihm habe ich Dir zu erzählen...
Hier sind wir nun in Mailand. Was hilft es, daß mein Mann siebentausend Franken verdient, unsere Reisen und der Aufenthalt hier verschlingen alles, so daß wir bei der Rückkehr nach Frankreich noch mehr ruiniert sind als beim Weggang. Die bevorstehenden Krönungsfeierlichkeiten haben die Preise aufs äußerste gesteigert. Ein Zimmer, ein Loch, wird für fünf- und sechstausend Franken im Monat vermietet, ein Fenster nach der Straße kostet für siebzehn Tage tausend Taler. Nun beurteile, wie wir unter so vernichtenden Umständen einquartiert sind...
Du siehst, Caroline, ich bin dem reißenden Lauf der Dinge und meiner Pflicht gefolgt. Ich kann nicht nein sagen, wenn Valmore sich für etwas entschieden hat; und da er den Gedanken nicht ertragen konnte, ein zweites Mal ohne Engagement zu sein, so bin ich ihm kummervoll in seine neue Stellung gefolgt.
*
| AN PAULINE DUCHAMBGE | Mailand, den 19. September 1838. |
Ich habe keine Worte mehr, mein liebes Herz. Das Unheil bedroht uns nicht mehr: es ist hereingebrochen! Du wirst alle sachlichen Einzelheiten von Mademoiselle Mars erfahren, die ebenfalls darunter leidet.
Muß ich noch mehr sagen, um Dir das Herz zu zerreißen? Wir wissen kaum, wie wir nach Lyon zurückkommen sollen, und ob Valmore nicht aus Zartgefühl verpflichtet ist, noch in Italien zu bleiben und sich den unglücklichen Schauspielern anzuschließen, die nicht fort können. Der Gedanke kann mich zur Verzweiflung bringen, denn wenn schon in Frankreich der Einbruch des Winters seine Schrecken für uns hat, die wir keine Unterkunft und keine Einnahmen haben, so kannst Du Dir denken, was uns hier in der Verlassenheit erwartet: ein grauenvolles Bettlerlos. Mein Atem versagt!
Mailand, 20. September 1838.
Er (Valmore) hat entsetzlich gelitten, aber dennoch wird er sich nie darüber trösten, daß er uns Rom nicht gezeigt hat. Und ich, weißt Du, wem ich in diesem schönen Rom nachtrauere? Der erträumten Spur, die seine Schritte dort hinterlassen haben, dem Nachklang seiner damals so jungen Stimme, seiner immer so süßen Stimme, so ewig mächtig über mich; ich würde nur diese Vision von Rom fordern; — sie wird mir unerreichbar bleiben.
*
| AN MINISTER MARTIN | [Paris,] 1. Januar 1839. |
Lauschen Sie ein wenig![1] denn ich erbitte voll Kühnheit und doch auch etwas ängstlich aus Ihren großmütigen Händen mein Neujahrsgeschenk: zwei Monate Begnadigung für eine arme Mutter, die in Saint-Lazare gefangen sitzt, wo Ihr Name bereits mehr als ein süßes Echo gefunden hat, Herr Minister. Machen Sie es möglich, daß die arme Frau entlassen wird, um ihren Kindern ein frohes neues Jahr zu wünschen!
|
„Acouté m’on peo!“ — Patois aus Douai. Der Minister und Marceline Desbordes hatten die gleiche Heimat. |
*
| AN VALMORE | Paris, 21. April 1839. |
Nach all diesen Erschütterungen wäre das Glück, das ich genießen könnte, einzig der Besitz völliger Freiheit. Aber diese ist nirgends, mein lieber Engel!
*
| AN CAROLINE BRANCHU | Paris, den 29. Mai 1839. |
... Ich bin heimgekehrt, um — trotz meines brennenden Bedürfnisses nach Ruhe und Einsamkeit — tüchtig zu arbeiten. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was es mich gekostet hat, Orleans zu verlassen, und was ich darum gäbe, dorthin zurückzukehren, bis ich wieder mit meinem Mann zusammentreffe. Ich befehle Dir, das zu glauben, ich sage es Dir vor Gott. Doch ich muß bei meinem Sohn bleiben, und ich muß fünfhundert Franken auftreiben, um den jungen Italiener, von dem ich Dir erzählte, seiner Familie zurückzugeben. Alle Welt läßt ihn im Stich, und er hat niemanden als mich, meinen machtlosen, doch unbeugsamen Willen, ihm zu helfen; und das soll geschehen! Mein Herz ist eigensinniger als mein Verstand. Gibst Du mir nicht stets ein Beispiel der Barmherzigkeit? Ich tue, was Du an meiner Stelle tätest, was ich von der Mutter unseres Heilandes für meinen Sohn erbitten würde, wäre er in Italien, ohne mich, ohne Freunde und in völliger Verlassenheit.
*
| AN VALMORE | Paris, 21. Februar 1840, morgens. |
Vergebens erhoffte ich gestern den Brief zu Ende zu schreiben. Eine Dame, die mich in Belgien gesprochen hatte, ist schnurgerade hereinspaziert, ich im Hemd! Sie wollte eine Empfehlung für Fräulein Mars oder weiß Gott was... Alle diese liebenswürdigen Neugierigen versetzen mich in helle Wut, und Du wärest schon aufs Dach geklettert, bei all diesen unvorhergesehenen Vorfällen. Trauriger Ruhm das, der mich mit solchen Nadelstichen plagt!
Paris, 6. März 1840.
Ich sprach Dir nur von dem glücklichen Ereignis[1]... hatte nicht Zeit, das geringste Detail hinzuzufügen. Gestern, o gesegneter Tag! Nach dieser Neuigkeit, die ich mit Dir teilte, hatte ich das Glück, zugunsten des jungen Sträflings seinen Onkel, seine Tante, seine Mutter umzustimmen. Sie haben alle mit mir geweint und haben sich ergeben. Sie willigen ein, ihn, wie es die Vorschrift verlangt, von dem Direktor des grauen Hauses einzufordern... Ich erzähle Dir das alles noch... Die Hauptsache war, den Zorn dieser erbitterten Familie niederzuschlagen: das ist geschehen! Ah! ich war fast im Himmel, als ich gestern dieses Haus verließ... Ja, ich habe einen schönen Tag fern von Dir verbracht, aber durch Dich, für Dich!
|
Bewilligung ihrer Pension. |
*
| AN HIPPOLYTE | Lyon, Mittwoch, 21. Oktober 1840. |
Gestern... hat Dein Vater Deinen Brief und Deine Zeichnung erhalten. Er dankt Dir und teilt Deine Bewunderung für Michelangelo. Wie viel Glück schließt doch die Welt ein, wenn man in sich den demütigsten und zugleich den allergrößten Sinn besitzt, den der Bewunderung! Er gibt für alle Kümmernisse Trost und gibt der Armut Schwingen, die sich auf diese Art über die verächtlichen Reichen erhebt.
*
| AN VALMORE | 20. Dezember 1840. |
Seit meiner Rückkehr habe ich mehr als vierzig Briefe geschrieben und habe Nächte bei den Versen verbracht, um die man mich anläßlich des Unglücks von Lyon gebeten hat. Man liest sie heute im Konzert des Herrn Hertz, für das ich seit acht Tagen in Regen, Schnee und Frost, dem kältesten Wetter, an das ich mich erinnern kann, umherlaufe...
Paris, 24. Dezember 1840.
Ich verbreche so gut ich kann für Herrn Campenhout eine Romanze, aber ich habe keine ruhigen Zwischenpausen; ich muß alles auf der Straße im Gehen machen.
25. Dezember 1840.
Wenn mein Brief Dich noch erreichte, so vermerke die Sache, die Du mir einzig aus Brüssel mitbringen mögest. Du erfragst bei Sophie die Adresse von Willem, von jenem oder von dessen Sohn, der uns unsere Eheringe gemacht hat, und Du wirst mir einen kleinen Ring kaufen, und läßt ihn von dem guten Pfarrer von Finistères weihen... Du weißt nämlich nicht, daß mein teurer Ring in Rouen, mit allem andern, was wir als Pfand ließen, veräußert wurde. Meine Schwester konnte schließlich nicht mehr die Kosten für den Aufschub des Verkaufes bestreiten...
*
| AN ONDINE, IHRE TOCHTER | 12. Oktober 1841. |
Die erste Winterkälte, überanstrengende Wege und meine Lage haben mir wieder Fieber eingetragen, das mich so oft überkommt und das man mir dann häufig als Launenhaftigkeit auslegt, weil ich da ernster bin und Sprechen mich geradezu tötet. Es ist eine große Kunst, zu erreichen, daß es einem nicht verübelt wird, wenn man leidet. Mögest Du sie besitzen, lieber Engel, denn Du weißt schon, man kann recht krank sein, ohne das Bett zu hüten und sich zu schonen.
*
| AN CAROLINE BRANCHU | Paris, den 12. Januar 1842. |
Wie gut Du bist, Caroline, und wie wenig ahnst Du, welche unendliche Wohltat Du mir erweisest, indem Du mir zeigst, daß es dennoch auf Erden so ein Wesen gibt, wie wir es uns wohl in unsern schönsten Tagen träumen! Alles, was ich liebte, damals, als ich Dich zum erstenmal hörte und verstand, hat mich betrogen, gleichwie Du Deinerseits betrogen worden bist. Wir sind nun zwei Parias der Liebe, wie man uns damals genannt hat. Wenigstens aber hast Du mich gezwungen, stets an die Freundschaft zu glauben, und wenn ich bedenke, was Du für mich gewesen bist, mein guter Engel, so entströmen meinem Herzen, das ich schon für verdorrt hielt, zwei Tränenbäche. Ja, Caroline, da Du Deine Seele über mein Leben breitest, erhebst Du mich von tiefer Niedergeschlagenheit, denn ich bin manchmal recht müde.
*
| AN FRÉDÉRIC LEPEYTRE | 5. Februar 1842. |
... Nun denn: alles was ich an weiblichem Scharfsinn, an Erfindungsgabe, an Worten und wenn nötig, an Schweigen besitze, ich benutze es, um meinem lieben Gatten diesen großen, demütigenden Kampf zu verbergen, den er nicht acht Tage ertragen würde. Ich erkaufe ihm seinen Stolz mit meinen Demütigungen, und erst in einer anderen Welt wird er erfahren, mit wieviel unschuldiger List, mit wieviel Tränen, die zwischen mir und Gott Geheimnis blieben, ich ihm bis jetzt das traurige Geheimnis verborgen habe, wie schwer das Brot zu beschaffen war, das auf seinem Tisch und dem der Kinder nie gefehlt hat. Auch der Frost hat ihnen noch nichts anhaben können...
| AN CAROLINE BRANCHU | [Paris,] den 23. April 1842. |
Es war mir unmöglich, Dir zu erzählen, was ich gelitten habe. Wie furchtbar, meine Tochter krank zu sehen! Wie traurig, diese Jugend leiden zu sehen, ohne die Ursachen zu kennen! Und Du weißt aus schmerzlicher Erfahrung, was das heißt, fern von seinem Kinde leben. Ich wage nicht mehr, meinen Einfluß auf sie geltend zu machen, denn sie hat nicht das geringste Vertrauen zu mir. Wenn unsere Kinder heranwachsen, betrachten sie uns als unwillkommenen Mentor, und obgleich sie uns immer lieb behalten, so lächeln sie doch über unsern Rat. Nun, da ich einmal die sanfte Autorität über Ondine verloren habe, weiß ich gut, daß sie nirgends besser aufgehoben ist, als unter den Augen Deiner Tochter und im Hause des Doktor Curie, der sie elender findet, als bei ihrem ersten Dortsein; und Du weißt, mein guter Engel, daß meine Dankbarkeit meinem Kummer gleichkommt. Von beiden habe ich viel.
*
| AN FRÉDÉRIC LEPEYTRE | Rouen, 9. Juli 1842. |
Diese Stadt ist ganz Mittelalter und für mich aufwühlend durch Erinnerungen, die härter sind als gespitztes Eisen. Ich war fünfzehn Jahre, als ich hier mit einer meiner Schwestern und meinem Vater einzog: damals, als ich von Amerika zurückkam. Ich war das Idol dieses noch wilden Volkes, das jedes Jahr ein oder zwei Künstler opferte, wie seinerzeit Stiere geopfert wurden. Mir warf man Blumensträuße zu, und wenn ich heimkehrte, starb ich fast Hungers, ohne es irgend jemandem zu sagen. Daher und von einer für dieses jugendliche Alter zu anstrengenden Arbeit, stammt meine schwankende Gesundheit, all mein bewegtes Leben lang.
*
| AN PAULINE DUCHAMBGE | Den 10. Februar 1843. |
Deine Vorstellung von Herrn Bayard ist ein trügerischer Traum. Nein, Pauline, diese Herzen fühlen nicht mit uns. Die Reichen von heute kommen und erzählen einem mit solcher Rückhaltlosigkeit und so viel bitteren Klagen ihren Jammer, daß man gezwungen wird, mehr Mitleid mit ihnen zu haben als mit dem eigenen Los. Letzthin hat er mir dargelegt, welche schrecklichen Widerwärtigkeiten er bei seinem Hausbau zu bestehen hat. Er sollte ihn, glaube ich, hunderttausend Franken kosten, und die Ausgaben betragen gegenwärtig schon das Doppelte. Dies und die Erziehungsgelder für seinen Sohn machen ihn kopflos. Was soll man diesen Glücklichen sagen? Daß man nur zwei Hemden hat und keine Bett-Tücher? Sie würden antworten: „Ach, wie glücklich sind Sie daran! Sie brauchen nicht zu bauen!“
*
| AN IHREN BRUDER | Paris, den 4. Januar 1849. |
Wenngleich ich die Gründe nicht kenne, aus denen dem Gesuch nicht entsprochen wird, so ist es doch klar, daß es in dieser großen sozialen Krise nirgends Geld zu geben scheint. Das Staatsgebäude, das im Februar zusammenbrach, war so bis unters Dach faul, daß es im Sturz viele Dinge und viele Menschen mitgerissen hat! Armes Volk, das so voll Zuversicht und Frömmigkeit ist, es hat auch diesmal nichts erhalten als das Recht, für seine Kinder zu sterben, denen vielleicht das Blut ihrer heldenmütigen Väter zum Segen werden kann! Wir gehören zum Volk durch unser Elend und unsere Überzeugung, mein lieber Bruder, so laß uns dulden, wie dieses, und hoffen, wie dieses. — Es ist wieder getäuscht worden — sein edler, rühmlicher, unangebrachter Glaube! Doch der Tag wird kommen, da die Vorsehung vom Übermaß unserer Leiden und von der Größe unserer Demut ergriffen sein wird.
Paris, den 28. Juni 1849.
... Es haben sich in Paris so düstere Ereignisse abgespielt, als wären sie aus einer andern, schauerlichen Welt. Der Tod schoß seine Pfeile nach allen Seiten. Man sah ihn nicht, aber man stürzte getroffen nieder... Ich kann mich kaum mehr aufrechthalten; wir haben so viele Freunde verloren, und der Anblick der Straßen voller Leichenzüge, wo so mancher von denen, die das Geleit gaben, nicht wieder heimkehrte — wie entsetzlich!... Ich bin sicher, und ich war sicher, daß Du genug über dies große Unheil gehört hast, um in schwerer Sorge für uns zu sein. Aber wir wußten nicht wohin vor Inanspruchnahme; von allen fünf Seiten rief man nach uns und wollte unseren Trost und unsere Tränen. Wenn man so allen erdenklichen Geißelungen preisgegeben war, braucht man lange, um sich zu erholen, mein guter Bruder, — um sich zu fragen, ob das, was man an Leben übrig behält, auch wirklich noch ein Dasein ist. Nein! Meine Seele ist allzu zerrissen, und dennoch fühle ich gerade darum mehr als je, daß sie unser unsterblich Teil ist. Daß unser Schmerz so heftig und so tief sein kann, ist der Beweis einer unerschütterlichen Überzeugung, eines vertrauensvollen Willens zum Glück, das nicht ausbleiben wird. Ich setze Dir das auseinander, so gut ich kann — vielleicht aus Mitleid mit mir selbst, um meinen Jammer weniger zu fühlen; ich möchte Dir, wenn auch recht unvollkommen, die Lichter weisen, die unsere Zukunft erhellen und die sich an einem Glauben entzünden, den alles nur vertieft, selbst der Verlust derer, denen unsere Zuneigung gehört.
Die Geldnot, das Elend der Armut, hat nicht dieselbe Wirkung — wenigstens nicht auf mich. Da ich es bin, die für den Haushalt sorgt, so lassen mir die verzehrenden Sorgen, diese Aufgabe zu lösen, nicht die Zeit zur Sammlung und zur Andacht, wie jene unersetzlichen Verluste sie mit sich bringen. — Wie oft denke ich jetzt an unsere Mutter, an das, was sie unter den nämlichen Verhältnissen für uns gelitten haben muß, um ihrer armen kleinen sorglosen Schar die Nahrung zu beschaffen!...
Ich hatte eine längere Arbeit beendet, sprach ich Dir schon davon? Ein Auftrag, Verse — eine Arbeit von drei Monaten, unter Tag, am Abend, oft die Nacht hindurch, während die anderen, ihrer Arbeit müde, schliefen; — nun also: als der vereinbarte Preis fällig war — mit gleicher Sehnsucht erwartet wie zur Cholerazeit das himmlische Naß —, hat der Mann unsere Vereinbarung abgeleugnet und wollte mir nur noch die Hälfte bezahlen. Ich habe die Arbeit behalten... vielleicht kann ich sie später einmal verkaufen. Aber welch ein Schlag! — Wie muß man aber auch alle anderen Arbeiter beklagen! Wer hat je inniger mit ihnen gefühlt als ich? Keiner, es sei denn unser verehrter Vater — und die Mutter... Ach! Ich habe die von Lyon gesehen, ich sehe jetzt die von Paris, und ich weine um jene der ganzen Welt!
Wir leiden weniger physisch als seelisch unter den Vorgängen im allgemeinen und unseren besonderen Kümmernissen. Ondine arbeitet viel, ebenso ihr Bruder. Mein Mann hat noch keinerlei Aussicht, eine Anstellung für sich zu finden. Frankreich ist niedergeschlagen und leidgebeugt! O du schmerzensreiche Mutter Gottes!
*
| AN PAULINE DUCHAMBGE | Paris, 15. April 1850. |
Wenn meine Schwäche, die noch immer sehr groß ist, mich nicht daran verhindert hätte, wäre ich wie eine Nachtwandlerin zu Dir gekommen... Dennoch bin ich bis zur Rue Feydeau gegangen — denn ich bin es, die betraut ist, mit Geld, das ich nicht habe, einige Versatzscheine für diesen armen Karl[1] in der Pfandleihanstalt verlängern zu lassen. Der eine sollte schon verkauft werden, und so habe ich mich denn hingeschleppt, aber das war auch alles, was ich an Kraft noch aufbringen konnte.
|
Stellungsloser Schauspieler. |
27. November 1850.
Mach Dir eine genaue Vorstellung von der bitteren Verstimmung, in der sich mein Mann befindet. Die Demütigung der verächtlichen Ruhe, zu der er in seiner Kraft verdammt ist, verzehrt in dem Bedürfnis nach Arbeit, das ist, ich versichere Dir, nicht zu beschreiben. Wenn er nicht mehr den Mut hat, auszugehen oder zu lesen, sitze ich nähend bei ihm, denn ich halte von diesem verstörten Dasein, das niemanden rührt, alles ab, was ich nur kann... Ja Gott und Du, ich weiß schon, und das ist Trost genug, daß ich herzhaft weiternähe. Aber das Schreiben ist mir unmöglich. Meine Gedanken sind zu ernst, zu sehr beschwert, ich konnte die verlangten Erzählungen nicht machen. Ich schreibe ja wirklich mit meinem Herzen, und es blutet zu sehr für Kleinkindergeschichten.
*
| AN MELANIE WALDOR | [Paris,] den 21. Februar 1851. |
Sie meinen es immer gut und grausam, daß Sie mir von einer Soirée sprechen, liebe Freundin. Was wäre wohl in mir gewandelt, um nicht ebensolche Angst vor dem Wort „Soirée“ zu haben? Ich kann mich nicht in die Musik stürzen, die alles in uns aufrührt, nicht in fremde Gesichter vertiefen, deren Wohlwollen sogar — mich beben macht. Haben Sie unsere Kämpfe in dieser Hinsicht, meine wilde Flucht, vergessen? Und gibt es irgend jemanden in Paris, der Ihnen sagen könnte, mich da oder dort gesehen zu haben, seit ich den Mut gefunden habe, Ihren liebenswürdigen Aufforderungen zu widerstehen? Ich bin seitdem wohl für immer niedergeschlagen geblieben, Melanie, denn ein Stück von meinem Leben ist damals dahingegangen. — Gewiß, das wirkliche Glück Ondines gießt auch auf mich einige Sonnenstrahlen; doch die Sonne kann mir nicht von einer Soirée kommen, liebe Dame. Für mich liegt sie in einer nahen Aussprache mit einem Herzen, so gütig wie das Ihre, das mich stets geliebt hat und dessen Gefühle ich ganz erwidere. Ich werde Ihnen, fast ebenso rasch wie dies Billett, diese Dinge mündlich sagen, die Sie schon mehr als einmal entwaffnet haben. Sie wissen längst, daß mein lieber Valmore,
„Bruder, Gatte und Herr“,
der Mann danach ist, um meine Flucht in die Einsamkeit noch zu überbieten. Wenn es noch keine Kartäuserklöster gäbe, so würde er sich ein solches erfunden haben. Auch macht er sich überall eins zurecht, wo es vier Mauern gibt und einen Haufen Bücher.
Die Jungen — das ist etwas anderes; sie haben ihre leichten Schwingen, und Einladungen interessieren sie. Mögen sie hinflattern, wo es ihnen gefällt. Die Freude anderer tut mir immer wohl.
Mögen Sie viel Freuden haben! Und weil ich das glaube, so meine ich auch, daß Ihre Güte aus derselben Quelle fließt.
„Ach! Frohen Herzens wird die Tugend leicht!“
Vergessen Sie auch nicht, daß Herzen, die viel gelitten, Freundschaft unentbehrlich ist.
*
| AN HERRN DUBOIS[1] | [Paris,] 28. Mai 1851, 10 Uhr morgens. |
Lieber Herr,
inmitten des tiefsten Herzeleids — eines Herzens, das zu dieser Stunde ganz bei Ihnen ist — gebe ich Ihnen Antwort. Ich beschwöre Sie, bleiben Sie gütig wie immer; handeln Sie für mich, erraten Sie meine Gefühle. Sie wissen, mit welch unendlicher Liebe ich meinem armen Bruder zugetan war... nein, bin! Denn darin ändert sich nichts... Tun Sie, was getan werden muß, um meinen lieben und unglückseligen Kämpfer zu ehren... Ich stehe für alle Kosten ein und zolle Ihnen überdies meinen innigsten Dank. Mein Vater, unser herrlicher Vater, ruht in Sain (oder Sin)... Ich möchte gern, daß Felix auch dort läge; ich fühle, daß er mich darum bittet. Ich werde alles bezahlen. Haben Sie bitte ein Auge auf meine armen, so traurigen und herzgegebenen Briefe, auf seine Papiere, die Sie mir aufheben wollen; Sie wissen ja, mein Herr, was ich leide — für mich und für andere. Ich habe dieses Sterben Tropfen um Tropfen mitgetrunken; ich fühlte, was er litt, trotzdem man mich nicht benachrichtigt hatte. Seine letzten Briefe haben mich schwer bedrückt. Sie schienen noch verzweifelter, und meine eigene Not band mich hier fest. Sie können sich unsere augenblickliche mißliche Lage nicht vorstellen... Er hat das nur allzu sehr erraten, da er meine gewohnte schwesterliche Hilfe vermissen mußte, und dieser Kummer wird ihn getötet haben!...
Das ist das zweite Herzensband, das sich innerhalb acht Monaten von mir losreißt. Ich habe ihm den Tod einer lieben Schwester in Rouen verheimlicht. Ich fürchtete, ihn zu erschüttern... Wir sind eine traurige Familie!
... Ich flehe Sie an, setzen Sie diesem meinem ersten Freund ein würdiges Kreuz und jedes Jahr frisch blühende Blumen. Ich zahle es, sobald ich kann und es Gott gefällt. Ich habe so lange gezögert, meinem Versprechen eines Besuches in Douai nachzukommen, daß er nicht mehr daran glaubte. Ach! Ich werde hinreisen, aber zu spät für ihn, mein Herr! Dennoch wird er es sehen!...
|
Verwalter des Hospizes in Douai, der mit rührender Sorge über die letzten Jahre des alten Felix Desbordes wachte, die dieser im Hospiz seiner Vaterstadt zubrachte. |
| AN VALMORE | Paris, 5. September 1851. |
Oh, welch schöne Unterweisung gibt uns das Unglück! Oh, göttliche Dornen Christi, wie zeigt ihr uns die Stelle, wo unser Herz schlägt!
*
| AN PAULINE DUCHAMBGE | 1. September 1852. |
Ich kann nicht fort, um Dir persönlich eine Freude mitzuteilen, die ich dennoch schleunigst mit Dir teilen muß, meine vielliebe Pauline! Mein lieber Valmore hat eine Anstellung. Ja! Es ist kein Traum. Die Vorsehung hat es so gewollt. Sie hat alles mühelos gefügt, ohne alle Unterstützung — nur sie selbst und ein junger Freund Hippolytes haben es zuwege gebracht. Stelle Dir vor, wie heilig froh sein armer Vater ist! Die Stellung ist sehr bescheiden, aber ganz seinem Geschmack entsprechend und ehrenvoll dazu. An der National-Bibliothek, rue Richelieu. So bleibe ich also in Deiner Nähe. Ich sende Dir den tiefen Seufzer der Dankbarkeit, der aus meinem Herzen zu Gott emporsteigt. Ich habe Dich lieb.
*
| AN T. V. RASPAIL[1] | [Paris,] 17. Februar 1853. |
Es bleibt Ihnen nur noch übrig, die unglückselige Mutter zu segnen, die vor Ihren Gefängnisgittern auf den Knieen liegt. Alles ist zu Ende! Nur nicht der unendliche Kummer, daß Sie nicht da waren, ihr beizustehen in der Not.
Auf später, ich schreibe noch. Hier kann ich Sie nur um Verzeihung bitten, daß ich Ihnen mein blutendes Herz zutrage, sie aber ist befreit!
|
Raspails Frau war gestorben, während er in Haft war. |
| AN LOUISE BABEUF | [Paris, 1853.] |
... Ich habe meine Kraft erschöpfen müssen in der Suche nach einer Wohnung oder etwas Ähnlichem, denn heutzutage macht man sich die Luft zum Atmen streitig. Wie beklage ich Sie, wenn Sie die nämlichen Schwierigkeiten und Leiden bestehen müssen, wie ich sie durchgemacht habe, um schließlich das Recht zu erwerben, in einer ehrbaren Regentraufe zu wohnen; denn so hoch müssen wir steigen, um uns zu den Bewohnern von Paris zählen zu können. Der Preis für diesen Winkel in einer Höhe von fünfundneunzig Treppenstufen (doch es ist keine Treppe, sondern eine Leiter, die sich „Diensttreppe“ nennt) ist unglaublich. Tausend Franken für dies Quartier!...
*
| AN PAULINE DUCHAMBGE | [Paris,] den 28. November 1854. |
Höre! Ich bin in der Kirche gewesen und habe dort acht bescheidene Kerzen entzündet, demütig wie ich selbst. Acht Seelen meiner Seele: Vater, Mutter! Bruder, Schwestern... Kinder! Ich habe sie brennen gesehen, und ich vermeinte zu sterben. Dies sei nur Dir verraten; es war ein Besuch bei Gott.
Wir werden schwer heimgesucht, meine liebe Pauline. Wie sehr ich Dich liebe, magst Du an dem allein ermessen, was ich Dir zu sagen wage, auf die Gefahr hin, Dich mit meinem Jammer mitzubelasten; er ist gegenwärtig groß.
Die unter Trompetengeschmetter vorüberziehenden Kanonen bereiten mir Schmerz. Doch was vermag das Gebet meines Herzens in einer so schrecklichen Bedrängnis!...
[Paris,] den 19. April 1856.
Du mußt nicht beunruhigt sein, weil ich Dich all die Tage nicht gesehen habe, mein guter Engel. Ich bin infolge einer großen Erschütterung, die mich sehr mitgenommen hat, zu äußerster Ruhe gezwungen. Ich werde Dir im einzelnen mündlich berichten, weshalb mein Kopf heute so angegriffen ist... Wie habe ich an Dich gedacht! Daran, was Du durch Herrn de Champigny gelitten hast. Sind wir nicht wie zwei Bände des gleichen Werkes? Ein Wort wird Dich aufklären: Nach sechzehnjährigem Schweigen erhebt sich die Tochter der Madame Branchu wie ein Ungewitter und fordert unverzüglich eine Summe von... samt den fünf Prozent Zinsen... in einem Ton, als brülle ein Kriegsschiff los. Erstaunen und Entsetzen haben mir mit allem, was ihr Name Furchtbares in mein Leben getragen, ans Herz gegriffen — mehr noch, als die Forderung an sich, zu einer Zeit, da ich keine zwei Sous hatte, um einen Brief an Dich zu frankieren. Wie bin ich herumgelaufen, um wenigstens einen Teil der Summe zu beschaffen... In der Nacht vom Montag hatte ich einen Blutsturz. Ich glaubte meinen letzten Augenblick gekommen. Der Arzt sagt, dieser Anfall sei recht wohltätig für mich gewesen; die nachfolgende Schwäche aber kannst Du Dir vorstellen, Du, die mir in allem so ähnlich ist...
[Paris,] den 9. Januar 1857.
Vor fünf Tagen vermeinte ich die Kraft zu haben, Dich aufzusuchen und Dir persönlich auf Deinen letzten Brief zu antworten. Eine äußerst heftige, äußerst unerwartete Erkältung hat mein Fieber mehr als je gesteigert. Meine Liebe, Gute! Es ist unmöglich, Dir die traurige Geistesschwäche zu schildern, in die alles das mich versetzt. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon solche Tage durchgemacht habe. Ich muß es annehmen, da ich jederzeit in jeder Weise viel gelitten habe; doch ich bin zu erschöpft, um mir überhaupt von etwas Rechenschaft zu geben...
Wieso erstaunt es Dich, in die Vergangenheit so jung zurückzukehren? Sind wir nicht immer jung? Woher kommt es, daß Du fast bekümmert bist über diesen unwiderleglichen Beweis unserer Unsterblichkeit? Unser Dasein kann erlahmen, aber nicht enden. Wir hören nicht auf, zu sein, das darfst Du mir glauben. Es gibt nicht eine Nacht, in der ich nicht meine kleinen Kinder wieder in den Armen, auf meinem Schoß halte! Gewiß, sie sind es selbst! Du darfst gleich mir völlig überzeugt sein, daß sie wirklich am Leben sind, indessen das unsere nur unter Not und Angst und Trauer dahinfließt. Ich behaupte daher, daß jene Liebe, von der Du so oft in Deinen traurigsten Stunden ganz unerwartet ergriffen wirst, ein Teil Deiner selbst ist, und daß Du dann nur die Spiegelung davon erblickst... Das ist ein schönes, tiefes Feuer, Du solltest darum nicht klagen. Es ist der Sinn dessen, was Du Dir damals nicht erklären konntest. Es ist Deine Seele, die ihrem Hang zur ewigen Liebe folgt.
... Gestern waren die beiden Prinzessinnen bei mir, um mich gewaltsam zum Diner zu entführen. Du weißt, welches Entsetzen ich davor habe, in der Stadt zu speisen. Sie haben mich statt aller Antwort im Bett gefunden. Welch ein grotesker Unterschied zwischen ihrem und meinem Los! Ich hatte noch einen Franken in der Schublade, für den neuen Monat — und Victoire raste... Und da sagen diese guten Damen: „Madame Valmore versteht so gut sich einzurichten.“ Die Schwiegertochter der einen hat eine Rente von fünfhunderttausend Franken.
Donnerstag, 3. Dezember (1857).
Wie herrlich liebevoll Du bist, mir zu schreiben, ohne daß ich Dir antworten kann, Pauline! Wie wohltuend ist Deine Teilnahme in dieser furchtbaren Zeit. Ich umarme Dich im Geiste. Jede Kleinigkeit von dem, was Dich quält und angeht, ist mir wichtig. Das bedeutsamste Wort Deines Briefes ist dies: „Es geht mir besser!“ Ja, das ist ein wenig Himmelsfreude. Ich weiß, daß es überall Stürme gibt, selbst unter redlichen Menschen. Die Liebe allein, die göttliche Liebe, kann sie beschwichtigen; und Du hast diese Liebe. Wende sie an!
Samstag.
Du siehst: ich habe nicht fertig schreiben können. Ich denke an Dich... und ich verstumme, um meine Leiden ohne Aufheulen tragen zu können. Ich führe ein unmögliches Dasein. Ich weiß nichts mehr vom wirklichen Leben — wenn dies das wirkliche Leben ist! Mein gutes Herz, ich kann Dir nur einen Kuß senden und immer wiederholen, wie unwandelbar ich Dir verbunden bin. Meine Schmerzen sind unbeschreiblich. Ich kann nirgends zur Ruhe kommen.
Guter Engel, komm nicht! Pflege Dich; es ist ein Verbrechen gegen unsere Liebe, sich zu vernachlässigen. Ich sehe es ein! Ich tue alles, meinen Zustand erträglich zu machen, aber nichts [hilft]. Du hast recht mit allem, was (Du) über diese Krankheit sagst.
Ich wollte Dir lieber selbst dies Geschreibsel senden, als meinen lieben Hippolyte schreiben lassen. So siehst Du doch wenigstens meine Schrift und den getreuen Namen (Deiner)
Marceline
Daß die Besten einer Zeit immer die Besten erkennen, bezeugen hier die Äußerungen Balzacs, Sainte-Beuves, Victor Hugos und Baudelaires, und sie haben heute wieder volle Geltung, da die Gestalt der Marceline Desbordes-Valmore nach einer Zeit langer ungerechter Gleichgültigkeit wieder lebendig wird.
*
Ich habe die zwei kleinen Briefe bekommen — allzu kurz mit ihren zwei Seiten, doch ganz durchduftet von Poesie und durchweht von jener Heimatluft, aus der sie kamen. Es war, als lauschte ich den schönsten Takten einer Beethovenschen Symphonie, und die zwei Tage, die ich in Ihrer Gesellschaft verbrachte, erstanden in meinem Gedächtnis. Und, was mir selten begegnet, ich saß lange Zeit gedankenvoll, die Briefe in der Hand, und machte ein stilles Gedicht; ich sagte mir: sie hat also das Andenken an ein Herz bewahrt, in dem sie ein volles Echo gefunden hat, sie und ihre Worte, sie und all ihre Lieder, — denn wir sind aus dem gleichen Lande, Madame, dem Land der Tränen und der Qualen. Wir sind so gute Nachbarn, als Poesie und Prosa es in Frankreich sein können, und ich weiß mich Ihnen nahe durch die Bewunderung, die ich für Sie empfinde und die mich mehr als eine Stunde vor Ihrem Porträt im „Salon“ festgehalten hat. Also, leben Sie wohl! Mein Brief kann meinen Gedanken nur unvollkommen Ausdruck geben, doch Sie werden auch zwischen den Zeilen die Freundschaft zu lesen verstehen, mit der ich ihn schreibe, und meinen Wunsch, Sie mit allen Schätzen der Welt zu beschenken, wenn Gott mir diese Macht verleihen würde. Ja, alle, die ich gern habe, sollten ganz nach eigenem Gefallen eine große, eine mittlere oder eine kleine „Grenadière“ besitzen und alle Freuden des Paradieses im vorhinein, denn warum so lange darauf warten? Also leben Sie wohl, geben Sie Ondine einen Kuß auf die Stirn, und bewahren Sie, ich bitte, die Überzeugung meiner aufrichtigen Zuneigung und meiner tiefen mitfühlenden Bewunderung.
De Balzac
*
Das Leben selbst, Leidenschaften und schwere Erfahrungen, haben diese Frau, die keinen anderen Lehrmeister hatte als die innere Stimme und das Leid, dahin geführt, ihr Schluchzen zu modulieren. Es gibt zwei Arten von Dichtern: jene, die Erfindungsgabe haben, deutlicher gesagt, die Kunst haben, Phantasie, Schöpferkraft und nicht nur Empfänglichkeit, deren Geist sich jedem Stoff anzupassen vermag, eine Gabe, die man Talent nennt. Und es gibt andere, bei denen dieses Talent von den persönlichen Empfindungen nicht zu trennen ist und die infolge einer rührenden Schwäche nur Dichter sind, weil sie Liebende und solange sie es sind.
Madame Desbordes-Valmore ist auch ein Dichter durch die Liebe. Ihr Talent ist an ihr Fühlen gebunden, wie das Echo an die brandende Woge, wie die Woge an den stürmenden See. Wenn dieses Talent nie aufgehört hat, sein Klagelied zu singen und in die Höhe zu wachsen, so ist es, weil die Seele selbst, trotz so viel vergossener Fluten, sich unerschöpflich erwiesen hat:
„Denn ich bin nur ein schwaches Weib,
Ich wußte nur zu lieben, Leid zu tragen,
Nur meine Seele im Gesang zu klagen...“
1839. Sie gehört nicht zu jenen Seelen, für welche die Poesie nur ein kurzes Alter hat und die, je weiter sie in die immer ödere Steppe vordringen, die man das Leben nennt, sich verschließen, sich fortstehlen und von nun ab schweigen. Sie ist als klingende Harfe geboren und dennoch als zerbrochene. Was konnte sie so vorzeitig zerbrechen? Für sie ist jedes Leid ein Lied: das heißt also, daß sie seit fünf Jahren, in allem Mißgeschick ihres herumirrenden Lebens, das Singen nie gelassen hat. Jede aufsteigende Klage, jedes flüchtige Lächeln, jede zärtliche Regung des Mutterherzens, jeder wie schnell zerstörte Versuch zu einer frohen Melodie, jeder herbe Blick in eine Vergangenheit, deren Flammen noch immer nicht alle erloschen sind — alles das nach und nach, meist in Hast hingeworfen, wieder aufgegriffen, gesammelt und flüchtig verknüpft bildet den Band, dem sie den Namen „Arme Blumen“ gegeben hat. Es ist ein voller Erntekorb, hoch und eng geschichtet, dicht geschüttelt, mehr als voll von Farben und Düften, den die bescheidene Dichterin nicht eigentlich uns darbietet, sondern wie ermattet zu unsern Füßen niederfallen ließ.
In einem Gedicht mit dem Titel „Vor Dir!“ zeigt uns die Dichterin in kindlicher Liebe das Sterben ihrer Mutter, das Vermächtnis leidvoller Sensibilität, das diese ihr hinterlassen hat, und die zuerst unerkannt, dann allzu geweckt und bewußt immer in ihrem Herzen gelebt hat. Und dieses Herz, das von Anbeginn als Opfer der Liebe bestimmt war, — es „hatte noch kein Lied, sein Leid zu offenbaren“ — wie weiß sie es in seiner Unschuld und stummen Bedrängnis zu malen:
„Sein schwaches Schlagen, das der Zeiten Maß
Nur zögernd wiedergab, verriet, wie wenig Leben
In diesem Herzen war; und wie ein Kind, das eben
Halb eingeschlummert über seinen Büchern saß,
Hielt meine Hand mein Schicksalsbuch verschlossen;
Mein schwarzer Gürtel, meine dunkle Trauer band
Mich an der Mutter Grab — was hatte noch Bestand?
Die Welt war groß und leer; es fehlte ihr die Stimme,
Die einzige, die das wüste Lärmen und Gebraus
Zur Heimat machte; nein! die Welt war nicht mein Haus!
Ich scheute ihr Gesetz, ihr Urteil, ihre schlimme
Verlockung und Bedrohung — und von Angst gehetzt,
Fand ich das Wort, den Ruf, das laute Lied zuletzt!“
Wenn man solche Verse liest, verzeiht man die Schwächen, mit denen sie erkauft worden. Ja, die Qual der Seele ist oft lebendig in die Verse mit hinübergenommen. Die Tonfarbe spiegelt sie wider. Wenn die Träne im Auge von einem Sonnenstrahl getroffen wird, so hindert uns das am Sehen, alles bebt und schimmert. Der schluchzende Aufschrei kann nicht alles, was hinter ihm lebt, erkennen lassen.
Ein ganzer Herzensroman durchwebt dieses Buch, hie und da etwas gemindert, bald aber wird die Leidenschaft wieder übermächtig und kann nicht mehr an sich halten. Unerwartet, in einem Aufschwung, den nur sie unter den Dichterinnen von heute besitzt, ruft sie ihr Weh hinaus... Sappho muß solchen Aufschrei gehabt haben; oder vielmehr, man fühlt, daß diese Tochter Douais und Flanderns dort etliche Funken spanischer Glut mitbekommen hat, sie, die mit stetem Glauben zur Madonna aufsieht, wie die portugiesische Nonne...
1842. Als ich die leidvollen Briefe der Madame Valmore durchsah, ist mir oft eine andere Dichterin in den Sinn gekommen, und ich habe ihre Briefe mit denen Mademoiselle Eugénie de Guérins verglichen, die einige auserlesene Bücher veröffentlicht hat. Doch welch ein Unterschied, so sagte ich mir, zwischen den Schmerzen der einen und der andern. Die eine, edle Schloßherrin von Cayla, unter dem schönen Himmel des Südens, in trauter Umgebung, in ländlicher Einschränkung oder Armut, die doch noch immer Fülle ist, mit allem Geschmack eines jungfräulichen Interieurs. Die andere, im Staub und Schmutz der Großstadt, der Landstraße, stets auf der Suche nach einer Unterkunft, fünf Stockwerke erklimmend, überall anstoßend, — das Herz zerrissen ruft sie verzweifelt aus: „Wo sind die friedlichen Leiden des Provinzlebens?“ Und wer Madame Valmore in den langen Jahren schwerer Prüfung gekannt, wer sie in ihren bescheidenen und engen Wohnungen besucht hat, wo sie so viel Mühe hatte, den Haushalt zusammenzuhalten, wer sie da gesehen, liebenswürdig, heiter, anziehend, gastfreundlich sogar, wie sie allem einen Anstrich von Sauberkeit und künstlerischem Geschmack zu geben wußte und ihre Tränen hinter einer natürlichen Anmut verbarg, sie, der Zartesten und Empfindsamsten eine, doch immer tapfer und wachsam, wer sie so gesehen und ihren Lebens- und Leidensweg kennt, der wird sie noch weit mehr bewundern. Wenn man ferner bedenkt, welche endlosen Mühen und Sorgen um ihren Unterhalt diese so ehrenwerte und bedeutende Familie, diese kleine Gruppe auserlesener Menschen, die mit vielen befreundet und von sehr vielen, scheint es, protegiert war, die von allen geachtet, geliebt und bewundert wurde, zu bestehen gehabt, so fragt man sich: wo bleibt eigentlich unsere vielgerühmte Zivilisation? Man errötet für sie...
*
|
In „Portraits Contemporains.“ |
... Es ist die Liebe und die Züchtigkeit, erbleichend oder errötend in ihren Kämpfen; es ist die Leidenschaft mit ihren Flammen, ihren Tränen, fast hätte ich gesagt, ihrer Unschuld, so bitter ist ihr Kummer und ihre Reue! Die Leidenschaft mit ihrem Schrei vor allem. Madame Desbordes-Valmore, die Dichterin, ist die Poesie des Aufschreis. Nun, gibt es etwas Intimeres, etwas, das deutlicher das frische Blut der Wunden zeigt, das sprühender die Quelle der Seele verrät, als der Aufschrei? Die Herrlichkeiten mühseliger Dichtungen verblassen und vergehen; wo aber der Schrei einmal kraftvoll vibriert hat, vibriert er immer, solange es auf Erden eine Seele gibt, ihm Echo zu sein.
*
... Sie sind unter den zeitgenössischen großen Talenten wohl mehr als eine Seele; Sie sind ein Herz. Es gibt Seele und gibt Herz, gibt die Welt der Gedanken und die Welt der Gefühle. Ich weiß nicht wer und ob einer in unserem Jahrhundert die erstere besitzt, gewiß aber haben Sie die zweite. Sie sind Königin darin...
*
Ist es uns nicht mehr als einmal begegnet, daß, wenn wir einem Freunde unsere Neigung, unsere Begeisterung für irgend etwas anvertrauten, zur Antwort bekamen: „Nun, das ist doch sonderbar! Das steht ja in völligem Widerspruch mit Ihren sonstigen Leidenschaften und Anschauungen?“ Und wir entgegnen dann: „Möglich, aber es ist so. Es gefällt mir; es entzückt mich, wahrscheinlich wegen eben dieses auffälligen Gegensatzes mit meinem eigentlichen Ich.“
So ergeht es mir mit Madame Desbordes-Valmore. Wenn der Aufschrei, der unverfälschte Seufzer einer erlesenen Seele, wenn die Hingabe und Verzweiflung des Herzens, wenn ursprüngliche Anlagen und Gaben — alles, was Gott als unverdiente Gnade schenkt — wenn das genügt, um einen großen Dichter zu machen, so ist Madame Valmore ein großer Dichter und wird es immer sein. Es ist wahr, wenn man sich die Zeit nimmt, dem nachzuspüren, was ihr fehlt, was durch Fleiß und Mühe erworben werden kann, so wird ihre Größe wesentlich beeinträchtigt. Doch selbst dort, wo ein Mangel an Sorgfalt, ein Holpern uns überlegte Menschen, die wir durchaus verantwortlich sind für unsre Nachlässigkeiten, ärgert und betrübt — selbst dann werden wir von einer plötzlichen, unerwarteten, unvergleichlichen Schönheit des Ausdrucks hingerissen und in den Himmel der Poesie erhoben. Nie war ein Dichter einfacher und aufrichtiger, nie ungekünstelter! Keiner hat diesen Reiz, diese Anmut erreicht, eben weil sie persönlich und eingeboren ist.
Wenn je ein Mann seine Gattin oder seine Tochter von den Gaben der Muse beglückt und geehrt sehen möchte, er könnte sich diese Gaben nicht anders und schöner träumen, als sie Madame Valmore beschieden waren. Unter der beträchtlichen Anzahl von Frauen, die sich heutzutage auf die Literatur geworfen haben, gibt es recht wenige, deren Tätigkeit nicht entweder der Kummer ihrer Angehörigen, ja selbst ihres Geliebten gewesen wäre (denn der zügelloseste Mann verlangt vom Gegenstand seiner Liebe eine keusche Zurückhaltung), oder aber eine Nachahmung männlicher Schwächen und Albernheiten, die bei der Frau abgeschmackt wirken. Wir kennen die schriftstellernde Frau als Philanthropin, als doktrinäre Priesterin der Liebe; sie verherrlicht republikanische Ideen oder andere Zukunftsträume, sie ist Anhängerin Fouriers oder Saint-Simons, und unsere schönheitsuchenden Augen konnten sich nie an dieses unschöne Systematisieren und Abzirkeln, an all diese lästerlichen und ruchlosen Dinge (es gibt sogar Dichterinnen des Lasters), an diese entwürdigende Nachahmung männlichen Geistes gewöhnen.
Madame Desbordes-Valmore war Weib, war immer Weib und nichts als Weib; aber sie war die vollendete, höchste Personifizierung der natürlichen schönen Weiblichkeit. Ob sie vom sehnenden Verlangen des jungen Mädchens, von der traurigen Klage der verlassenen Ariadne oder der glühenden Inbrunst mütterlicher Barmherzigkeit singt — ihr Lied bewahrt stets diese köstliche Weiblichkeit. Da ist nichts Künstliches, nichts Angelehntes, nichts als das „ewig Weibliche“, wie jener deutsche Dichter sagt. So hat Madame Valmore in ihrer Wahrhaftigkeit, in ihrer Echtheit ihren Lohn gefunden, das heißt einen Ruhm, der dem des vollendeten Künstlers nicht nachsteht. An den tiefen Gluten des eigenen Herzens entzündet sie die Fackel, mit der sie in die geheimnisvolle Wirrnis der Empfindungen hineinleuchtet und unsere dunkelsten Erinnerungen der Liebe, auch der Kindesliebe, ans Licht hebt. Victor Hugo hat dem süßen Zauber der Häuslichkeit — wie allem, was er besingt — wundervollen Ausdruck gegeben; doch nur in den Dichtungen der glühenden Marceline findet ihr die mütterliche Innigkeit, die einige wenige unter uns Weibgeborenen in köstlichem Andenken bewahren. Wenn ich nicht besorgen müßte, man könne den Vergleich als eine Herabsetzung dieser verehrungswürdigen Frau ansehen, so würde ich sagen, ich finde in ihr die Anmut und unruhige Wachsamkeit, die Schmiegsamkeit und das Ungestüm einer Katze oder Löwin, die Mutter ist.
Es heißt, Madame Valmore, deren erste Poesieen schon weit zurückliegen (1818), sei von unserer Zeit sehr schnell vergessen worden. Vergessen worden, von wem, ich bitte? Von denen, die nichts fühlen und daher nichts bewahren. Sie hat die großen und gewaltigen Eigenschaften, die sich dem Gedächtnis eingraben, die explosive Kraft der Leidenschaft, die in unsere Herzen einschlägt und sie mit fortreißt. Kein Dichter findet ungezwungener den einzig ersten Gefühlsausdruck, das unbewußt Erhabene. Wie einerseits das einfachste und selbstverständlichste Erarbeiten dieser feurigen Feder fremd und unmöglich ist, so ist anderseits das, wonach alle anderen mühsam ringen, ihr natürliches Teil; es ist ein immerwährendes neues Finden. So sicher und sorglos, wie wir eine Adresse schreiben, wirft sie die Kostbarkeiten aufs Papier. Eine mitfühlende und inbrünstige Seele, die sich — selbstredend ganz unbewußt — in jenem Vers erkennt und zu erkennen gibt:
„Solange man noch geben kann, kann man nicht sterben.“
Empfindsame Seele, der das rauhe Leben unheilbare Narben eingrub, war es ihr vor allem, die sich ein Lethe ersehnte, gestattet auszurufen:
„Doch kann uns der Erinnerung nichts entheben —
Wozu, mein Herz, wozu das Sterben dann?“
Gewiß, niemand war berechtigter als sie, einem neuen Gedichtbande den Satz voranzuschicken:
„Gefangen lebt in diesem Buche eine Seele.“
Selbst als der Tod erschien, um sie von dieser Welt, deren Leiden sie so tapfer getragen hatte, abzurufen und dem Himmel zuzuführen, nach dessen friedvollen Freuden sie so glühend verlangte, selbst da noch konnte Madame Desbordes-Valmore, die unermüdliche Priesterin der Muse, nicht verstummen, so immervoll von Schmerzensrufen und Liedern war sie, die sich ergießen wollten; sie bereitete einen weiteren Band Gedichte vor, dessen Inhalt Stück um Stück auf ihrem Schmerzenslager reifte, das sie seit zwei Jahren nicht mehr verließ. Sie, die ihr andächtig bei der Zusammenstellung dieser Abschiedsblätter halfen, haben mir gesagt, daß darin das ganze Feuer einer Lebensenergie zu finden sei, die nirgends so lebendig war wie im Leid. Ach! dies Buch wird nun als letzter, nachgelassener Kranz all den strahlenden anderen hinzuzufügen sein, mit denen eines unserer blühendsten Gräber geschmückt sein sollte.
Ich habe immer gern in der großen und sichtbaren Natur nach Beispielen und Gestaltungen gesucht, die mir zur Charakterisierung geistiger Erscheinungen und Eindrücke dienen könnten. Ich stelle mir vor, wie die Kunst der Madame Desbordes-Valmore auf mich wirkte, damals, als ich sie mit den Augen des Jünglings durchblätterte, die bei empfänglichen Menschen so voll Glut und Scharfsichtigkeit sind. Diese Dichtung erschien mir wie ein Garten. Doch das ist nicht die großartige Würde des Versailler Parks, das ist auch nicht die mächtige Pose des selbstbewußten Italiens, das es so vortrefflich versteht, „Gärten zu errichten“ (aedificat hortas); das ist auch nicht „das Tal der Flöten“ oder das „Tänaron“ unseres alten Jean-Paul. Es ist ein schlichter englischer Garten, wundersam romantisch. Üppige Blumenstauden repräsentieren den überströmenden Gefühlsausdruck. Volle, reglose Weiher, die, auf dem umgestürzten Himmelsbogen ruhend, alle Dinge spiegeln, versinnbildlichen die tiefe Resignation, die dort tausend Erinnerungen spiegelt. Nichts fehlt diesem entzückenden Garten einer vergangenen Zeit, weder vereinzelte Ruinen, die sich in grüner Wildnis bergen, noch das fremdartige Grabmal, das uns an einer Wegbiegung überrascht, die Seele ergreift und an die Ewigkeit mahnt. Gewundene und düstere Alleen führen zu überraschenden Ausblicken, gleichwie der Gedanke der Dichterin nach allerlei wunderlichen Kurven die offene Fernsicht in Vergangenheit oder Zukunft eröffnet. Doch diese Himmel sind zu weit, um dauernd klar zu sein, und der Wärmegrad zu groß, um nicht Stürme zu entfesseln. Der Wanderer, der die gramverhüllten Fernen betrachtet, fühlt sein Auge feucht werden von hysterischen Tränen. Die Blumen neigen sich und erliegen, die Vögel reden nur noch flüsternd. Ein erster Blitz flammt auf, ihm folgt ein Donnerschlag: es ist die lyrische Explosion, und schließlich verleiht eine unvermeidliche Tränenflut all den niedergeworfenen, leidenden und entmutigten Dingen von neuem Frische und Jugendkraft.
Etwas von dem Mißgeschick, das Marceline Desbordes-Valmores Leben beharrlich begleitete, hat auch über dieser deutschen Darstellung ihres Schicksals gewaltet, die schon 1914 vorbereitet war. Erst machte der alles zerstörende Weltkrieg dies vermittelnde Werk zunichte, dann starb 1917 Gisela Etzel-Kühn, ehe sie Briefe und Gedichte in beabsichtigter Vollständigkeit übersetzen konnte. So erschien die erste Ausgabe nicht ganz zulänglich und wurde nicht erneuert, was aber der nun endgültigen insofern zugute kam, als inzwischen wichtige Teile der Korrespondenz und des Lebensschicksals sich aufschlossen. Die Ergänzung der Gedichte und Briefe hat nun Friderike Maria Zweig besorgt: diese beiden Teile wurden entsprechend dem innerlichen Geschehnis auch neu angeordnet, so daß jetzt Einleitung, Briefe und Gedichte als eine einzige unlösbare Einheit von Gestalt und Gestaltung dargeboten werden konnten.
| INHALT |
| ERSTER TEIL |
| Stefan Zweig: Bildnis ihres Schicksals |
| Die verlorene Kindheit |
| Die Schauspielerin |
| Die Liebende |
| Tragödie |
| Der Verführer |
| Die Verlassene |
| Valmore |
| Die Nomade |
| Menschlichkeit |
| Die Dichterin |
| Die Frau |
| Mater Dolorosa |
| Hingang und Unsterblichkeit |
| ZWEITER TEIL |
| Marceline Desbordes-Valmore: Gedichte |
| Mein Zimmer |
| Vorahnung |
| Elegie |
| Die Rosen von Saadi |
| Herbstsang |
| Vor dir! |
| Brief einer Frau |
| An meine Schwester |
| Trennungv |
| Die Verzeihung |
| Schlafe |
| Gebet |
| Seele und Jugend |
| Das Leben |
| An die Sonne |
| Hab Dank, mein Gott |
| An jene, die weinen |
| Die Gefängnisse und die Gebete |
| Ein Neugeborener |
| Um das Kind einzuschläfern |
| Das Kopfkissen eines kleinen Mädchens |
| An meinen Sohn |
| Palmsonntag |
| Entsagung |
| Suchende Seele |
| Der entblätterte Kranz |
| DRITTER TEIL |
| Autobiographische Fragmente |
| An Sainte-Beuve |
| Allererste Liebe |
| Aus einer Autobiographie |
| Aufzeichnungen aus Italien |
| Ein Traum |
| VIERTER TEIL |
| Briefe |
| FÜNFTER TEIL |
| Urteile der Mit- und Nachwelt |
| Nachwort |
[Ende der Marceline Desbordes-Valmore: Das Lebensbild einer Dichterin, bei Stefan Zweig]